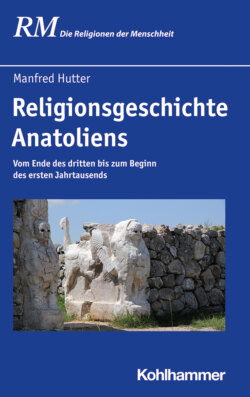Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Die politische und geographische Situation im zentralanatolischen Raum zur Zeit der altassyrischen Handelskolonien vom 20. bis zum 18. Jahrhundert
ОглавлениеDie archäologischen Schichten der Bronzezeit in Alaca Höyük mit den Gräbern sind durch eine 30 bis 50 cm dicke Brandschicht von der nächsten Besiedlungsschicht getrennt, deren einfache Hausstrukturen man wahrscheinlich zeitlich mit den Funden der altassyrischen Handelskolonien an anderen Orten verbinden kann.19 Diese in Alaca Höyük bestehende Besiedlungslücke ermöglicht daher keine weiteren Informationen über die historische Entwicklung dieses Ortes, wie es überhaupt schwierig ist, Details über die politische Geschichte des 3. Jahrtausends in Zentralanatolien zu nennen. Dies ändert sich erst zu Beginn des 2. Jahrtausends mit den ältesten schriftlichen Quellen auf anatolischem Boden, ca. 23.000 altassyrischen Briefen, Wirtschaftsurkunden und Vertragsvereinbarungen,20 die vor allem im kārum, dem Wirtschaftszentrum der Händler aus Assyrien in der Stadt Kaneš gefunden wurden. Dadurch gewinnen wir Einblick in die Geschichte, Wirtschaft und Kultur Zentralanatoliens und können auch wenigstens teilweise Aussagen über religiöse Vorstellungen treffen.
Der Fundort Kaneš, heute als Kültepe bezeichnet, liegt rund 20 Kilometer östlich der heutigen Stadt Kayseri südlich des Flusses Kızılırmak und erstreckt sich in ovaler Form auf einer Fläche zwischen 450 und 550 Metern mit einer Höhe von 20 Metern. Dabei kann man zwischen der Oberstadt mit Repräsentationsbauten und der Unterstadt, dem kārum (»[Handels-]Kai«) der assyrischen Händler, unterscheiden. Während für die Unterstadt lediglich vier archäologische Schichten nachweisbar sind, zeigt die Oberstadt – mit 18 Schichten – eine Besiedlung von der Frühen Bronzezeit bis in die römische Zeit.21 Die Oberstadt war das Verwaltungszentrum, auch wenn wir über Herrschernamen aus Kaneš erst aus dem 17. Jahrhundert genauer Bescheid wissen. Denn die überwältigende Mehrheit der Texte, die in der archäologischen Schicht kārum II in der Unterstadt22 gefunden wurden, bezieht sich in der älteren Zeit immer nur pauschal auf den Herrscher bzw. die Herrscherin von Kaneš. Diese Texte umfassen den Zeitraum von etwas mehr als einem Jahrhundert, wobei die Anwesenheit assyrischer Händler kurz vor 1820 wegen der Zerstörung von Kaneš aufgrund von Unruhen unterbrochen wurde. Allerdings begann eine Wiederansiedlung und die erneute Aufnahme des Handels um 1800, die bis 1730/25 andauerte.23 Diese Siedlungsphase umfasst die Schicht kārum Ib, in der lediglich rund 500 Texte gefunden wurden – eine deutliche Diskrepanz gegenüber der Anzahl der Texte aus Schicht II, was auf einen Rückgang der Handelsaktivitäten schließen lässt. Aus all diesen Texten geht hervor, dass Kaneš das Zentrum für den assyrischen Handel mit Anatolien gewesen ist, allerdings nennen nicht nur die Texte weitere Handelsniederlassungen, sondern auch der archäologische Befund mit vergleichbaren altassyrischen Textfunden dieser Zeit – allerdings in wesentlich geringerem Ausmaß – bestätigt dies. Entsprechende Funde stammen aus Alişar, Acem Höyük, Konya-Karahöyük, Kayalıpınar und Ḫattuš(a). Der Wohlstand, den solche lokalen Fürstensitze zeigen, spiegelt auch einen kulturellen und wirtschaftlichen Austausch untereinander wider, der bis in den nordsyrischen Raum nach Karkamiš und Mari reicht; auch die Großarchitektur der anatolischen Orte zeigt teilweise Beziehungen nach Syrien.24
Auch wenn die altassyrischen Texte rund dreißig größere Siedlungen in Anatolien nennen, kann man v. a. mit fünf bedeutsamen Fürstentümern in Zentralanatolien im 19. und 18. Jahrhundert rechnen, die nicht nur miteinander in regem diplomatischem Kontakt standen, sondern auch die Grundlagen für das spätere Hethiterreich als »Flächenstaat« mit einer – durch die politische Einheit – gemeinsamen Kultur geschaffen haben. Die verschiedenen ursprünglichen Traditionen wirkten aber lange nach und wurden je unterschiedlich im Hethiterreich tradiert. Südlich des Kızılırmak befanden sich drei Zentren – neben Kaneš spielten besonders Waḫšušana und das westlich gelegene Burušḫattum eine wichtige Rolle; innerhalb des Bogens, den der Flusslauf des Kızılırmak bildet, lag Ḫattuš, die spätere hethitische Hauptstadt, sowie weit im Norden Zalpa. Letzterer Ort lag zwar abseits von den assyrischen Handelsniederlassungen, stand aber mit Kaneš und Ḫattuš in Kontakt.
Die Geschichte des 20. bis 18. Jahrhunderts25 zeigt – wie aus den altassyrischen Texten hervorgeht – einen regen Austausch zwischen den einzelnen Orten, da durch die Handelswege auch Kommunikationsnetzwerke entstehen. Aus Assyrien importierte Handelsgüter dieser Zeit waren vor allem wertvolle Textilien und annukum-Metall, wahrscheinlich Zinn, das in Anatolien für die Herstellung von Bronze benötigt wurde, da in Zentralanatolien eine reichhaltige Kupferförderung möglich war.26 Im Gegenzug wurden Gold und Silber aus Anatolien nach Assyrien gehandelt. Die Handelsinteressen dürften aber zu Spannungen zwischen den anatolischen Zentren untereinander geführt haben,27 da es Hinweise auf zunehmende Konflikte und Unruhen in Zentralanatolien gibt, die wahrscheinlich in der Zerstörung von Kaneš um oder kurz nach 1830 einen Höhepunkt fanden. Möglicherweise ist diese Zerstörung durch einen Angriff der nordanatolischen Stadt Zalpa – eventuell gemeinsam mit Ḫattuš – auf Kaneš geschehen, da der – jüngere hethitische Anitta-Text – eine kriegerische Aktion von Uḫna, dem Herrscher von Zalpa, gegen Kaneš nennt, bei der auch die Statue der Stadtgottheit von Kaneš nach Zalpa entführt wurde. Obwohl sich somit das weit im Norden gelegene Zalpa zumindest kurzzeitig bis nach Zentralanatolien orientierte, taucht der Name dieser Stadt in den Texten der assyrischen Handelskolonien nicht auf. Massimo Forlanini vermutet, der Grund dafür könnte in einem Abkommen zwischen Kaneš und den Assyrern liegen, um diese mit Kaneš verfeindete Stadt vom »internationalen« Handel abzuschneiden.28 Genauso bestehen in dieser Zeit Spannungen zwischen Kaneš und Mama. Ein weiterer zentraler Ort, dessen überregionales Ansehen nicht übersehen werden darf, war Burušḫattum (in hethitischen Texten taucht der Name in der Form Purušḫanda auf). Die Stadt lag westlich des Kızılırmak, wobei sie oft mit der Ausgrabungsstätte Acem Höyük (südöstlich des großen Salzsees) identifiziert wurde; neuere Forschungsindizien sprechen aber eher dafür, dass Burušḫattum noch weiter im Westen (eventuell im Raum der heutigen Stadt Akşehir) zu suchen wäre.29 Dass Burušḫattum ein wichtiges Fürstentum im 19. Jahrhundert war, geht daraus hervor, dass der Herrscher von Burušḫattum von den Assyrern als »Großkönig« (rubā’um rabûm; LUGAL.GAL) bezeichnet wird, während alle anderen anatolischen Herrscher immer nur als rubā’um »König, Fürst« angesprochen werden, was aufgrund der dichten Beleglage in den altassyrischen Texten aus kārum II sicherlich nicht als zufälliger Überlieferungsbefund zu werten ist.30 Somit lässt sich das politische Verhältnis bis ca. 1830 wie folgt zusammenfassen: Zentralanatolien bildet keine politische Einheit, sondern ist durch kleine – in wechselseitigen Spannungen stehende – Fürstentümer geprägt; dabei ist ferner festzustellen, dass anscheinend Burušḫattum im Westen, Zalpa (oder/und vielleicht Hattuš) nördlich des Kızılırmak und Kaneš von größerer Bedeutung waren als andere Siedlungen.
Um etwa 1800 kam es zur Wiederaufnahme der assyrischen Handelstätigkeit in Kaneš und zur Wiederbesiedlung (kārum Ib), was aber auch zu erneuten Auseinandersetzungen mit den Nachbarn führte. Der erste Herrscher von Kaneš bei diesem Neuanfang ist Ḫurmeli, dem Baḫanu mit einer wahrscheinlich nur kurzen Herrschaft nachfolgt. Inar (regierte möglicherweise etwa um 1790–1775) musste sich kriegerisch gegen das Fürstentum Ḫaršamna (wahrscheinlich nordöstlich von Kaneš) behaupten; sein Nachfolger Waršama ist als Empfänger eines Briefs von Anum-Ḫirbi von Mama bekannt, was den »diplomatischen« Kontakt zwischen lokalen anatolischen Herrschern (unter Verwendung der altassyrischen Sprache) zeigt. Die in weiterer Folge noch bekannten Herrscher in Kaneš waren Pitḫana, Anitta und Zuzzu.31
Ein tiefschneidender Eingriff in die Geschichte von Kaneš geschah unter Pitḫana von Kuššara (um 1750–1745/40), der ausgehend von seinem Herrschaftssitz Kaneš eroberte und zum Hauptsitz seiner Dynastie (mit seinem Sohn Anitta als Nachfolger) ausbaute, aber zugleich auch eine Ausbreitung seines Einflussbereichs weiter in den Westen in die Wege leitete. Über den Aufstieg der Dynastie von Kuššara in Zentralanatolien sind wir durch den so genannten Anitta-Text32 in hethitischer Sprache informiert, der in den ersten neun Zeilen die Eroberung der Stadt durch einen nächtlichen Angriff der Truppen Pitḫanas beschreibt. Die im weiteren Narrativ des Textes beschriebenen kriegerischen Auseinandersetzungen betreffen besonders den Norden (Zentral-)Anatoliens und den Westen. Der Feldzug gegen Zalpa im Norden endet erfolgreich mit der Rückholung der Statue der Stadtgottheit von Kaneš, die Jahrzehnte zuvor von Uḫna verschleppt worden war. Ḫuzziya, der König von Zalpa, wurde von Anitta gefangen und nach Kaneš mitgenommen. Auch Ḫattuša wurde von Anittas Truppen erobert und zerstört, nachdem sich ihr König Piyušti schon zuvor zweimal Anitta widersetzt hatte. Das Vorgehen gegenüber Ḫattuša könnte mit der konkurrierenden wirtschaftlichen Bedeutung von Ḫattuša zusammenhängen, denn dort gab es – im Unterschied zum (zu) weit nördlich gelegenen Zalpa – ebenfalls eine florierende assyrische Handelsniederlassung, wodurch Hattuša in dieser Hinsicht ein gefährlicherer Konkurrent für Kaneš war, als dies bei Zalpa der Fall war.33 Die Aktivitäten Anittas in Richtung Westen betreffen in erster Linie Burušḫattum, dessen Großkönig sich Anitta unterwirft und ihm seine Herrschaftsinsignien – einen eisernen Thron und ein eisernes Szepter – übergibt. Als Gegenleistung räumt Anitta dem (abgesetzten) Herrscher von Burušḫattum jedoch einen Ehrenplatz zu seiner Rechten ein, was zwar offensichtlich die hohe Achtung Anittas gegenüber dem Großkönigtum in Burušḫattum ausdrückt, aber durch die Unterwerfung dieses Großkönigs für Anitta auch den Weg frei macht, nunmehr sich selbst als »Großkönig« zu bezeichnen und diesen Titel in die Titulatur der hethitischen Tradition einzuführen.34
Anittas Nachfolger (und letzter namentlich bekannter Herrscher von Kaneš) war Zuzzu.35 Unklar bleibt, ob er ein Sohn Anittas oder ein Usurpator war; letzteres könnte der Fall gewesen sein, da Zuzzu sich auch als »Großkönig von Alaḫzina« bezeichnet, möglicherweise sein Herkunftsort. Mit ihm endet um 1725 die politische Bedeutung von Kaneš.36 Bis zum Beginn der althethitischen Zeit (in der »neuen« Hauptstadt Ḫattuša) besteht ein von der Forschung hinsichtlich der Länge unterschiedlich bewerteter Hiatus, da einerseits die Länge der Regierung von Zuzzu von Kaneš nicht exakt festgelegt werden kann, andererseits auch die ersten hethitischen Könige in Ḫattuša (Ḫuzziya und Labarna I.) und damit der genaue Beginn des hethitischen Königtums in Ḫattuša nicht in allen Details rekonstruierbar ist. Trotz dieses Einschnitts setzen sich manche Traditionen in der althethitischen Zeit fort.
Blickt man neben den skizzierten politischen Verhältnissen auf die kulturelle und ethnische Situation des anatolischen Raums, so ist auf drei geographische Räume zu verweisen, die schwerpunktmäßig eine je eigene ethnische Prägung zeigen,37 auch wenn es selbstverständlich Überlappungen dieser Prägung gegeben hat. Kaneš war das Kerngebiet der »hethitischen« Bevölkerung, die sich selbst wahrscheinlich als »Nesier« (hergeleitet vom Ortsnamen Neša/Kaneš) und ihre Sprache als nišili-38 bezeichnen. Dass die anatolische Bevölkerung von Kaneš (oder zumindest ein maßgeblicher Anteil davon) als Hethiter zu betrachten ist, kann man aus einer Reihe von hethitischen Wörtern erschließen, die als Fremdwörter bereits Eingang in die altassyrischen Texte von kārum II gefunden hatten, bzw. vor allem durch in diesen Texten bezeugte Personennamen. Linguistisch ist diese Form des Hethitischen in Kaneš jedoch nicht identisch mit dem Hethitischen der Texte aus Ḫattuša; dazu trägt wohl der Umstand bei, dass die ältesten Hinweise auf Hethitisches in Kaneš fast drei Jahrhunderte früher zu datieren sind als die ersten Texte aus Ḫattuša. Möglicherweise kann man das Hethitische in Kaneš und die Sprache in Ḫattuša als zwei Dialekte des Hethitischen bewerten, wie unlängst Alwin Kloekhorst durch eine Untersuchung des Namenmaterials postuliert hat.39 Die Verbindung der Herrscherschicht von Kaneš mit dem Hethitischen zeigt auch der Name des Königs Inar, der – wie der gleichlautende Name der (Schutz-)Gottheit Inar – mit dem hethitischen Wort innara- »stark« zu verbinden ist. Die Bevölkerungsverteilung in Kaneš weist zwar darauf hin, dass die anatolische Bevölkerung vor allem im Bereich der Oberstadt und die assyrischen Händler im Bereich der Unterstadt lebten, allerdings war die Unterstadt, das kārum der Assyrer, zugleich jener Raum der Stadt, in dem Assyrer und Anatolier im regelmäßigen Austausch miteinander standen. Die Handelskontakte führten zu weiteren Sozial- und Kulturkontakten,40 was sich auch in Mischehen zwischen der einheimischen anatolischen Bevölkerungsgruppe und den assyrischen Händlern widerspiegelt. Mit dem Rückgang der assyrischen Handelsaktivitäten in der Phase kārum Ib hat der Anteil von Anatoliern in der Unterstadt zugenommen und dadurch möglicherweise den kulturellen Kontakt mit den Assyrern noch verstärkt. Die hethitische Bevölkerung ist im Wesentlichen jedoch auf das Gebiet von Kaneš ausgehend in den Süden und entlang des Oberlaufs des Kızılırmak beschränkt gewesen, während innerhalb des Halysbogens die Siedlungsgebiete der hattischen Bevölkerung lagen. Da aber deren wichtige Siedlungen in den assyrischen Handel einbezogen waren, ist – abgesehen von den kriegerischen Auseinandersetzungen – wohl auch mit kulturellem Austausch zwischen Hethitern, Hattiern und Luwiern zu rechnen. Die Luwier41 scheinen – von Kaneš aus gesehen – entlang des Unterlaufs des Kızılırmak und weiter westlich davon gewohnt zu haben, wobei das Großkönigtum von Burušḫattum eines der wichtigen luwischen Zentren42 schon in der Zeit der altassyrischen Handelskolonien war, das im kulturellen und politischen Austausch bzw. in Auseinandersetzung mit den nördlich bzw. nordöstlich von ihnen siedelnden Hattiern stand. Somit lassen sich siedlungsgeographisch drei – auch ethnisch-sprachlich geprägte – Schwerpunkte mit Hethitern, Hattiern und Luwiern bereits für das 19. und 18. Jahrhundert rekonstruieren – wobei bezüglich der Hattier eine Kontinuität zu jenen Traditionen denkbar ist, die ein halbes Jahrtausend zuvor in Alaca Höyük feststellbar sind, obgleich (zumindest bis heute) für Alaca Höyük keine Einbindung in den assyrischen Handel oder die Existenz eines assyrischen kārum bekannt ist.