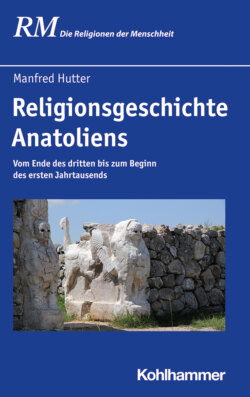Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A Einleitung und Forschungsstand
ОглавлениеDie Religionsgeschichte Anatoliens ist ein Kapitel »toter« Religionsgeschichte, wobei der zeitliche Rahmen, der hier behandelt werden soll, vom späten 3. Jahrtausend bis in die ersten Jahrhunderte des 1. Jahrtausends v.u.Z. reicht. Dieser Zeitraum ist von Beginn an von vielfältigen Religionskontakten, gegenseitigen Beeinflussungen und Berührungen geprägt. Denn die Religionsvorstellungen Anatoliens standen in Wechselwirkung mit denen in Syrien und Mesopotamien, die ihrerseits heute auch nur noch historische Religionen sind. Allerdings ist diese »gebrochene Tradition« indirekt lebendig geblieben, da manches über zwei Wege in die europäische Geistes- und Kulturgeschichte weitervermittelt wurde, einerseits über die – geringere – Vermittlung kleinasiatisch(-nordsyrisch)en Gedankengutes in der Rezeption der Hebräischen Bibel, andererseits in der stärkeren Übernahme von Vorstellungen aus Kleinasien in mythologische Traditionen der griechischen Antike. Zugleich steht die Religionsgeschichte Anatoliens selbstverständlich auch im Kontext der antiken Religionen des Vorderen Orients, nicht nur mit den schon erwähnten Räumen Syriens und Mesopotamiens, sondern genauso wirkt auf dem Gebiet der heutigen Türkei manches in Erinnerung bzw. wiedererfundenen Erinnerung an die Kulturen Anatoliens weiter, auch wenn zwischen den anatolischen Sprachen und Bevölkerungsgruppen des 2. Jahrtausends v.u.Z. und den wesentlich später fassbaren turksprachigen Bevölkerungsteilen, die durch eine Westwanderung aus Zentralasien nach Anatolien gekommen sind und bis heute große Teile der Türkei prägen, eine chronologische Lücke besteht.
Bereits ein oberflächlicher Blick auf den Raum Anatoliens zeigt innerhalb der chronologischen Abgrenzung sowohl einen sprachlichen als auch geographischen »Pluralismus«, der in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher geworden ist. Damit stellt sich als Ausgangssituation und Aufgabe für die Religionswelt Kleinasiens, diese Vielfalt – mit Kontinuitäten, Neuerungen und Brechungen von Traditionen – zu berücksichtigen, auch wenn wir klarerweise noch weit davon entfernt sind, eine lückenlose »Geschichte« der Religionen Anatoliens zu rekonstruieren oder alle theologischen Differenzierungen sowie unterschiedlichen lokalen Ausprägungen religiöser Erscheinungen erfassen zu können. Diese Einschränkung liegt besonders in der Quellensituation begründet, die nach wie vor unausgeglichen ist – sowohl bezüglich der chronologischen als auch der geographischen Streuung. Daher ist es notwendig, diese Religionswelt in ihrer Vielfalt zu betrachten, und methodisch ist zu beachten, dass die Religion der »Hethiter« (durch die Quellenlage aufgrund längerfristiger politischer Beherrschung eines Flächenstaates für fast ein halbes Jahrtausend dokumentiert) nicht als »Norm« oder als »typisch« für die Religionsvielfalt Anatoliens gelten kann, sondern sie ist nur eine Ausformung dieser Vielfalt.
Die eingedeutschte Volksbezeichnung »Hethiter« stammt von Martin Luther, der damit den Ausdruck ha-ḥittī(m) der Hebräischen Bibel wiedergibt. Dieser entspricht etymologisch der Benennung in akkadischen Texten, in denen vom »Land Ḫatti« oder von den »Ḫatti-Leuten« die Rede ist. Dabei gehen alle diese Bezeichnungen auf einen geographischen Begriff für das Gebiet innerhalb des Halysbogens1 in Zentralanatolien zurück. Wie die »Hethiter« sich selbst als Volk bezeichnet haben, wissen wir nicht; da sie ihre Sprache als nišili- bezeichneten, eine Ableitung vom Ortsnamen Neša (Kaneš), einem wichtigen politischen Zentrum des frühen 2. Jahrtausends v.u.Z., darf man vermuten, dass sie sich vielleicht Nesier nannten. Wahrscheinlich sind diese »Nesier« bzw. »Hethiter« in der 2. Hälfte des 3. Jahrtausends v.u.Z. entweder über die Dardanellen im Westen oder über den Kaukasus nach Kleinasien eingewandert, wo ihr Kerngebiet zunächst südlich des Halysbogens lag. Gemeinsam mit den Hethitern sind die Palaer und Luwier nach Kleinasien gekommen. Diese Einwanderer trafen auf die dort ansässigen Hattier, die im späten 3. und im frühen 2. Jahrtausend ihr zentrales Siedlungsgebiet innerhalb des Halysbogens hatten. Der gesamte geographische Raum ist durch Regenfeldbau charakterisiert, was die Wirtschaft, aber auch ideelle Konzepte beeinflusst hat. Dadurch haben offensichtlich die »Einwanderer« schnell zu einer Symbiose mit der schon vorhandenen Bevölkerung gefunden, zumal auch der archäologische Befund keinen Bruch in der materiellen Kultur zeigt, den man den einwandernden »Hethitern« zuschreiben könnte.
Als weiteres Bevölkerungselement werden etwa ab 1500 die Hurriter wichtig, deren ursprüngliche Siedlungsgebiete in Nordsyrien und Südostanatolien bzw. Obermesopotamien zwischen dem Tigris und dem Vansee lagen. Für die Geschichte der altkleinasiatischen Religionen beinhaltet dieser geraffte Abriss bereits eine erste – immer wieder so gut es geht zu berücksichtigende – Konsequenz, die vorhin schon angedeutet wurde: Die genannten Ethnien leben in einer politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Symbiose, die zwar politisch (meist) zentral gelenkt war, aber in religiöser Hinsicht keine hierarchische Normierung kannte, die – analog zur politischen Einheit – eine religiöse Einheit bewirkt hätte.
Durch den politischen Zusammenbruch des Hethiterreiches zu Beginn des 12. Jahrhunderts verschwinden auch flächendeckende überregionale politische Machtgefüge. Im Südosten (bis in den Norden des modernen Syrien ausgreifend) entfaltet sich mit Karkamiš ein größeres Machtzentrum, westlich davon schließen sich Kleinstaaten in Kilikien südlich des Taurusgebirges an, die zum lykischen Raum überleiten. An der Südwest- und Westküste mit dem Hinterland etablieren Lyder und Karer ihre politische Macht, während große Teile des ehemaligen Hethiterreiches in Zentralanatolien bis ins 1. Jahrtausend durch Phryger besiedelt sind, eine Bevölkerungsgruppe, die wohl bereits im späten 2. Jahrtausend vom Balkan kommend nach Anatolien eingewandert ist. Am Rande der heutigen Osttürkei und in großen Teilen des modernen Armenien und des Nordwestens vom Iran bilden vom 9. bis 7. Jahrhundert die Urartäer ein eigenes Machtzentrum. Diese oberflächliche Skizzierung der strukturellen Vielfalt des »politischen« Kleinasien des frühen 1. Jahrtausends macht deutlich, dass die kulturelle, politische und auch religiöse Situation jeweils eine eigenständige regionale Betrachtung erfordert.
Dabei sind immer wieder die Wechselwirkungen und der Kontakt zwischen diesen genannten Gebieten Kleinasiens zu berücksichtigen, aber auch der »gebende und nehmende« Kulturkontakt nach außen – d. h. einerseits in den nordsyrisch-aramäischen sowie in den obermesopotamisch-assyrischen Raum, andererseits entlang der Süd- und Südwestküste auch der maritime Kontakt zur Ägäis sowie zu jenen griechischen Siedlern, die ab der mykenischen Zeit Handelsniederlassungen oder Kolonien in Küstennähe errichtet hatten. Somit steht die Religionsgeschichte Anatoliens immer im Austausch mit politischen und kulturellen Strömungen in solchen Kontaktzonen.