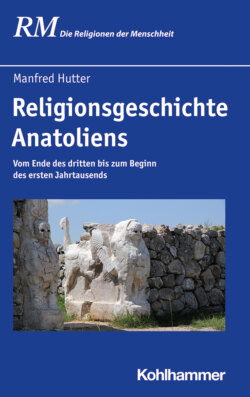Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Bemerkungen zum Forschungsstand
ОглавлениеBereits im Jahr 1922 hat der Leipziger Altorientalist Heinrich Zimmern Übersetzungen hethitischer Texte für die zweite Auflage des »Textbuches zur Religionsgeschichte« (Leipzig) beigetragen, wozu Edvard Lehmann und Hans Haas, die beiden Herausgeber des Textbuches, im Vorwort Folgendes vermerkten:28
Nicht mehr voll befriedigen könnte ein Buch wie dieses, wenn in ihm auch heute noch gar nichts zu lesen stünde von der erst neuerdings zutage gekommenen, eben zur Stunde wissenschaftlich lebhaftest diskutierten Kultur, die, ihre Wurzeln in Kleinasien habend, neben den beiden von länger her bekannten Macht- und Kulturzentren der altorientalischen Welt, dem ägyptischen und dem babylonisch-assyrischen, als dritte steht, von der Kultur der Hittiter. Die Erschließung der Boghazköi-Funde, denen verwandte Ausgrabungen in Syrien zur Seite treten, steht noch in ihren ersten Anfängen.
Diese Einbeziehung hethitischer Texte, die im Handbuch zehn Seiten füllen, ist insofern forschungsgeschichtlich hervorzuheben, als Texte in nennenswerter Zahl erst seit 1906 durch Ausgrabungen in Boğazkale gefunden wurden und Bedřich Hrozný eine von der damaligen Fachwelt schnell akzeptierte Erschließung der Sprache als »hethitisch« 1915 vorgelegt hatte. Neben seinen ersten Übersetzungen hat Zimmern drei Jahre später für den ebenfalls von Hans Haas herausgegebenen mehrteiligen »Bilderatlas zur Religionsgeschichte« einen Faszikel »Religion der Hethiter« geliefert. Dem zeitgenössischen Kenntnisstand folgend, problematisiert bzw. differenziert Zimmern zutreffend, dass die Texte des 2. Jahrtausends und die Bildwerke, die – abgesehen von den Reliefs aus Yazılıkaya der hethitischen Großreichszeit – aus verschiedenen »neo-hethitischen« Staaten der ersten Jahrhunderte nach dem Untergang des hethitischen Großreiches stammen, nicht unkritisch aufeinander bezogen werden dürfen; daher formuliert er einschränkend für seine Arbeit Folgendes:29
Wie weit hierbei also dieses religiöse hethitische Bildermaterial als Illustration jenes religiösen hethitischen Textmaterials gelten darf, bleibt … einstweilen noch unentschieden.
Dieser frühe Forschungsstand zeigt dabei einige Aspekte der Beschäftigung mit der Religionsgeschichte Kleinasiens, die bis zur Gegenwart oft prägend geblieben sind und wovon sich auch die vorliegende Darstellung nicht vollkommen lösen kann, jedoch in der Gewichtung einen neuen Akzent liefern möchte. H. Zimmern stellte ausschließlich die Hethiter in den Mittelpunkt seiner Darstellung, erkannte jedoch die Notwendigkeit, auch die heute aufgrund der damit verbundenen Inschriften als hieroglyphen-luwisch bezeichneten Denkmäler einzubeziehen. Dadurch hat Zimmern zu Recht angedeutet, dass die Religionsgeschichte Kleinasiens in ihrer Kontinuität (und in Veränderungen) berücksichtigt werden muss, auch wenn die Quellensituation zu den religiösen Vorstellungen der Zeit der Hethiter alle anderen Perioden quantitativ bei Weitem übertrifft. Allerdings sollte man die »hethitische Religion« in die größere Geschichte einbetten – beginnend mit jenen Vorstellungen der Bronzezeit, die in Zentralanatolien vor der hethitischen Staatsgründung durch archäologische Befunde sowie durch die Texte der altassyrischen Handelsniederlassungen rekonstruierbar sind. Genauso sollte aber auch die Religionsgeschichte Kleinasiens nach dem Untergang des hethitischen Reiches weiter beachtet werden – vor allem anhand der hieroglyphen-luwischen Quellen für den Süden und Südosten Kleinasiens bis nach Nordsyrien; diese zeigen den Anspruch lokaler Herrscher, nicht nur kulturell, sondern vor allem politisch die Nachfolge des Hethiterreiches anzutreten. Wenigstens hinzuweisen ist auch auf jene Traditionen, die im Süden und Westen des Landes durch Lyker, Lyder und Karer sowie in Zentralanatolien durch die Phryger fassbar werden. Das genaue Verhältnis dieser im 1. Jahrtausend fassbaren Traditionen zu den verschiedenen Überlieferungen in den Keilschrifttexten des 2. Jahrtausends ist jedoch schwierig zu bestimmen, da teilweise eine Überlieferungslücke von mehr als einem halben Jahrtausend existiert.
Dieses Szenario religionsgeschichtlicher Kontinuität und Veränderung bzw. Neuerung durch Importe bis in die ersten Jahrhunderte des 1. Jahrtausends entsprechend dem gegenwärtigen Forschungsstand darzustellen, ist das Themenfeld einer Religionsgeschichte Anatoliens. Denn Religionsgeschichte ist kein monolithischer Block, sondern die Kontakte Kleinasiens mit den angrenzenden Gebieten sowie politische Veränderungen innerhalb Kleinasiens bedingten immer eine religiöse Pluralität. Ein (exemplarischer) Blick auf einige einschlägige Monographien, die »Standardwerke« für die gegenwärtige Forschung30 sind, soll im Folgenden zeigen, dass bislang solche Fragestellungen von Kontinuität und Wandel in unterschiedlichem Umfang behandelt wurden.
Die erste monographische Darstellung, die in vielen Abschnitten noch für den aktuellen Kenntnisstand brauchbar ist, stammt von Oliver R. Gurney. Die auf drei Vorträgen beruhenden »Some Aspects of Hittite Religion« aus dem Jahr 1977 behandeln in drei Kapiteln das Pantheon, den Kult und magische Praktiken. Diese Einschränkung oder Schwerpunktsetzung des Materials begründet Gurney zutreffend damit, dass gerade bei diesen Themen – gegenüber der älteren Forschung – neue oder bisher wenig bekannt und rezipierte Erkenntnisse gewonnen werden konnten.31 Zu Recht hebt Gurney hervor, dass bei der Darstellung hethitischer Religion zwischen den lokalen Kulten mit je eigenen Traditionen und der »Staatsreligion« mit dem König als oberstem Priester für den Staat zu unterscheiden ist. Relativ klar betont er bereits die Unterschiede zwischen der Götterwelt der althethitischen Zeit und den Veränderungen, die mit dem hurritischen Einfluss im 15. Jahrhundert einsetzten. Innerhalb der Darstellungen zum »Kult« beschreibt Gurney u. a. Aktivitäten und Opfer an lokalen Schreinen und Stelen(heiligtümern), wobei er letztere mit den Masseben der Religionsgeschichte Israels vergleicht.32 Ferner behandelt er lokale Feste im Frühjahr und Herbst und unterscheidet diese von den großen Staatsfesten, dem AN.TAḪ.ŠUM-, dem KI.LAM-, dem nuntarriyašḫa- und dem purulli-Fest. Das Verhältnis dieser Feste zueinander und ihre jeweils höchst komplexe Entwicklungsgeschichte lässt sich inzwischen besser rekonstruieren, als es zur Zeit Gurneys möglich war. Hinsichtlich der »magischen Rituale« hebt er deren individuelle Verortung für konkrete Anlässe hervor, wobei er auch auf die regionale Differenzierung der Ritualspezialist(inn)en hinweist. In drei hervorgehobenen Unterabschnitten kommt er auf die Sündenbockrituale – auch im Vergleich zu Praktiken der Religionsgeschichte Israels33 – zu sprechen, zu Ersatz(königs)ritualen und zum Totenritual für verstorbene Herrscher. Letzteres wäre m. E. günstiger im Zusammenhang mit dem »Staatskult« zu behandeln gewesen. Rekapituliert man diese Darstellung, so ist diese Arbeit – auch mehr als vier Jahrzehnte nach ihrer Entstehung – als erste Annäherung an Aspekte der hethitischen Religion ertragbringend zu lesen.
Ein Nachschlagewerk ist die 1994 erschienene »Geschichte der hethitischen Religion« von Volkert Haas. In dem mehr als 1.000 Seiten umfassenden Buch geht es dem Verfasser um eine möglichst systematische Anordnung des Quellenmaterials, ohne dieses in bestehende religionswissenschaftliche Theorien einzuordnen oder dementsprechend zu bewerten.34 Zu Recht hebt er die reichhaltig überlieferten hethitischen Ritualtexte hervor, in denen eine Fülle von Details über Feste, Mythen, Gebete, Beschwörungen, Orakelanfragen oder kultische Handlungen bewahrt geblieben sind.35 In dieser Materialdarbietung liegt die Stärke des Buches, weil dadurch auch dem hethitologisch-philologisch nicht vorgebildeten Leser ein Zugang zu den Quellen erschlossen wird. Charakteristisch für das Buch ist ferner, dass Haas immer wieder ausführlich auf die mesopotamischen und syrischen Vorstellungen eingeht, um dadurch schlechter bezeugte kleinasiatische Vorstellungen zu erhellen oder durch den Vergleich für die Deutung dieser Vorstellungen etwas zu gewinnen. Dabei erliegt er jedoch methodisch manchmal der Versuchung, etwas, was für Kleinasien nicht direkt bezeugt ist, dennoch für die religiöse Vorstellungswelt dort zu postulieren, weil es in Mesopotamien oder Syrien bezeugt ist. Die Vorzüge des Buches bergen aber zugleich in gewisser Weise auch Schwächen: Die fehlende Auseinandersetzung mit religionswissenschaftlicher Theorie lässt den Leser manchmal allein mit der Frage, warum die Hethiter diesen oder jenen Kult ausgeübt haben, auch wenn der Leser detailliert erfährt, wie der Ritualablauf war. Genauso bekommt ein – nicht speziell fachlich ausgebildeter – Leser manchmal den Eindruck, dass das beschriebene Material »flächendeckender« (sowohl in zeitlicher als auch in regionaler Hinsicht) wäre, als es de facto der Fall war. Trotz solcher Einschränkungen ist das Buch eine Fundgrube für relevantes Material zur Religionswelt Anatoliens, wobei – der Gesamtanlage des Buches entsprechend – mit dem politischen Ende des Hethiterreiches auch die Beschreibung der religiösen Vorstellungen endet.
Im folgenden Jahr ist das Buch »Religions of Asia Minor« von Maciej Popko erschienen. Auf etwa 150 Seiten behandelt Popko denselben Stoff – allerdings verständlicherweise ohne jedweden Anspruch auf Vollständigkeit – wie Haas. Ein grundlegender Unterschied gegenüber dem Buch von Haas ist jedoch, dass Popko auch die religiösen Traditionen des 1. Jahrtausends (Luwier, Lyker, Karer, Lyder, Phryger) kurz beschreibt. Der Aufbau der Arbeit von Popko ist dabei stärker chronologisch orientiert und kann insofern mit größerem Recht als »Geschichte« dieser Religionen bezeichnet werden, als dies manchmal bei Haas der Fall ist. In vier chronologischen Abschnitten werden die religiösen Vorstellungen der Zeit der assyrischen Handelskolonien in Kleinasien, die althethitische und mittelhethitische Epoche sowie die Großreichszeit behandelt; dass dabei letztere am umfangreichsten behandelt wird, liegt an der reichhaltigeren Quellensituation. Besonders hervorzuheben sind folgende Unterabschnitte, die den religiösen Pluralismus in Kleinasien deutlich zu machen vermögen. Wichtig sind innerhalb der mittelhethitischen Periode die Abschnitte »Changes in Hittite Religion« sowie »Beliefs of the Luwians« und »Beliefs of the Hurrians in Anatolia«36 oder auch die Überlegungen zu »Syncretism« in der Großreichszeit.37 Damit ist Popkos Zugang deutlich systematischer ausgerichtet und trägt der Vielfalt religiöser Konzepte in Kleinasien besser Rechnung als das umfangreiche Werk von Haas.
Wenig rezipiert ist die georgische Monographie zur hethitischen Religion von Irene Tatišvili, obwohl das Buch auch eine umfangreiche deutsche Zusammenfassung enthält.38 Die Verfasserin legt in ihrer Rekonstruktion der hethitischen Religion ein besonderes Augenmerk auf die »Reform des Anitta, da Anitta die hattischen Götter als religiöse und politische Konzepte übernommen und die ›hethitisch‹ genannte Religion formiert« hat.39 Daher werden in der Arbeit im Folgenden auch die hattischen Götter ausführlich behandelt. Genauso wird gezeigt, dass das Pantheon der Großreichszeit durch die Übernahme fremder Traditionen gestaltet wurde, so dass das Fremde zum Eigenen der Hethiter geworden ist. Als Ergebnis der Pantheonsbildung betont Tatišvili, dass die Uneinheitlichkeit des Pantheons nicht einer religiösen Toleranz oder einem geringen Ausmaß von Zentralisierung des Hethiterreiches zuzuschreiben sei, sondern dass eine bewusst offene Struktur des Pantheons ohne einen strengen Rahmen von den Priestern geschaffen worden sei, um für neue Götter immer Platz zu haben.40 Damit liefert das Buch bedenkenswerte Überlegungen, die das – priesterliche – Denken über die Götterwelt erschließen; allerdings bleiben Aspekte religiöser Praxis in der Studie ausgespart.
Piotr Taracha hat im Jahr 2009 ebenfalls eine Gesamtdarstellung der Religionen Anatoliens im 2. Jahrtausend vorgelegt. Darin stellt er zunächst die religiös deutbaren Überlieferungen des vorgeschichtlichen Anatoliens und der altassyrischen Handelsniederlassungen dar, da diese Vorstellungen teilweise als Basis der Religionswelt der hethitischen Zeit dienen. Da der politische Einschnitt zwischen der althethitischen Zeit und der Epoche des Großreiches auch einen religionsgeschichtlichen Wandel bewirkt, behandelt Taracha die religiösen Vorstellungen beider Zeitabschnitte getrennt voneinander.41 In der althethitischen Zeit (16. bis 15. Jahrhundert) spielte dabei das hattische Kultmilieu noch eine wichtige Rolle. Für die Religion der Großreichszeit (14. bis 13. Jahrhundert) lässt sich feststellen, dass neben dem Staatskult am Königshof auch jene religiösen Vorstellungen favorisiert wurden, die sich mit den Beziehungen der königlichen Dynastie der Großreichszeit zum hurritisch-kizzuwatnäischen Bereich verbinden lassen. Auch wenn klarerweise zwischen der herrschenden Dynastie und dem Staat untrennbare Beziehungen bestanden, sind die religiösen Konzepte des Königshauses und des Staatskultes nicht vollkommen deckungsgleich.42 Solche »Binnendifferenzierungen«, die nicht nur die Götterwelt, sondern auch kultische Handlungen, Gebete, Vorzeichendeutung sowie Bestattungspraktiken und Ahnenkult in der kleinasiatischen Religionsgeschichte betreffen, sind beachtenswert.
In deutlich kompakterer Form als im Jahr 1994 hat Volkert Haas die Grundzüge der hethitischen Religion im Jahr 2011 nochmals in einer deskriptiv und phänomenologisch ausgerichteten Überblicksdarstellung behandelt, wodurch der Aufbau der Arbeit thematisch ausgerichtet ist – im Unterschied zur Orientierung an historischen Entwicklungen durch Popko und Taracha. Weltvorstellungen und Überlegungen zum Wesen der Götter und zu den umfangreichen Reinheits- und Unreinheitsvorstellungen sowie zu Schicksal, Menschenbild und Jenseits geben einen Einblick in das religiöse Denken der »Hethiter«, das sich auch in den unterschiedlichen menschlichen Kommunikationsformen mit den Göttern in Gebeten, Gelübden, Orakelpraktiken sowie Verfluchungen oder Segnungen feststellen lässt. Am Ende seiner Studie geht Haas kurz auf das Nachleben der hethitischen Religion in Kleinasien sowie auf einige Themen ein, die in der griechischen Mythologie auftauchen und aus Anatolien stammen.43 Damit berücksichtigt er zu Recht, dass der politische Untergang des hethitischen Großreiches nicht das Verschwinden religiöser Überlieferungen bedeutet. Charakteristisch für die Darstellung der Religion durch Haas ist die Hypothese, dass unser Quellenmaterial sich nur auf den Staatskult bezieht, was hinterfragt werden kann. Denn die – wenngleich zum überwiegenden Teil aus der hethitischen Hauptstadt stammenden – Texte erlauben doch eine größere soziale und ethnische Binnendifferenzierung, als dies in der manchmal zu harmonisierenden Darstellung von Haas der Fall ist. Beide zuletzt genannten Überblickswerke zu »hethitischen« oder – zutreffender im Sinn von P. Taracha – »anatolischen« Religionen können daher kritisch-komplementär verwendet werden.
Die eben genannten Gesamtdarstellungen beschränken sich – mit Ausnahme von M. Popko – auf die »hethitische« Religion« im 2. Jahrtausend. Eine Sonderstellung nimmt die Monographie von Ian Rutherford ein, der fast alle in hethitischen Texten angesprochenen Themen aufgreift, um danach zu fragen, wo diese Traditionen Spuren auch in der griechischen Religion hinterlassen haben. Dabei liegt das Ziel44 seiner Darstellung primär darin, Gräzisten mit der umfangreichen hethitischen religiösen Überlieferung vertraut zu machen, da es ab dem 14. Jahrhundert Kontakte zwischen dem griechisch-ägäischen Raum und Anatolien gegeben hat, so dass mit der Möglichkeit von wechselseitigem Austausch auf religiösem Gebiet zu rechnen ist. Am ertragreichsten hinsichtlich der Frage der Rezeption anatolischer Traditionen in griechischer Überlieferung sind Rutherfords Ausführungen über Rituale aus Arzawa, die Überlieferungen über die Abfolge der Göttergenerationen sowie die Rolle Phrygiens für die Entwicklung der Göttin Kybele.45 Hervorzuheben ist jedoch, dass zwischen hethitischen und griechischen Götternamen kaum Gemeinsamkeiten vorhanden, die auf einen »Import« von Anatolien nach Griechenland schließen ließen.46 Insgesamt zeigt diese anregende religionsvergleichende Studie aber auch, dass anscheinend nur sehr wenige überzeugende Spuren hethitischer Vorstellungen47 in der griechischen Religionsgeschichte nachweisbar sind.
Neben diesen monographischen Untersuchungen zu hethitischer Religion sind noch folgende (kürzere) Gesamtdarstellungen zu anderen religiösen Traditionen in Anatolien im 2. und 1. Jahrtausend zu nennen sind.48 Jörg Klinger hat eine Analyse der hattischen Kultschicht, die in althethitischer Zeit Zentralanatolien wesentlich geprägt hat, vorgenommen. Marie-Claude Trémouilles Darstellung der Religion der Hurriter zeigt, wie seit der Mitte des 2. Jahrtausends der Staatskult und die religiösen Vorstellungen der großreichszeitlichen Herrscher durch die hurritischen Konzepte angereichert wurden. Manfred Hutter hat eine systematische Darstellung der »luwischen« Religion vorgelegt, in der er sowohl die keilschrift-luwischen als auch die hieroglyphen-luwischen Quellen berücksichtigt hat, wodurch der chronologische Rahmen das 2. und 1. Jahrtausend umfasst. Einen allgemeinen Überblick zur Religion bei den Lykern bietet Trevor Bryce, und über die Götter, den Kult und die Begräbnispraktiken der Lyder informieren Annick Payne und Jorit Wintjes. Den Versuch, die phrygische Religion für die Zeit der altphrygischen Inschriften vor allem unter dem Aspekt des Weiterwirkens autochthoner anatolischer Vorstellungen zu beschreiben, hat Manfred Hutter unternommen, während Susanne Berndt-Ersöz ausgehend vom archäologischen Befund phrygische Kultpraktiken und die damit möglicherweise verbundenen Götter untersucht hat. Dabei ist für die Religionen des 1. Jahrtausends leider einschränkend festzustellen, dass die teilweise stereotype Formulierung der Inschriften bzw. die keineswegs alle Bereiche von Religion abdeckende inhaltliche Thematik dieser Quellen die Rekonstruktion religiöser Vorstellungen des 1. Jahrtausends ungleich stärker erschwert, als dies im 2. Jahrtausend der Fall ist.
Der geraffte Forschungsüberblick hat somit nicht nur einige relevante Literatur kurz vorgestellt, sondern auch unterschiedliche Betrachtungsebenen angedeutet. Da es sich dabei um historische Religionen handelt, die nie eine normative Dogmatik besessen haben, stellt sich die Frage, in welcher Weise das relevante Material in bester Weise vermittelt werden kann, um wenigstens ansatzhaft zu vermitteln zu versuchen, was »Religion« in Anatolien war.