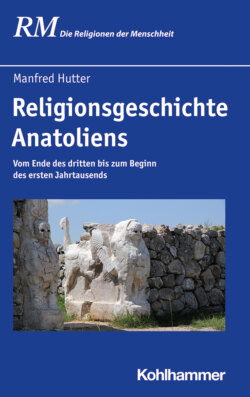Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inhalt
ОглавлениеA Einleitung und Forschungsstand
1 Quellenvielfalt und Varietät
2 Bemerkungen zum Forschungsstand
3 Was ist »Religion« in Anatolien?
4 Methodische Folgen für die Beschreibung von Religionen in Anatolien
B Frühe religiöse Vorstellungen Anatoliens am Beispiel der Gräber von Alaca Höyük und der Briefe aus den altassyrischen Handelskolonien in Zentralanatolien
1 Bestattung und Gesellschaft in Alaca Höyük
2 Die politische und geographische Situation im zentralanatolischen Raum zur Zeit der altassyrischen Handelskolonien vom 20. bis zum 18. Jahrhundert
3 Religiöse Vorstellungen vor der Entstehung des hethitischen Staates
3.1 Die Götterwelt
3.2 Das Verhältnis der Gottheiten der kārum-zeitlichen Texte zur Götterwelt der hethitischen Zeit und des luwischen Gebietes
3.3 Beobachtungen zur religiösen Praxis als Strukturfaktor der Gesellschaft
3.3.1 Tempel und öffentlicher Kult
3.3.2 Religion im häuslich-familiären Kontext
C Religion in der althethitischen Zeit
1 Eckpunkte der geschichtlichen Situation der althethitischen Zeit
2 Das dominierende hattische Milieu der Religion in der althethitischen Zeit
2.1 Die Götterwelt als Widerspiegelung gesellschaftlicher Prozesse
2.1.1 Zum althethitischen »Staatspantheon«
2.1.2 Einige hattische Gottheiten
2.2 Die alten hattischen Kultstädte und die Hauptstadt Ḫattuša
2.2.1 Nerik
2.2.2 Arinna
2.2.3 Ziplanta
2.2.4 Ḫattuša
2.3 Plätze der Kultausübung
2.3.1 Aussehen und Ausstattung der Tempel
2.3.2 Lokale Tempel bzw. kleinere Schreine
2.3.3 Stelen und »naturbezogene« Kultplätze
2.4 Akteure und Akteurinnen im Kult
2.5 Opfer als Praxis der Verehrung und Versorgung der Gottheiten
2.5.1 Zweck und Notwendigkeit der Opfer
2.5.2 Visuelle Repräsentation von Kulthandlungen
2.6 Feste auf staatlicher und lokaler Ebene
2.6.1 Feste des althethitischen »Staatskults«
2.6.2 Lokale Feste
2.7 Exkurs: Religiöse Traditionen im palaischen Milieu
3 Religion als Faktor im Zusammenleben im Alltag
3.1 Ethisches Verhalten und Werte
3.2 Krisenbewältigung und soziales Gleichgewicht
3.3 Kommunikation mit den Gottheiten
D Religiöser Wandel und Neuerungen zwischen der althethitischen Zeit und dem hethitischen Großreich
1 Wichtige geschichtliche Veränderungen bis zum Beginn der Großreichszeit
2 Die Pluralisierung der religiösen Traditionen
2.1 Der Aufstieg des Sonnengottes
2.2 Neue Residenzstädte mit kultischer Relevanz
2.2.1 Šamuḫa
2.2.2 Šapinuwa
2.2.3 Šarišša
2.2.4 Zusammenfassung
2.3 Ein Überblick zu luwischen religiösen Vorstellungen
2.3.1 Die Eigenständigkeit der luwischen Götterwelt
2.3.2 Lokale Kulte im luwischen Raum und ihr Verhältnis zum hethitischen Staatskult
2.3.3 Zu einigen Kultakteuren und Kultakteurinnen
2.3.4 Reinheit und Rituale zur (individuellen) Krisenbewältigung
2.4 Ein Überblick zu hurritischen religiösen Vorstellungen
2.4.1 Die hurritische Götterwelt
2.4.2 Lokale Kulte im hurritischen Raum und ihr Verhältnis zum hethitischen Staatskult
2.4.3 Zu einigen Kultakteuren und Kultakteurinnen
2.4.4 Reinheit und Rituale zur (individuellen) Krisenbewältigung
3 Ein kurzes Zwischenresümee
E Religion in der Großreichszeit
1 Eckpunkte der geschichtlichen Entwicklung
2 Vielfalt, Synkretismus und Abgrenzungsprozesse der Religion in der Großreichszeit
2.1 Die Götterwelt als Widerspiegelung gesellschaftlicher Prozesse
2.1.1 Staatspantheon
2.1.2 Die Gottheiten des Königtums und das »dynastische Pantheon«
2.1.3 Lokale Panthea
2.1.4 Familien- und Vatersgottheiten, Ahnen und der »vergöttlichte« König
2.2 Die ideologische Bedeutung und Gestaltung des Raumes
2.2.1 Kosmologische Konzepte
2.2.2 Ḫattuša
2.2.3 Tarḫuntašša
2.2.4 Nerik
2.2.5 Karkamiš
2.3 Plätze der Kultausübung
2.3.1 Tempelsymbolik und sakraler Raum
2.3.2 Einzelne Bauten in Verbindung mit dem Totenkult und chthonischen Gottheiten
2.3.3 Berg- und Quellheiligtümer
2.4 Akteure und Akteurinnen im Kult
2.5 Opfer als Praxis der Verehrung und Versorgung der Gottheiten
2.6 Feste auf staatlicher und lokaler Ebene
2.6.1 Die zeitliche Einordnung der Feste
2.6.2 Religiöse Feste und die allgemeine Bevölkerung
2.6.3 Feste und (Religions-)Politik
2.7 Exkurs: Hethitische Religion im »Ausland« – Die so genannten anatolischen Rituale in Emar
3 Religion als Faktor im Zusammenleben im Alltag
3.1 Ethische Werte und Verhaltensweisen
3.2 Krisenbewältigung und soziales Gleichgewicht
3.2.1 Die Sicherheit des Königs in Krisensituationen
3.2.2 Rituelle Konfliktbewältigung im Alltag
3.3 Kommunikation mit den Gottheiten
3.3.1 Gelübde
3.3.2 Persönliche Gebete des Königs und der Königin
3.4 Religion im Lebenslauf – eine idealtypische Rekonstruktion
F Zum Weiterwirken religiöser Traditionen in der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends
1 Tabal und das ehemalige »Untere Land«: Luwisches Kerngebiet im Kontakt mit zentralanatolischen und südwestanatolischen Nachbarn
1.1 Die Eigenständigkeit der Götterwelt
1.2 Plätze der Kultausübung
1.3 Kultaktivitäten
1.4 Religion als Faktor in der Gesellschaft
2 Karkamiš und seine politischen Nachbarn: Kontinuität, Wandel und Wechselwirkung mit dem nordsyrischen Raum
2.1 Die Eigenständigkeit der Götterwelt
2.2 Plätze der Kultausübung
2.3 Kultaktivitäten
2.4 Religion als Faktor in der Gesellschaft
3 Zentral- und (Süd-)Westanatolien
4 Fazit
G Anhang
1 Liste hethitischer Könige
2 Karten
2.1 Altassyrische Handelskolonien und das althethitische Reich
2.2 Das hethitische Großreich
2.3 Das 1. Jahrtausend
3 Literaturverzeichnis
4 Register
4.1 Keilschrifttexte
4.2 Hieroglyphen-luwische Texte
4.3 Wörterverzeichnis (hattisch, hethitisch, hurritisch, luwisch)
4.4 Orte
4.5 Gottheiten
4.6 Personen
4.7 Stichworte