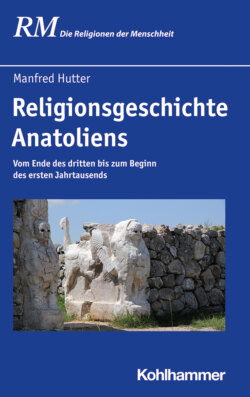Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Was ist »Religion« in Anatolien?
ОглавлениеMehrfach finden sich zu Beginn von Briefen Grußformeln, mit denen der Schreiber dem Briefempfänger göttlichen Schutz wünscht und dadurch diese Kommunikation in eine religiöse Sphäre einbettet. So lesen wir beispielsweise in einem mittelhethitischen Brief aus Maşat Höyük:49
Sprich zu Ḫimmuili, meinem lieben Bruder: Alles möge bei dir in Ordnung sein. Die Götter mögen dich am Leben erhalten und dich liebevoll beschützen!
Rund sieben Jahrhunderte jünger ist eine hieroglyphen-luwische Inschrift, die der Lokalherrscher von Tabal, Wasusarme (reg. 730–728), auf einem Felsen anbringen ließ, um seine Taten zu verherrlichen; die Inschrift endet mit folgender Drohung:50
Wer(immer) [diese Inschrift] zerstört – wenn er ein König ist, so sollen der Wettergott, Šarruma und … ihn und sein Land vernichten. Wenn er ein gewöhnlicher Mann ist, so sollen der Wettergott, Šarruma und … ihn und sein Haus vernichten.
Man kann diese potenzielle Bestrafung als negative Kommunikation werten, die aber – wie die Grußformel – die göttliche Sphäre in das alltägliche Leben einbezieht.
Beide Textzitate zeigen, dass »Religion« offensichtlich im 2. und im 1. Jahrtausend ein Faktor war, der – wohl in unterschiedlicher Akzentsetzung – im Leben der verschiedenen sozialen Schichten fassbar ist. Allerdings muss einschränkend gleich gesagt werden, dass dies zunächst nicht mehr als eine allgemeine Aussage ist, die man für jede – historische wie gegenwärtige – Kultur machen könnte. Was uns aus der schriftlichen Überlieferung Anatoliens fehlt, sind Traktate de religione, d. h. es gibt keine theologisch-systematischen Darstellungen, wie die Menschen im 2. und 1. Jahrtausend über Religion gedacht haben, sondern es kann nur aus Texten, die wir als Teil von »Religion« interpretieren, eine Rekonstruktion dessen versucht werden, was »Religion« im alten Kleinasien war oder welche Rolle sie für die Gesellschaft spielte bzw. wie sie als »welt- und sinndeutendes« Symbolsystem gesehen wurde.
Damit deute ich grundsätzliche Möglichkeiten religionswissenschaftlicher Theoriebildung über »Religion« an.51 Wenn für den vorliegenden Zweck eine Verallgemeinerung erlaubt ist, so kann man so genannte substanzialistische, funktionalistische und Symbol-Theorien als Definition von Religion unterscheiden. Substanzialistische Theorien dienen dabei zur Bestimmung, was das »Wesen« der Religion sei, um diese von nicht-religiösen Bereichen zu unterscheiden. Dabei spielt(e) häufig der Glaube an eine übernatürliche Macht oder das »Heilige« eine zentrale Rolle, um aus diesem Glauben an das Heilige bzw. aus dem Erleben des Heiligen als »gläubiger« Mensch sein Leben in Reaktion auf dieses Heilige auszurichten, wozu auch die Kommunikation mit dem Heiligen durch kultische Aktionen gehört. Als Gegenmodell – und Kritik an substanzialistischen Theorien – kann man funktionalistische Definitionen nennen, die Religion dahingehend bestimmten, welche Aufgaben sie für die Gesellschaft – als Kollektiv, aber auch für die einzelnen Individuen in einer Gesellschaft – zu leisten vermag. D. h. ein solches Definitionsmodell orientiert sich nicht an Inhalten von Religion (»Glaube«, »Heiliges«), sondern an der Funktion, die die Religion für die Menschen – in jeweils konkreten historischen Kontexten – erfüllt. Stellt man diese beiden Definitionsmodelle einander gegenüber, so tendieren Vertreter solcher Modelle dazu, Religion entweder in substanzialistischer Weise als eigenständige Größe neben bzw. tendenziell über der Kultur anzusiedeln und dadurch Teilbereiche der Kultur in Abhängigkeit von der Religion zu interpretieren, während demgegenüber Religion in funktionalistischer Interpretation als ein Subsystem von Kultur – gleichwertig anderen Subsystemen (z. B. Wirtschaft, Wissen, Gesundheit) – innerhalb der Gesellschaft betrachtet wird.
Die Gegenüberstellung von substanzialistischer und funktionalistischer Betrachtung von Religion zeigt zugleich, dass weder die eine noch die andere Definition in exklusiver Weise zielführend ist, so dass – funktionalistische Ansätze weiterführend – Religion als mehrdimensionales System gesehen werden sollte, indem nicht nur nach dem »Wesen« oder der (gesellschaftlichen) Funktion der Religion gefragt werden darf. Wenn man Religion als ein Symbolsystem definiert, so muss man unterschiedliche Aspekte oder Dimensionen beachten. Dazu gehören die rituelle Seite, die individuellen Erfahrungen, die im Wissenstransfer vermittelten ideologischen oder mythologischen Inhalte, ethische und (ver)rechtlich(t)e Aspekte sowie die gemeinschaftliche bzw. organisierte oder institutionalisierte Form von Religion. Streng genommen kann man sagen, dass die Beachtung solcher Aspekte von Religion eher eine Beschreibung und nicht eine strenge Definition von Religion darstellt.
Bei einer Beschreibung von historischen Religionen können dabei – aufgrund der zur Verfügung stehenden Quellen – nicht alle diese Aspekte in gleicher Weise beachtet bzw. erschlossen werden, allerdings erlauben sie m. E. einigermaßen, Vorstellungen über »Religion« in Anatolien zu sammeln, zu rekonstruieren und teilweise zu systematisieren. Diese Annäherung an die »Erfassbarkeit« von Religion könnte man daher in etwas abstrakterer Form in folgender dreiteiliger Form umschreiben:52
Religion ist demnach ein System, das ausgehend von einer identitätsbegründenden Komponente (beispielsweise ein [fiktiver] Stifter, ein Ur-Ahne, eine »Ur-Schrift«) durch gemeinsame Anschauungen und Weltdeutungen (d. h. »Lehre und Praxis«) eine Gemeinschaft (in durchaus unterschiedlich dichter Organisationsstruktur) konstituiert.
Verträgt sich eine solche Beschreibung von Religion mit der Religionsgeschichte Anatoliens? Blicken wir nochmals auf die beiden oben zitierten Aussagen: Die Erwartung des Segens bzw. der Strafe der Götter zeigt Anschauungen und Aspekte der Weltdeutung, zugleich lässt sie die »Konkretisierung« und Auswirkung von »Religion« sehen, wenn die Götter den Briefempfänger »am Leben erhalten und beschützen« sollen. Aber auch Fehlverhalten – entsprechend der aus der Religion entsprungenen oder durch die Religion begründeten Lebenspraxis – wird angesprochen und durch eine Fluchformel sanktioniert. Diese gemeinsamen Anschauungen und Werthaltungen, die die Lebenspraxis bestimmen, verbinden dabei »Religion« mit dem »außermenschlichen« Bereich und der Götterwelt, wobei das Verhalten der Götter auch menschliche Verhaltensweisen legitimiert. Daher greifen die Götter – mit Segen und langem Leben oder mit der in der Fluchformel angedrohten Bestrafung – in diese Lebenspraxis ein. Insofern ist der zweite Teil der eben zitierten Definition gut feststellbar. Auf den gemeinschaftlichen Aspekt als dritten Teil der Definition weist in der Inschrift des Wasusarme die Nennung eines »Königs« oder eines »gewöhnlichen Mannes« hin. Dass die identitätsbegründende Komponente aus der Definition in diesen kurzen Zitaten nicht ausgedrückt wird, ist kein völliger Zufall. Denn die Religionen Anatoliens sind keine »gestifteten« oder »geoffenbarten« Religionen, wodurch ideale Identitätsmarker für Religionen gegeben wären. Identitätsstiftung – als Begründung unterschiedlicher religiöser Vorstellungen, ohne dadurch unüberwindbare Abgrenzungen zwischen der einen und der anderen Religion zu schaffen – geschieht tendenziell durch die Herkunft,53 durch gemeinsame Interessen (z. B. dynastische Legitimation), eventuell durch gemeinsame Gottheiten (z. B. einen Wettergott als Bezugspunkt im klimatischen Kontext des Regenfeldbaus). Somit lässt sich auch der erste Aspekt der obigen Definition von »Religion(en)« finden, er ist aber gegenüber den Quellen, die Aufschluss über Anschauungen in »Lehre und Praxis« geben, weniger gut rekonstruierbar.
Trotz des Risikos einer zu schnellen Verallgemeinerung möchte ich behaupten, dass in historischen Religionen (mit nur beschränktem Quellenmaterial) die Beschreibung und Rekonstruktion von Religionen am besten für den zweiten Teil der von mir zugrunde gelegten Definition von Religion gelingt. Dies fügt sich gut zu Ciceros Beschreibung von »Religion«, der das Wort religio vom Verbum relegere »sorgsam beachten« herleitet und durch die Gegenüberstellung zum negativ konnotierten Verbum neglegere »vernachlässigen« eine Deutung vorlegt, nach der »Religion die Pflege/Verehrung der Götter ist« (religio id est cultus deorum).54 Diese auf der Ebene der »religiösen Handlung« verankerte Charakterisierung – und letztlich Funktion – von Religion ist keineswegs auf den römischen Raum beschränkt, sondern trifft auch auf die altkleinasiatische Religionswelt zu.
Einen »Oberbegriff« für Religion (annäherungsweise zur Bedeutungsbreite des deutschen Wortes) gibt es in den anatolischen Sprachen des 2. und 1. Jahrtausends v.u.Z. nicht, allerdings meine ich,55 dass das Wort šaklai- ein – wenngleich mit Einschränkungen – relativ weiter Ausdruck für das semantische Feld ist, das »Religion« umfasst. Das umfangreiche »Chicago Hittite Dictionary« gibt für das Wort folgende Bedeutungen an:56
1. custom, customary behaviour, rule, law, requirement,
2. rite, ceremony, protocol, use,
3. privilege, right, prerogative,
4. insignia (?), symbol (?).
Am interessantesten ist die Bedeutung »2. rite, ceremony, protocol, use«. Dabei muss man nicht immer an konkrete Rituale für die Götter denken, sondern die Übergänge zwischen »Ritual« und »Brauchtum« oder »göttliche Anforderung/Anforderung der Götter« sind fließend, und nur der Übersetzer muss sich für den einen oder anderen Begriff im Deutschen entscheiden – mit der jeweilig notwendigen Akzentuierung einer bestimmten Seite der Semantik von saklai-.
Als allgemeinen Begriff kann man šaklai- als eine – von Göttern ausgehende – Ordnung (die die Gemeinschaft teilt) und die menschlich dafür angemessene Verhaltensweise verstehen. Wenn man die etymologische Verknüpfung von hethitisch šaklai- mit lateinisch sacer akzeptiert, wird die zentrale religiöse Komponente von šaklai- sogar noch deutlicher:57 sacer drückt nach Emile Benveniste das »implizite Heilige« aus. Diese implizite »Heiligkeit« in šaklai- umfasst dabei jenen Aspekt von Religion, den man mit »Lehrinhalten« verbinden kann bzw. jenen Textstellen, die etwa das »Chicago Hittite Dictionary« unter »1. custom, rule« verbucht, wobei diese »Heiligkeit« klarerweise auch für »2. rite, ceremony« gilt. Das »passende« Verhalten den Göttern gegenüber und das »sorgsame Beachten« der Götter führt zu einer Beziehung zwischen Göttern und Menschen, in der jedoch die Menschen den Göttern untergeordnet sind. Die Durchführung der Rituale – begründet durch Anschauungen über die Götter – durch Vertreter der religiösen Gemeinschaft bzw. der institutionalisierten Religion gestaltet dabei auch maßgeblich die Gesellschaft. Dadurch erhält Religion – in Form von hochrangigen Personen der königlichen Familie in Priesterämtern, durch Tempel als Wirtschaftsunternehmen, als Horte der Wissensbewahrung, Tradierung und »Regulierung« im Überlieferungsprozess von Texten – eine zentrale Funktion zur Strukturierung (d. h. sowohl Stärkung als auch Kontrolle) der Gesellschaft oder einer gesellschaftlichen Gruppe.