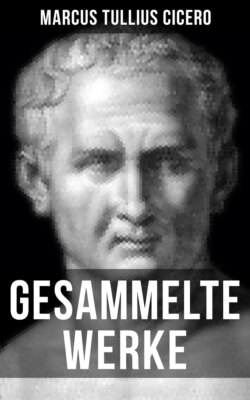Читать книгу Gesammelte Werke von Cicero - Марк Туллий Цицерон - Страница 39
Оглавление1 Ueber den Zustand der Philosophie bei den Römern vor Cicero, über die philosophischen Schulen, die zu Rom blühten, über das Leben Cicero's und über seine philosophischen Schriften habe ich ausführlich in der Schrift gesprochen, die den Titel führt: Marci Tullii Ciceronis in philosophiam ejusque partes merita. Hamburgi, sumptibus Friderici Perthes. 1825. Einen kurzen Auszug aus derselben habe ich in der Einleitung zu meiner Uebersetzung von Cicero's Tusculanen (Stuttgart, Krais und Hoffmann, 1855) gegeben.
2 S. die Einleitung zu meiner Uebersetzung der drei Bücher von dem Wesen der Götter S. 9 f.
3 S. Cicer. de Divinat. II. 1, 3.
4 Vgl. Cicer. Cat. 1, 3. Lael. 1, 4.
5 Ueber das Verhältniß des Scipio zu Cato s. Cicer. de Rep. II, 1, 1.
6 S. Cicer. Legg. II. 2, 5. Ueber Cato's Leben vgl. Corn. Nep. Vit. Catonis und Plutarch. Vit. Catonis.
7 Cicer. Rep. I. 1, 1: M. vero Catoni, homini ignoto et novo. Vgl. Cicer. pro Murena 8.
8 So nach Cicer. Cat. 4, 10. Aber Nep. 1, 2 den Cato unter den Consuln Q. Fabius und Marcus Claudius Kriegstribun in Sicilien sein. Nipperdey z. Nep. l. d. meint, beide Angaben ließen sich vielleicht dadurch vermitteln, daß Marcellus, bevor er nach Sicilien gesandt wurde, einige Zeit gemeinsam mit Fabius in Campanien operirt habe ( Livius 24, 19).
9 Nepos 1, 2.
10 S. Livius 34, 8 sqq. Eine Lobrede auf Cato s. 34, 40 u. 39, 40.
11 S. Cicer. Cat. 6, 18. Plutarch. Cat. 12.
12 Nach Cicer. Cat. 10, 32 und Plutarch. Cat. 12; aber nach Livius 36, 17 als Unterfeldherr ( legatus consularis).
13 Livius 36, 18. Plutarch. Cat. 13. Vgl. Cicer. Cat. 10, 32.
14 Livius 39, 40 sq. Plutarch, Cat. 16–19. Nepos Cat. 2, 3. Vgl. Cicer. Cat. 12, 42.
15 Schön sagt Livius 45, 25: Plurimum causam eorum (Rhodiorum) adjuvit M. Porcius Cato, qui, asper ingenio, tum lenem mitemque senatorem egit.
16 Plutarch. Cato 26 sq.
17 Cicer. Brut. 20, 80. 23, 90. de Orat. I. 53, 227.
18 S. Nepos Cato c. 3. Cicer. Brut. c 17. Fragmenta Catonis ex. rec. Aus. Popmae. c. ann. ejus et Jo. Meursii, Franeckerae 1620. p. 129.
19 S. unsere Anmerk. zu Lael. 3, 10.
20 S. unsere Anmerk. zu Lael. 3, 12.
21 Cicer. de Orat II, 37, 155.
22 Vellej. Pat. 1, 13.
23 Cicer. Acad. II. 2, 5. de Fin. IV. 9, 23. Tuscul. IV, 3, 5.
24 Cicer. Tusc. II. 26, 62. ad Quint. Fr. I, 8, 23.
25 Cicer. Brut. 21, 82 sqq. Vgl. 74, 258, de Offic. I. 32, 116.
26 S. unsere Schrift: Cicer. in philos. mer. p. 116 sqq.
27 IV. 10) entlehnt und an Titus Quinctius Flamininus gerichtet, hier aber auf Titus Pomponius Atticus angewendet. Als Flamininus in dem Kriege gegen den macedonischen König Philippus im J. 198 v. Chr. nach Epirus gekommen war, befand er sich in großer Verlegenheit, da nicht allein die Ortsbeschaffenheit unendliche Schwierigkeiten bot, sondern auch fast alle Felsen mit schwerem Geschütze von dem Feinde besetzt waren. So hatte er 40 Tage, ohne irgend Etwas unternehmen zu können, müssig vor den Augen der Feinde zugebracht, als ein Hirt, von Charopus, dem Fürsten der Epiroten, abgeschickt, ihm gegen eine Belohnung versprach einen Weg zu zeigen, auf dem er leicht die Feinde überraschen könne. S. Livius 32, 9–12.
28 Statt erat bei Halm lese ich mit Klotz und Anderen erit.
29 Titus Pomponius Atticus, ein Römischer Ritter und innigster Freund Cicero's, der auch durch die Verheirathung seines Bruders Quintus mit der Schwester des Atticus mit diesem verwandt war. Er schrieb mehrere geschichtliche Werke, z. B. eine Geschichte von Cicero's Consulate in Griechischer Sprache. Seinen Beinamen erhielt er von seinem langjährigen Aufenthalte in Athen. S. über ihn Cornel. Nep. und vgl. Orelli Onom. p. 481–483.
30 Der in der ersten Anmerkung erwähnte Hirt.
31 C. meint den verderblichen Zustand des Staates nach Cäsar's Ermordung.
32 Cicero, geb. 106 v. Chr., war damals 62, Atticus, geb. 109, 65 Jahre alt.
33 Tithonus, Sohn des Troischen Königs Laomedon, Gemahl der Eos (Aurora), welche für ihn von Zeus Unsterblichkeit erwirkt, aber vergessen hatte, zugleich ewige Jugend für ihn zu erbitten. Er wurde daher zuletzt ganz kraftlos, und Eos verwandelte ihn in eine Heuschrecke. S. Nitsch-Klopfer Mythol. Wörterb. Th. II. S. 597.
34 Aristo von Keos, einer cykladischen Insel, war ein Peripatetischer Philosoph, um 225 v. Chr. S. Cicer. Fin. V. 5, 13. Diog. L. 5, 64. Orelli Onom. I. p. 68, der J. G. Habmann in Jahn's N. Jahrb.-Supplementband 1. Hft. Lpzg. 1835. S. 102 ff. anführt.
35 Ueber M. Porcius Cato und den jüngeren Scipio s. die Einleitung zu der Schrift von der Freundschaft.
36 Eine sprüchwörtliche Redensart, die sich schon bei Euripides Herc. Fur. 637 f. findet:
37 Vgl. den Komiker Krates bei Stob. Floril. 115, 9:
38 Vgl. Cicer. Lael. 2, 6: Cato quasi cognomen jam habebat in senectute Sapientia. Vgl. Cicer. Legg. II. 2, 5. Vgl. die Einleitung S. 5.
39 Nach Plat. Rpb. I. p. 328, E: δοκει̃ γάρ μοι χρη̃νει παρ' αυτω̃ν (τω̃ν πρεσβυτέρων) πυνθάνεσθαι, ώσπερ τινὰ οδὸν προεληλυθότων, ὴν καὶ ημα̃ς ίσως δεήσει πορεύεσθαι, ποία τίς εστι, τραχει̃α καὶ χαλεπὴ ὴ ραδία καὶ εύπορος· καὶ δὴ καὶ σου̃ ηδίως ὰν πυθοίμην, ό τι σοι φαίνεται του̃το, επειδὴ ενταυ̃θα ήδη ει̃ τη̃ς ηλικίας, ὸ δὴ επὶ γήραος ουδω̃ φασιν ει̃ναι οι ποιηταί, πότερον χαλεπὸν του̃ βίου, ή πω̃ς σὺ αυτὸ εξαγγέλλεις.
40 Plat. l. d. p. 329, A: πολλάκις γὰρ συνερχόμεθα τινες εις ταυτὸ παραπλησίαν έχοντες, διασώζοντες τὴν παλαιὰν παροιμίαν. Das Sprichwort wird oft erwähnt, z. B. Plat. Symp. p. 195, B: ο γὰρ παλαιὸς λόγος ευ̃ έχει, ως όμοιον αεὶ πελάζει. Vgl. Homer. Od. ρ, p. 218.
41 Gajus Livius Salinator, im J. 188 v. Chr. Consul, 170 gestorben als Oberpriester. S. Liv. 38, 35. 43, 11.
42 Spurius Postumius Albinus im J. 186 v. Chr. Consul, 180 gestorben als Augur. S. Liv. 39, 6. 40, 42.
43 So erklärt Lehmeyer die Worte: importunitas autem et inhumanitas omni aetati molesta est richtig und vergleicht Catull. 51. 13. Schroffheit und Unfreundlichkeit erzeugt Menschen jeglichen Alters Verdruß und Unannehmlichkeiten. Vgl. die folgende Stelle Plato's. Die Lesart omni aetate ist mit Recht von den neueren Herausgebern verworfen worden. Der hier ausgesprochene Gedanke übrigens ist aus Plat. l. d. p. 329, D. entlehnt: αλλὰ καὶ τούτων πέρι καιτω̃ν γε πρὸς τοὺς οικείους μία τις αιτία εστιν, ου τὸ γη̃ρας, ω Σώκρατες, αλλ' ο τρόπος τω̃ν ανθρώπων· ὰν μὲν γὰρ κοσμιοι καὶ εύκολοι ω̃σι, καὶ τὸ γη̃ρας μετρίως εστὶν επίπονος· ει δὲ μή, καὶ γη̃ρας, ω̃ Σώκρατες, καὶ νεότης χαλεπὴ τω̃ τοιούτω ξυμβαίνει.
44 Seriphus, eine kleine und felsige Insel (jetzt Sersanto), eine der Cykladen im Aegäischen Meere. Vgl. Cicer. N. D. I. 31, 88. Die angeführte Anekdote hat Cicero gleichfalls aus Plat. Rpb. p. 329, E entlehnt:τὸ του̃ Θεμιστοκλέους ευ̃ έχει, ὸς τω̃ Σεριφίω λοιδορουμένω καὶ λέγοντι, ότι ου δὶ αυτόν, αλλὰ διὰ τὴν πόλιν ευδοκιμοι̃, απεκρίνατο, ότι ούτ' ὰν αυτὸς Σερίφιος ὼν ονομαστὸς εγένετο, ούτ' εκει̃νος ’Αθηναι̃ος.
45 Auch diese Stelle ist aus Plat. p. 330, A entlehnt: ούτ' ὰν ο επιεικὴς πάνυ τι ραδίως γη̃ρας μετὰ πενίας ενέγκοι, ούθ' ο μὴ επιεικὴς πλουτήσας εύκολος ποτ' ὰν εαυτω̃ γένοιτο.
46 multum (viel) bezieht Lehmeyer richtig auf den Reichthum des Erlebten.
47 Der berühmte Quintus Fabius Maximus, der, im zweiten Punischen Kriege im J. 217 v. Chr. zum Dictator gewählt, nach den unglücklichen Schlachten der Römer am Ticinus, an der Trebia und am Trasimenischen See den Römischen Staat dadurch, daß er einer Schlacht mit Hannibal auswich, rettete und daher den Beinamen Zauderer ( Cunctator) erhielt. Im J. 233 war er zum ersten, 208 zum fünften Male Consul, nahm er Tarentum wieder ein; im J. 202 starb er. Vgl. Orelli Onom. p. 246 sq.
48 D. h. nach Campanien, dessen Hauptstadt Capua war. Ueber das Zeitverhältniß s. die Einleitung S. 6.
49 Publius Sempronins Tuditanus und Marcus Cornelius Cethegus waren im J. 204 v. Chr. Consuln.
50 Marcus Cincius Alimentus schlug als Volkstribun im J. 204 v. Chr. das Gesetz vor, in dem den Sachwaltern verboten wurde für ihre Rechtsvertheidigung Geld oder ein Geschenk von ihren Clienten anzunehmen. S. Orelli Index Legum in Onom. p. 151.
51 Ennius aus Rudiä in Calabrien, geb. 230 v. Chr., gest. 169, Vater der Römischen Dichtkunst, hat viele Griechische Tragödien, namentlich des Euripides, und Komödien frei in's Lateinische übersetzt, sowie auch ein historisches Epos, Annalen genannt, welches in achtzehn Büchern die Geschichte Roms bis zu dem ersten Punischen Kriege umfaßte, in Hexametern geschrieben. Sowol dieses als jene sind bis auf einige Bruchstücke verloren gegangen. Die Bruchstücke der Annalen sind von Spangenberg ( Lips. 1825) gesammelt. Die hier erwähnte Stelle ist aus den Annalen. Den ersten Vers führt Livius 30, 27 an: nihil certius est quam unum hominem nobis cunctando rem restituisse, sicut Ennius ait.
52 Marcus Livius Salinator, im J. 206 v. Chr. zum zweiten Male Consul mit Gajus Claudius Nero, besiegte mit diesem den Hasdrubal am Flusse Metaurus in Umbrien. Die hier erwähnte Sache wird von Cicero auch de Orat. II. 67, 273 dem Salinator zuertheilt; bei Polybius aber 8, 19 wird statt Salinator Gajus, bei Livius 27, 34 Marcus Livius Macatus und 27, 25, sowie bei Plutarch. Fab. c. 23 bloß Marcus Livius genannt. Gernhard sucht zu beweisen, daß Cicero den Marcus Livius Salinator mit dem Marcus Livius Macatus verwechselt habe.
53 D. h. im Frieden. die toga war das Friedenskleid, sowie sagum das Kriegskleid der Römer.
54 Fabius war zum zweiten Male Consul im J. 227 v. Chr. mit Spurius Carvilius.
55 Gajus Flamininus Nepos machte im J. 227 v. Chr. als Volkstribun den oben angegebenen Gesetzvorschlag. Im J. 217 wurde er, zum zweiten Male Consul, am Trasimenischen See in Etrurien von Hannibal gänzlich geschlagen und mit dem größten Theile seines Heeres getödtet. Vgl. Cicer. de Orat. II. 12, 54.
56 und als solcher das Ansehen der Auspicien auf jede Weise hatte wahren sollen.
57 Vgl. Homer. Iliad. μ, 243: εις οιωνὸς άριστος αμύνεσθαι περὶ πάτρης.
58 Der auch Quintus Fabius Maximus hieß. Er war im J. 212 v. Chr. Consul.
59 Cato meint den älteren Scipio Africanus, der im J. 205 v. Chr. zum ersten Male Consul war und durch den 202 über Hannibal bei Zama in Afrika errungenen Sieg den zweiten Punischen Krieg beendigte.
60 Plato war in Athen geboren im J. 430 v. Chr. und gestorben zu Athen im J. 347. Er war der Sohn des Aristo, Schüler des Sokrates, Stifter der älteren Akademie.
61 Isokrates aus Athen war geb. 436 v. Chr. und gestorben 338, also im 99sten Jahre. Er war ein Schüler der berühmten Sophisten Prodikus, Protagoras, Gorgias und anderer und der berühmteste Lehrer der Beredsamkeit. Er schrieb zwar Reden, hielt sie aber nicht. Es sind 21 Reden von ihm erhalten. Die hier erwähnte Rede ist eine Lobrede auf Athen, die an dem Athenischen Volksfeste Panathenäen, welches der Athene geweiht war, vorgelesen wurde.
62 Panath. c. 1: τοι̃ς έτεσι ενενήκοντα καὶ τέτταρσιν, ω̃ν εγὼ τυγχάνω γεγονώς.
63 Gorgias aus Leontini, einer Stadt auf der östlichen Seite Siciliens (jetzt Lentini), ein Schüler des Empedokles aus Agrigent in Sicilien, eines berühmten Philosophen der Jonischen Schule (um 450 v. Chr.), kam später nach Athen und war einer der berühmtesten Sophisten zur Zeit des Sokrates.
64 Titus Flamininus und Manius Acilius Balbus waren im J. 150 v. Chr. Consuln.
65 Gnäus Servilius Cäpio und Quintus Marcius Philippus waren im J. 169 v. Chr. Consuln.
66 Der Voconische Gesetzvorschlag, im J. 169 v. Chr. von dem Volkstribunen Quintus Voconius Sara gemacht, bestimmte, daß, wer zu 100,000 Sestertien abgeschätzt sei, keine Frau zur Erbin einsetzen oder ihr kein größeres Legat vermachen dürfe, als die Hälfte der Erbschaft. Höchst gründlich und ausführlich wird dieses Gesetz von Hermann Sauppe in Orelli's Index Legum p. 294–395 besprochen. Durch dieses Gesetz sollte verhütet werden, daß nicht durch Testamente ein zu großes Vermögen in die Hände der Frauen und somit in andere Familien überginge und dadurch das Ansehn alter Familien geschwächt würde.
67 S. zu Kap. 5 § 13.
68 Lucius Aemilius Paullus, leiblicher Vater des jüngeren Scipio Africanus, Schwiegervater von Cato's älterem Sohne, hatte den letzten König von Macedonien, Perseus, in der Schlacht bei Pydna in Macedonien 168 v. Chr. besiegt, woher er den Beinamen Macedonicus erhielt.
69 Gajus Fabricius Luscinus, der berühmte Heerführer der Römer in dem Kriege gegen Pyrrhus, König von Epirus (279 v. Chr.), nicht bloß durch Tapferkeit, sondern auch durch Genügsamkeit, Unbestechlichkeit und Edelmuth ausgezeichnet. Vgl. unten Kap. 13, §. 43.
70 Manius Curius Dentatus, dreimal Consul (290, 275, 254 v. Chr.), besiegte in seinem ersten Consulate die Samniten und Sabiner, in seinem zweiten den Pyrrhus bei Beneventum. Vgl. über seine Genügsamkeit unten Kap. 16, §§. 55 und 56.
71 Tiberius Coruncanius, in dem Kriege gegen die Etrusker im J. 282 v. Chr. als Heerführer ausgezeichnet, auch ein großer Rechtsgelehrter, 280 Consul, der erste Plebejer, der Hoher Priester ( Pontifex Maximus) war 252. In der Schrift de Orat. III. 15, 56 stellt ihn Cicero wegen seiner Weisheit mit Lykurgus, Pittakus, Solon, Fabricius, Cato, dem älteren Scipio zusammen. Vgl. N. D. II. 66, 165. III. 2, 5.
72 Appius Claudius Cäcus (der Blinde) legte während seiner Censur (311 v. Chr.) eine gepflasterte Landstraße ( via Appia) von Rom nach Capua und Wasserleitungen an. Im J. 307 erhielt er zum ersten und im J. 296 zum zweiten Male die Consulwürde; während der letzteren trug er einen glänzenden Sieg über die Samniten davon. Im J. 279 schickte Pyrrhus den Cineas nach Rom, um Friedensunterhandlungen anzuknüpfen; der Senat zeigte sich dazu geneigt; da ließ sich Appius in einer Sänfte nach der Curie tragen, wo er in einer nachdrücklichen Rede die Abschließung des Friedens widerrieth. Cicero führt im Brut. 16, 61 f. diese Rede als zu seiner Zeit noch vorhanden an. Plutarch ( Vit. Pyrrhi c. 19) theilt die Rede mit.
73 Florus II. 15, 4: Cato inexpiabili odio delendam esse Carthaginem et, quum de alio consuleretur, pronuntiabat. Plutarch. Cat. c. 27: ’Εκει̃νο δ' ήδη καὶ βιαιότερον, τὸ περὶ παντὸς ου̃ δήποτε πράγματος γνώμην αποφαινόμενον προσεπιφωνει̃ν ούτως· Δοκει̃ δέ μοι καὶ Καρχηδόνα μὴ ει̃ναι.
74 Nämlich dein Adoptivgroßvater. Der altere Publius Cornelius Scipio Africanus, der durch den 202 v. Chr. bei Zama in Afrika über Hannibal errungenen Sieg den zweiten Punischen Krieg beendigt hatte, war der Adoptivgroßvater des jüngeren Africanus, der im Jahre 146 Karthago zerstörte. Der Sohn des älteren Africanus adoptirte nämlich den zweiten Sohn des Aemilius Paullus Macedonicus, der von der Zerstörung Karthago's den Beinamen Africanus minor erhielt. Cato starb drei Jahre vor der Zerstörung Karthago's.
75 senibus, Greisen; daher die Rathsversammlung Senat genannt wurde.
76 γέροντες d. i. Greise; die Rathsversammlung hieß γερουσία.
77 in Naevii poetae ludo; Andere schreiben Ludo und erklären es für den Titel eines Lustspieles. S. Georges Lat. Lex. h. v. Nävius aus Campanien (gest. 206 v. Chr.) war ein berühmter Römischer Tragiker und Komiker. Auch verfaßte er ein historisches Gedicht in sieben Büchern, den ersten Punischen Krieg (vgl. 14, 50), in dem er selbst Kriegsdienste gethan hatte.
78 Ueber des Themistokles ausgezeichnetes Gedächtniß vgl. Cicer. de Fin. II. 32, 104. de Orat. II. 74, 299. 86, 351.
79 Es herrschte bei den Alten der Aberglaube, das Lesen der Inschriften auf den Grabmälern schade dem Gedächtnisse. Cato aber beschäftigte sich mit den Grabinschriften, um sie für seine Urgeschichte ( Origenes, s. d. Einleitung) zu benutzen.
80 Von den vielen Trauerspielen des Sophokles aus Athen (geb. 497 v. Chr., gest. 405) sind nur noch sieben übrig, und unter diesen ist das hier erwähnte Oedipus auf Kolonos (einem hochgelegenen Gaue Athens) eines der vorzüglichsten.
81 Die Worte: num Homerum hat Halm weggelassen: sie fehlen in mehreren Handschriften, in anderen sind sie versetzt. Gernhard, Klotz, Madvig u. A. halten sie für ächt. Wegen der darauf folgenden Worte: num Hesiodum konnten sie leicht von einem Abschreiber übersehen werden.
82 Hesiodus aus Kyme in Aeolis lebte zu Askra in Böotien um 800 v. Chr. Seine Hauptgedichte sind eine Theogonie und ein auf den Ackerbau bezügliches Lehrgedicht (έργα καὶ ημέραι.)
83 Simonides aus Kea (Keos), einer Insel des Aegäischen Meeres, geb. 556 v. Chr., gest. 467, ein berühmter lyrischer Dichter. Von seinen Gedichten sind nur noch wenige Bruchstücke übrig.
84 Stesichorus aus Himera in Sicilien um 600 v. Chr., gleichfalls ein lyrischer Dichter; auch von ihm sind uns nur wenige Bruchstücke erhalten worden.
85 Kap. 5 §. 13.
86 Pythagoras aus Samos, Schüler des Pherkydes, Stifter der Italischen oder der nach ihm benannten Pythagoreischen Schule, geb. 582 v. Chr., gest. zu Kroton in sehr hohem Alter. Seine philosophischen Lehren schrieb er nicht nieder, sondern theilte sie nur mündlich seinen Schülern mit.
87 Demokritus aus Abdera in Thracien, geb. 460 v. Chr., gest. 357, erweiterte und bildete die von Leucippus gegründete Atomenlehre aus. Von seinen zahlreichen Schriften sind uns nur einzelne Sätze aufbewahrt worden.
88 S. zu Kap. 5 §. 13.
89 Xenokrates aus Chalcedon in Bithynien, Schüler Plato's, nach Speusippus Vorsteher der Akademie von 339 v. Chr. an fünfundzwanzig Jahre hindurch.
90 Zeno aus Citium auf der Insel Cypern, Stifter der Stoischen Schule (um 300 v. Chr.), gestorben zu Athen, über 90 Jahre alt.
91 Kleanthes aus Assus in Lycien, Schüler des Krates und Nachfolger Zeno's, einer der berühmtesten Stoiker. Nach Diog. L. VII. 176 soll er 80 Jahre alt geworden sein.
92 Diogenes, der Babylonier, eigentlich aus Seleucia in Syrien (καλούμενος δὲ Βαβυλώνιος διὰ τὴν γειτονίαν, Diog. L. VII. 81) ein Schüler des berühmten Stoikers Chrysippus. Lehrer der Stoischen Philosophie zu Athen. Im J. 156 v. Chr. wurde er als Gesandter mit dem Akademiker Karneades und dem Peripatetiker Kritolaus nach Rom geschickt, wo er philosophische Vorträge hielt. Cicer. Tusc. IV. 3, 5.
93 Cato hatte im Sadinischen Gebiete sein Landgut. S. Kap. 14 §. 46. Corn. Nep. Cat. 1, 1.
94 Cäcilius Statius aus Mailand, Lateinischer Lustspieldichter, Freund des Ennius, gest. 170 v. Chr. Er hat viele Griechische Lustspiele frei in's Lateinische übersetzt. Wir haben nur noch einzelne Bruchstücke von denselben übrig. S. Fragm. Comic. v. Bothe. Eines seiner Stücke führte die Aufschrift Synepheben (συνέφηβοι) d. i. Jugendfreunde, welches er nach dem gleichnamigen Stücke des Griechischen Lustspieldichters Menander bearbeitet hatte.
95 Solon, der berühmte Gesetzgeber der Athener (um 590 v. Chr.), war zugleich elegischer Dichter. Der hier erwähnte Ausspruch desselben findet sich bei Plutarch. Solon. c. 31: γηράσκω δ' αιεὶ πολλὰ διδασκόμενος.
96 Cicer. ad Famil. IX. 22, 3: Socratem fidibus docuit nobilissimus fidicen. ls Connus vocitatus est. Vgl. Platon. Menex. p. 235, E.
97 Milon aus Kroton in Unteritalien, ein berühmter Athlet von ungewöhnlicher Körperstärke (um 580 v. Chr.). Vgl. Kap. 10, 33.
98 Sextus Aelius Pätus, im J. 198 v. Chr. mit Titus Flamininus Consul. Er hatte den Beinamen Catus, d. h. klug, wegen seiner ausgezeichneten Kenntniß in der Rechtswissenschaft. Vgl. Cicer. Brut. 20, 78. de Orat. I. 45, 198. Auch gab er das sogenannte jus Aelianum heraus, d. h. eine Erklärung der bisher nur den Patriciern bekannten Rechtsformeln.
99 Ueber Tiberius Coruncanius s. zu Kap. 6, §. 15.
100 Publius Licinius Crassus Dives, seit 212 v. Chr. Hoher Priester, im J. 204 Consul mit dem älteren Scipio Africanus. Liv. 30, 1 lobt ihn als einen durch Reichthum, Schönheit, körperliche Kraft, Beredsamkeit und Kenntniß des Rechtes ausgezeichneten Mann. Vgl. unten 14, 50. 17, 61.
101 Gnäus und Publius Cornelius Scipio, ein edles Brüderpaar, Heerführer der Römer im zweiten Punischen Kriege in Spanien, 212 v. Chr. in kurzer Zeit nach einander durch die List der Karthager und durch Verrath der Celtiberier getödtet, nachdem sie den Hanno und Hasdrubal am Ebro besiegt hatten.
102 Lucius Aemilius Paullus, Vater des Aemilius Macedonicus (s. zu 6. 15), leiblicher Großvater des jüngeren Scipio Africanus, erlitt in seinem zweiten Consulate (216 v. Chr.) durch die Unbesonnenheit seines Amtsgenossen, Terentius Varro, die schreckliche Niederlage der Römer bei Cannä und fand selbst den Tod. S. Livius 22, 49.
103 Publius Africanus, der ältere, war der Adoptivgroßvater des jüngeren Africanus. S. zu Kap. 6, §. 18.
104 Xenoph. Cyrop. VIII. 7, 6: τουμὸν γη̃ρας ουδεπώποτε ησθόμην τη̃ς εμη̃ς νεότητος ασθενέστερον γιγνόμενον. Ueber Xenophon s. zu Kap. 17, §. 59.
105 Lucius Cäcilius Metellus erfocht als Proconsul in dem ersten Punischen Kriege im J. 251 v. Chr. bei Panormus in Sicilien über den Karthagischen Feldherrn Hasdrubal einen glänzenden Sieg. Vgl. Cicer. de Rep. I. 1, 1. Im J. 243 wurde er Hoher Priester.
106 Nestor, König von Pylos im Peloponnese. Die Homerischen Stellen sind Iliad. α, 260 ff. λ, 663 ff.
107 Vgl. Homer. Iliad. α, 250. Odyss. γ 245. Ein Menschenalter betrug 30 Jahre.
108 Hom. Iliad. α, 249: του̃ καὶ απὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ρέεν αυδή.
109 Agamemnon, König von Mycenä. Die Homerische Stelle ist Il. β, 371 f.:
110 S. Kap. 9, § 30.
111 Manius Acilius Glabrio besiegte als Consul im J. 191 v. Chr. in den Thermopylen, einem Engpasse Thessaliens, den König von Syrien, Antiochus III. den Großen. Livius 36, 17 übrigens erzählt, daß Cato damals nicht Kriegstribun, sondern Unterfeldherr gewesen sei.
112 Der Sinn des Sprüchwortes ist: Man muß früh besonnen und mäßig wie ein Greis sein, wenn man lange leben will. Cato schiebt aber dem Sprüchworte einen anderen Sinn unter, nämlich: man muß früh das bequeme Leben eines Greises erstreben, wenn man lange leben will.
113 und aus diesem Grunde ihm meine Dienste verweigert hatte.
114 Ob dieser Titus Pontius derselbe gewesen sei, der bei Cicer. de Fin. I. 3, 9 in einem Verse des Satirikers Lucilius erwähnt wird, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.
115 S. zu Kap. 9, §. 27. Quintil. I, 9: ut Milo, quem vitulum assueverat ferre, taurum ferebat.
116 Ueber Pythagoras s. zu Kap. 7, § 23.
117 Masinissa, König der Massulischen Numidier in Afrika; im ersten Punischen Kriege mit den Karthagern verbündet, im zweiten Punischen Kriege aber, im J. 206, von dem älteren Scipio Africanus in die Freundschaft aufgenommen, schloß er ein Bündniß mit den Römern und leistete dem jüngeren Scipio Africanus in der Schlacht bei Zama wichtige Dienste. Erst zu Anfang des dritten Punischen Krieges starb er, 90 Jahre alt. Vgl. Cicer. Somn. Scip. c. 1. Sallust. Iug. 5. Livius 29, 29 sqq. Appian. de reb. Pun. c. 106.
118 siccitatem d. h. Festigkeit. Varro ap. Non. h. v.: Persae propter exercitationes pueriles modicas eam sunt consecuti corporis siccitatem, ut neque spuerent neque emungerentur sufflatove corpore essent, nach Xenoph. Cyrop. I, 2. 16, woraus man sieht, daß das Wort des Non. modicas ganz verkehrt hinzugesetzt ist; denn bei Xenophon steht τη̃ς μετρίας διαίτης. Cicer. Tuscul. V. 34, 99: Adde siccitatem, quae consequitur hanc continentiam in victu.
119 Die Römer waren nur bis zum 45sten Jahre zum Kriegsdienste verpflichtet; die älteren wurden nur zur Bewachung der Stadt verwendet; vom 60sten Jahre an waren sie nicht allein vom Kriegsdienste, sondern von jedem Staatsdienste befreit.
120 Der Sohn des älteren Scipio Africanus, der auch Publius Cornelius Scipio Africanus hieß, konnte zwar wegen schwächlicher Gesundheit die glänzende Laufbahn seines Vaters nicht verfolgen, war aber ein wissenschaftlich gebildeter Mann. Cicer. Brut. 19, 77 erwähnt von ihm kleine Reden und eine sehr angenehm ( dulcissime) geschriebene Geschichte. Er nahm den Sohn des Aemilius Paullus Macedonicus, den später so berühmt gewordenen Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus minor, an Kindes Statt an.
121 Ueber Cäcilius Statius s. zu Kap. 7, §. 24. Die Verse, auf die sich die Stelle bezieht, stehen im Laelius 26, 99.
122 Ueber Appius Claudius Cäcus s. zu Kap. 6, §. 16.
123 Unter der Aufschrift Origines gab der ältere Cato ein Geschichtswerk heraus, worin er in sieben Büchern die Abstammung und Geschichte der Italischen Völker behandelte. Vgl. Cicer. Brut. 17, 66. 85, 294. Corn. Nep. Cat. c. 3, 4.
124 In den sogenannten goldenen Sprüchen (χρυσα̃ έπη) des Pythagoras (s. zu 7, 23) heißt es Vers 40 bis 44:
125 Archytas aus Tarentum, ein berühmter Philosoph der Pythagoreischen Schule, Lehrer Plato's, lebte um 370 v. Chr. Er zeichnete sich nicht bloß in der Philosophie, Mathematik und Mechanik aus, sondern war auch ein tüchtiger Feldherr und vortrefflicher Mensch. S. Diog. L. 8, 79.
126 S. zu Kap. 4, §. 10.
127 Gajus Pontius, Sohn des Herennius, ein tapferer Heerführer der Samniten, schloß im J. 321 v. Chr. die Römer unter den Consuln Spurius Postumius und Titus Veturius bei Caudium, einer Stadt Samniums, in den Caudinischen Pässen ein und ließ sie durch das Joch gehen. Im J. 292 wurde er gefangen genommen und enthauptet.
128 Auch Plutarch. Cat. M. c. 2. erwähnt den Nearchus als Gastfreund des Cato.
129 Lucius Camillus und Appius Claudius waren Consuln im J. 349 v. Chr. Uebrigens ist Cicero's Angabe unrichtig. Nicht 349 v. Chr. (d. i. ein Jahr vor seinem Tode) kam Plato nach Tarentum, sondern etwa 10 Jahre früher.
130 Ueber Titus Flamininus s. zu Kap. 1, §. 1.
131 Lucius Flamininus war im J. 192 v. Chr. Consul.
132 Consul steht hier für Proconsul. S. Georges Lat. Lex. unter consul.
133 Der hier erwähnte Vorfall wird von Livius 39, 42 und 43 nach zwei verschiedenen Quellen verschieden erzählt, zuerst nach Cato, der ein männliches scortum den Punier Philippus, sodann nach Valerius aus Antium, einem Chronikenschreiber, der eine famosa mulier erwähnt.
134 Titus Quinctius Flamininus war im J. 189 Censor.
135 Lucius Valerius Flaccus bekleidete mit Cato sowol das Consulat im J. 195 v. Chr. als auch das Censoramt im J. 184.
136 Ueber Gajus Fabricius s. zu Kap. 6, §. 15. Die hier erwähnte Gesandtschaft fällt in das J. 280 v. Chr.
137 Cineas aus Thessalien, ein Schüler des Demosthenes, Freund des Pyrrhus, ein sehr beredter und gebildeter Mann, durch dessen Beredsamkeit Pyrrhus mehr Städte erobert zu haben sich rühmte als durch die Waffen.
138 Epikurus aus Gargettus, einem Attischen Demos, geb. 342 v. Chr. und gest. 270, Stifter der Epikureischen Schule, welche die Lust (ηδονη, voluptas) für das höchste Gut und den Schmerz für das höchste Uebel erklärte.
139 Vgl. Cicer. Fin. II. 3, 7: (Epikurus), der sich allein, meines Wissens, für einen Weisen auszugeben wagt.
140 Ueber Manius Curius und Tiberius Coruncanius s. zu Kap. 6, §. 15.
141 Die Samniten waren Bundesgenossen der Tarentiner und des Pyrrhus.
142 Publius Decius Mus, Sohn des gleichnamigen Decius (s. zu 20, 75) brachte sich in seinem vierten Consulate (295 v. Chr.), dem Beispiele seines Vaters gleichen Namens, der als Consul im J. 340 v. Chr. im Kampfe mit den Latinern am Vesuve sich muthig für das Vaterland opferte, folgend, in dem Kriege mit den Samniten, Umbriern, Etruskern und Galliern im Gebiete der Stadt Sentinum in Umbrien als Opfer den unsterblichen Göttern für den Staat dar.
143 Plat. Timaeus p. 69, D: ηδονήν, μέγιστον κακου̃ δέλεαρ.
144 Gajus Duilius war der Erste, der über die Karthager bei Mylä, einer Seestadt Siciliens, im J. 260 v. Chr. einen Seesieg davon trug.
145 Nach einem Ausspruche der Sibyllinischen Bücher wurde im J. 204 unter der Quästur Cato's das Bild der Göttin Cybele, ein Stein, aus Pessinus in Phrygien nach Rom gebracht. Die Cybele oder die große Mutter der Götter heißt Idäische Mutter von dem Berge Ida in Phrygien, woher ihr Kultus stammt.
146 convivium
147 συμπόσιον.
148 σύνδειπνον.
149 tempestivis conviviis. Die tempestiva convivia sind eigentlich solche Gastmähler, welche vor der gewöhnlichen Zeit des Mittagsmahles, nämlich vor der neunten Stunde des Tages, d. h. nach unserer Zeitrechnung vor 3 Uhr Nachmittags, begannen und dann häufig bis tief in die Nacht hingezogen wurden.
150 Vgl. Plat. Rpl. I. p. 328, D: ευ̃ ίσθι, ότι έμοιγε όσον αι άλλαι αι κατὰ τὸ σω̃μα ηδοναι απομαραίνονται, τοσου̃τον αύξονται αι περὶ τοὺς λόγους επιθυμίαι τε καὶ ηδοναι.
151 magisteria, συμποσιαρχίαι. Bei einem Schmause wurde einer der Gäste zum magister convivii ( rex convivii, συμποσίαρχος) durch das Loos gewählt, der die Trinkgesetze vorschrieb.
152 D. h. von dem, der auf dem obersten Platze des Triklinium (Speisesophas) saß. Auf jedem Triklinium waren drei Plätze, der oberste, summus, links, der mittlere, medius, und der unterste, imus, rechts.
153 rorantia, eigentlich: thauträufelnd, d. h. tropfenweise den Wein kosten lassend, im Gegensatze zu den großen Bechern, aus denen in vollen Zügen getrunken wurde.
154 Xenoph. Conviv. 2, 26: Ούτω δὲ καὶ ημει̃ς ὴν μὲν αθρόον τὸ ποτὸν εγχεώμεθα, ταχὺ ημι̃ν καὶ τὰ σώματα καὶ αι γνω̃μαι σφαλου̃νται καὶ ουδὲ αναπνει̃ν, μὴ ότι λέγειν τι δυνησόμεθα· ὴν δε ημι̃ν οι παι̃δες μικραι̃ς κύλιξι επιψεκάζωσιν, ίνα καὶ εγὼ εν Γοργιείοις ρήμασιν είπω, ούτως ου βιαζόμενοι υπὸ του̃ οίνου μεθύειν, αλλ' αναπειθομενοι πρὸς τὸ παιγνιωδέστερον αφιξόμεθα: wo man Bornemann p. 82–84 vergleiche.
155 wo Cato, wie wir zu Kap. 7, §. 24 gesehen haben, sein Landgut hatte.
156 Plat. Rpl. I. p. 329. B. C.: καὶ Σοφοκλει̃ ποτε τω̃ ποιητη̃ παρεγενόμενη ερωτωμένω υπο τινος. Πω̃ς, εφη, ω̃ Σοφόκλεις, έχεις πρὸς ταφροδίσια; έτι οι̃ος τ' ει̃ γυναικὶ συγγίγνεσθαι· καὶ ός Ευφημαι, έφη, ω̃ άνθρωπε; ασμεναίτατα μέντοι αυτὸ απέφυγον, ώσπερ λυττω̃ντα τινα καὶ αργιον δεσπότην αποφυγών.
157 Lucius Ambivius Turpio, ein berühmter Schauspieler, Zeitgenosse Cato's, der in den meisten Stücken des Terentius auftrat.
158 Gajus Sulpicius Gallus, 166 v. Chr. Consul, ein gelehrter und namentlich in der Astronomie bewanderter Mann. In dem Kriege mit Perseus, dem Könige von Macedonien, diente er als Kriegstribun unter Aemilius Paullus (168), sagte vor der Schlacht bei Pydna eine Mondsfinsterniß vorher und munterte die Soldaten auf dieselbe nicht als ein böses Vorzeichen anzusehen, da ihre Erscheinung auf natürlichen Gründen beruhe. S. Livius 44, 37.
159 Ueber Nävius s z. Kap. 6. §. 20.
160 Plautus aus Sarsina in Umbrien, der geistreichste unter den Römischen Lustspieldichtern, lebte zu Rom, geb. 227 v. Chr., gest. 184. Von seinen sehr vielen Stücken haben wir nur noch zwanzig übrig, zu denen Truculentus (der Griesgram) und der Pseudolus (das Lügenmaul) gehören.
161 Marcus Livius Andronicus aus Tarent, ein tragischer Dichter, und zwar der erste, der um 240 v. Chr. unter dem Consulate des Gajus Claudius Cento und Publius Sempronius Tuditanus ein Schauspiel in Rom aufführte. Er war ein Freigelassener des Marcus Livius Salinator, dessen Kinder er unterrichtete. Auch übersetzte er die Odyssee in's Lateinische.
162 Ueber Publius Licinius Crassus s. zu Kap. 9, §. 27.
163 Publius Cornelius Scipio Nasica, mit dem Beinamen Corculum (d. h. der Weise), Sohn des Publius Cornelius Scipio Optimus, im J. 162 v. Chr. und 155 Consul, 159 Censor, seit 150 Hoher Priester, ein beredter Mann, s. Cicer. Brut. 20, 79.
164 Marcus Cornelius Cethegus, im J. 204 v. Chr. mit Publius Sempronius Tuditanus Consul (s. oben Kap. 4, §. 10). Ueber ihn sagt Cicer. Brut. 15, 57 sq.: Quem vero exstet et de quo sit memoriae proditum eloquentem fuisse et ita esse habitum, primus est M. Cornelius Cethegus, cujus eloquantiae est auctor et idoneus, mea quidem sententia, Q. Ennius. Daselbst wird auch des Ennius Vers angeführt:
165 Die Ableitung des Wortes occatio Eggen, von occaecare, blind, unsichtbar machen, verdecken, ist durchaus verfehlt; occatio kommt von occare, eggen. Im Etymologisiren waren überhaupt die Alten, die Griechen sowol als die Lateiner, keine Helden. Man vergleiche nur z. B. die wunderbaren Etymologien bei Cicer. N. D. II. 26 u. 27. Uebrigens mußte die Uebersetzung der Worte: primum id occaecatum cohibent, ex quo occatio, quae hoc efficit, nominata est, sich etwas frei bewegen.
166 Nach der Lesart der Handschriften diffundit, die auch Halm beibehalten hat; die Lesart diffindit, welche sich in allen neueren Ausgaben findet, scheint eine bloße Muthmaßung zu sein.
167 Das Buch führt die Aufschrift: De re rustica.
168 Ueber Hesiodus s. zu Kap. 7, §. 23.
169 Odyss. ω, 226 f.:
170 Ueber Manius Curius Dentatus s. zu Kap. 6, §. 15.
171 Lucius Quinctius Cincinnatus war zweimal Dictator, zuerst im J. 458 v. Chr., sodann 49. In seiner ersten Dictatur befreite er den von den Aequern umzingelten Consul, Lucius Minucius Augurinus, und trug einen glänzenden Sieg über die Feinde davon, s. Livius III, 26 sqq.; das zweite Mal erhielt er die Dictatur, um die durch Spurius Mälius bedrohte Freiheit zu schützen. Spurius Mälius, ein reicher Plebejer, hatte nämlich während einer Hungersnoth Getreide aufgekauft und unentgeltlich unter das Volk vertheilt. Dadurch hatte er den Verdacht erregt, daß er nach der Königswürde strebe. Er wurde von Cincinnatus des Hochverraths angeklagt und vor Gericht geladen. Als er aber hier nicht erschien, wurde er von dem Befehlshaber der Reiterei, Gajus Servilius Ahala, ermordet. S. Livius IV, 13 sqq. Uebrigens hat Cicero diesen Vorfall fälschlich der ersten Dictatur des Cincinnatus zugewiesen; denn nur bei der ersten Ernennung zum Dictator wurde er vom Pfluge herbeigeholt.
172 viatores.
173 D. h. der Garten gewährt ebenso, wie die Speckseite des Schweines, dem Landmanne großen Nutzen.
174 Ich lese mit Madvig ( Opusc. II. p. 275 sq.) und Halm so: Conditiora facit haec supervacaneis etiam operis aucupium atque venatio. Die meisten Handschriften und Ausgaben lesen: supervacanei etiam operis.
175 Die Keule statt des Schwertes zur Uebung. Veget. Milit. 2, 11: clavas ligneas pro gladiis tironibus dabant eoque modo exercebantur ad palos.
176 Xenophon aus Athen, ein Schüler des Sokrates, geb. 447 v. Chr., gest. nicht vor 355. Die hier erwähnte Schrift Xenophon's, den Οικονομικός, die uns vollständig erhalten ist, hat Cicero in seinem einundzwanzigsten Jahre aus dem Griechischen in's Lateinische übersetzt. S. Cicer. Off. II. 24, 87, wo man Beier p. 166 vergleiche. Weiter unten (Kap. 9, §. 30 u. Kap. 22) wird eine Stelle aus seiner Cyropädie (Κύρου παιδεία) erwähnt, in der er unter der Person des älteren Cyrus das Musterbild eines Fürsten aufstellt.
177 Xenophon. Oecon. 4, 20–25.
178 Kritobulus war ein Schüler des Sokrates.
179 Der jüngere Cyrus, Statthalter von Kleinasien, jüngerer Sohn des Darius Nothus, Königs von Persien, Bruder des Königs Artaxerxes II., bekriegte diesen, um ihn vom Throne zu stoßen, fiel aber in der Schlacht bei Kunara in der Nähe Babylons (400 v. Chr.).
180 Lysander, Feldherr der Lacedämonier, besiegte die Athener in der Schlacht bei Aegospotamos im Hellesponte 405 v. Chr., machte durch Eroberung Athens dem Peloponnesischen Kriege ein Ende und brachte die oberste Gewalt Griechenlands in die Hände der Lacedämonier.
181 Lat. directos in quincuncem ordines, in der Gestalt der Römischen Fünf (V) in schrägen Reihen, nämlich so: ·.· , und in Verbindung mehrerer Bäume so: :·: Uebrigens hat Cicero nicht wörtlich übersetzt, sondern nach der Weise, wie die Römer ihre Baumpflanzungen anordneten. Bei Xenophon Oecon. 4, 21 steht: ορθοὶ δὲ οι στίχοι τω̃ν δένδρων, ευγώνια δὲ πάντα καλω̃ς είη, d. h. die geraden Reihen der Bäume, in der Gestalt von rechten Winkeln geordnet.
182 Marcus Valerius Corvus, einer der berühmtesten Römer, war sechsmal Consul, das erste Mal im J. 348 v. Chr., als er erst dreiundzwanzig Jahre alt war, das sechste Mal 299; zweimal Dictator, (342 und 301). Im H. 350 tödtete er als junger Kriegstribun einen Gallier, der den tapfersten Römer zum Zweikampf herausgefordert hatte; seinen Beinamen Corvus erhielt er von dem Raben, der ihm bei diesem Zweikampfe behülflich gewesen war ( Livius 7, 25 sq.). Uebrigens hat sich Cicero verrechnet, wenn er sagt, daß zwischen dem ersten und sechsten Consulate 46 Jahre verflossen seien, da es 49 Jahre sind.
183 Das Alter der Jugend rechneten die alten Römer bis zum 46sten Jahre; alsdann trat das Alter der seniores, d. h. der Bejahrten, ein; das eigentliche Greisenalter, die senectus, begann erst mit dem 61sten Jahre.
184 Ueber Lucius Cäcilius Metellus s. zu Kap. 9, §. 30.
185 Aulus Atilius Calatinus, ein höchst vortrefflicher Mann, im ersten Punischen Kriege zweimal Consul, (258 und 254 v. Chr.), 249 Dictator, 247 Censor.
186 Ueber Publius Licinius Crassus s. zu Kap. 9, §. 27.
187 Marcus Aemilius Lepidus, 179 v. Chr. Censor, 187 und 175 Consul, seit 180 Hoher Priester. Vgl. Orelli Onomastic. h. v. p. 338.
188 Ueber Lucius Aemilius Paullus und über den älteren Scipio Africanus s. zu Kap. 9, 29.
189 Ueber Quintus Fabius Maximus s. zu Kap. 4, §. 10.
190 Kap. 17, §. 59.
191 Das Amt der Auguren bestand darin, daß sie aus dem Fluge, den Stimmen und dem Fressen der Vögel, sowie auch aus der Beobachtung anderer Thiere und aus Himmelserscheinungen weissagten. Ihr Amt war lebenslänglich. Unter Romulus bestand ihr Collegium aus drei, unter Servius Tullius aus vier und seit Sulla aus funfzehn Mitgliedern. Cicero hatte eine Schrift de auguriis verfaßt, die aber verloren gegangen ist. S. Adam's Röm. Alterthüm. Bd. I. S. 329 ff.
192 qui cum imperio sunt. Das imperium (den Oberbefehl), das die höchste militärische und richterliche Gewalt umfaßte, hatten nur die höheren Staatsbeamten, die Dictatoren, Consuln und Prätoren.
193 Adelphen ( Adelphi d. h. Brüder) hieß ein dem Griechischen Komiker Menander nachgebildetes Lustspiel des Publius Terentius aus Karthago (um 192–155 v. Chr.), ein Freigelassener des Terentius Lucanus, ein Freund des Scipio und Lälius.
194 S. Kap. 5, 15.
195 Wenn nicht so viele Menschen in der Jugend stürben, so würde es mehr Greise geben und somit auch mehr Klugheit und Weisheit unter den Menschen herrschen.
196 Vgl. oben Kap. 6, §. 20.
197 Cato's Sohn starb im J. 152 v. Chr., als er zum Prätor ernannt worden war.
198 Lucius Aemilius Paullus, der leibliche Vater des jüngeren Scipio Africanus, verlor seine beiden jüngsten Söhne im Jahr 167 v. Chr. innerhalb acht Tagen, den einen in einem Alter von zwölf, den anderen von 14 Jahren.
199 Arganthonius, König von Tartessus, einer Stadt am Ausflusse des Bätis (Guadalquivir), und von Gades (Kadix), lebte zur Zeit des älteren Cyrus. Herod. I. 163: (οι Φωκαιέες) προσφιλέες εγένοντο τω̃ βασιλέϊ τω̃ν Ταρτησσίων, τω̃ ούνομα μὲν η̃ν ’Αργανθώνιος, ετυράννευσε δὲ Ταρτησσου̃ ογδώκοντα έτεα, εβίωσε δὲ πάντα είκοσι καὶ εκατόν, woselbst man Bähr nachsehe T. I. p. 320 sq. ed. II.
200 D. h. bis zum Schlusse des Stückes, wo durch den Ausruf: plaudite (klatscht) die Zuschauer zum Beifall aufgefordert wurden.
201 Zu Anfang dieses Kapitels standen in älteren Ausgaben die Worte: Omnium aetatum certus est terminus. Sie finden sich aber in keiner einzigen glaubwürdigen Handschrift. Daher hat sie schon Manutius als einen unächten Zusatz aus dem Texte entfernt. Vgl. Madvig Opusc. II. p. 277.
202 Nach den Worten: quod munus officii exsequi et tueri possis werden in den älteren Ausgaben (auch noch bei Klotz) die Worte: mortemque contemnere hinzugefügt. Halm hat sie als unächt in Klammern eingeschlossen. Daß der Zusatz sowol in kritischer Hinsicht als wegen des verkehrten Gedankens zu verwerfen sei, zeigt Madvig Opusc. II. p. 278 auf das Deutlichste.
203 Ueber Solon s. zu Kap. 8 §. 26. Pisistratus herrschte von 560–510 v. Chr. über Athen.
204 Ueber Pythagoras s. zu Kap. 7. §. 23. Der hier ausgesprochene Gedanke findet sich auch bei Cicer. Tuscul. I. 30, 74: Vetat enim dominans ille in nobis deus injussu hinc nos suo demigrare, und Platon Phaedon. p. 62, B: ως έν τινι φρουρα̃ εσμεν οι άνθρωποι καὶ ου δει̃ δὴ εαυτὸν εκ ταύτης λύειν ουδ' αποδιδράσκειν, wo man Stallbaum p. 30 sq. ed. 3 nachlese.
205 Das Distichon aus einem elegischen Gedichte Solon's, das Cicero hier als eine Grabschrift bezeichnet, findet sich bei Plutarch. Comp. Solon. c. Popl. c. 1:
206 Lucius Junius Brutus, der bei der Befreiung seines Vaterlandes von der Herrschaft des Tarquinius Superbus besonders thätig gewesen war, wurde nach Vertreibung des Tarquinius aus Rom im J. 509 zum ersten Consul erwählt, fiel aber in einer Schlacht gegen die Vejenter und Tarquinier in einem Zweikampfe mit Aruns, einem Sohne des Tarquinius, der gleichfalls sein Leben verlor.
207 Ueber die beiden Decier s. zu Kap. 13, §. 43.
208 Marcus Atilius Regulus wurde in dem ersten Punischen Kriege als Proconsul in Afrika 255 v. Chr. gefangen genommen und 250 wegen Auslösung der Gefangenen nach Rom geschickt, nachdem er den Eid geleistet hatte, wenn die Gefangenen nicht zurückgegeben würden, nach Karthago zurückzukehren. Zu Rom angelangt, widerrieth er selbst die Auslösung und kehrte nach Karthago zurück, wo er auf die grausamste Weise getödtet worden sein soll. Vgl. Cicer. Offic. III. 26, 99 sqq. Uebrigens erzählen die Schriftsteller den Tod des Regulus verschieden; der für diese Zeit wichtigste Historiker, Polybius, erwähnt Nichts. Daher ist in neueren Zeiten die Wahrheit der Erzählung von dem grausamen Tode des Regulus vielfach bezweifelt worden. Das steht aber historisch fest, daß Regulus in der Gefangenschaft der Karthager starb.
209 Ueber die beiden Scipionen s. zu Kap. 9, §. 29.
210 Ueber Lucius Aemilius Paullus s. zu Kap. 9, §. 29.
211 Marcus Claudius Marcellus, der in seinem ersten Consulate (222 v. Chr.) die Gallier bei Clastidium im Cispadanischen Gallien besiegte, ihren König Viridomarus in einem Zweikampfe tödtete, im zweiten Punischen Kriege (216) den Hannibal bei Nola in Kampanien in die Flucht schlug, dann Syrakus belagerte und eroberte (212), zuletzt in dem Treffen bei Venusia in Lucanien, von Hannibal besiegt, fiel (208).
212 S. Livius 27, 28. Plutarch. Marcell. c 30: επιθαυμάσας τὸ παράλογον τη̃ς τελευτη̃ς τὸν μὲν δακτύλιον αφείλετο, τὸ δὲ σω̃μα κοσμήσας πρέποντα κέσμω καὶ περιστείλας εντίμως έκαυσε.
213 S. zu Kap. 11, 38.
214 Lucius Aemilius Paullus Macedonicus (s. zu Kap. 6, §. 15) und Gajus Lälius. Freund und Kampfgenosse des älteren Scipio Africanus, im J. 190 v. Chr. Consul mit Lucius Cornelius Scipio Asiaticus.
215 Cicer. N. D. II. 14, 38: ipse autem homo ortus est ad mundum contemplandum et imitandum. Der Mensch soll nach der Lehre der Stoiker die vernünftige, durch die göttliche Vernunft bestehende Ordnung des Weltganzen, die Vernünftigkeit und Gesetzmäßigkeit der allgemeinen Natur in seinem ganzen Leben nachahmen. Dieß nannten sie έπεσθαι τη̃ φύσει (folge der Natur) oder ομολογουμένως τη̃ φύσει ζη̃ν (lebe in Uebereinstimmung mit der Natur). S. Schwegler Gesch. der Philos. S. 89. Zeller Gesch. d. Gr. Phil. Th. III S. 126 ff.
216 Ueber Pythagoras und die Pythagoreer s. zu Kap. 7, §. 23.
217 ex universa mente divina delibatos animos. Cicer. Divin. I. 49, 110: a qua (natura deorum) . . haustos animos et libatos habemus. Tuscul. V. 13. 38: humanus animus decerptus ex mente divina cum nullo nisi cum ipso deo comparari potest. Aus der Lehre des Pythagoras über die menschliche Seele führt Diog. L. VIII, 28 folgenden Satz an: ει̃ναι δὲ τὴν ψυχὴν απόσπασμα αιθέρος καὶ του̃ θερμου̃ καὶ του̃ ψυχρου̃ τω̃ συμμετέξειν ψυχρου̃ αιθέρος· διαφέρειν τε ψυχὴν φωη̃ς· αθάνατόν τε ει̃ναι αυτήν, επειδήπερ καὶ τὸ αφ' ου̃ απέσπασται αθάνατόν εστι.
218 in Plato's Phädon.
219 S. Platon. Apol. Socr. p. 21, A. Nach dem Scholiasten des Aristophanes ( Nub. 144) lautete das Orakel also:
220 Xenoph. Cyrop. VIII. 7, 17 sqq. S. zu Kap. 17, §. 59.
221 Bei Xenoph. l. d. §. 18: τοι̃ς δὲ φθιμένοις τὰς τιμὰς διαμένειν ετι ὰν δοκει̃τε, ει μηδενὸς αυτω̃ν αι ψυχαὶ κύριαι η̃σαν; d. h. glaubt ihr, daß den Todten die Ehrenbezeigungen verbleiben würden, wenn ihre Seelen über Nichts mehr Herren wären? Der Sinn unserer Stelle ist also: Ehrenbezeigungen berühmter Männer dauern fort, weil ihr Geist auch nach ihrem Tode auf die Menschen einwirkt.
222 S. zu Kap. 6, §. 15.
223 S. zu Kap. 9, §. 29.
224 Die Brüder Publius Scipio, der der Vater des älteren Scipio Africanus war, und Gnäus Scipio. S. zu Kap. 9, §. 29.
225 ad immortalitatis gloriam. So liest richtig Halm nach den Handschriften statt ad immortalitatem gloriae, das Orelli, Klotz und Andere aufgenommen haben. Gloria immortalitatis heißt ein Ruhm, der der Unsterblichkeit angehört, also ein ewiger Ruhm.
226 Cicero hat hier den Pelias mit dem Aeson verwechselt. Aeson wurde von seinem Stiefbruder Pelias des ihm rechtmäßig zukommenden Königreichs Jolkos beraubt. Auf Bitten seines Sohnes Jason wurde der greise Aeson von der Medea, die dem Jason von Kolchos nach Jolkos gefolgt war, durch Zaubermittel wieder jung gemacht. Um sich an dem Pelias zu rächen, versprach Medea den Töchtern des Pelias diesen gleichfalls wieder jung zu machen. Sie ließ die Töchter ihren Vater zerstücken und mit Kräutern kochen, machte ihn aber nicht wieder lebendig. S. Nitsch-Klopfer Mytholog. Wörterb. Th. I. S. 90–92
227 zu den Schranken, den Anfangspunkten der Rennbahn. Das Bild der Rennbahn wird bei den Alten oft auf das menschliche Leben übertragen. Vgl. Lael. 27, 101. Tusc. I. 8, 15.
228 Dem Sohne, der schon Kap. 6, §. 15 erwähnt worden ist. Er war der Schwiegersohn des Lucius Aemilius Paullus, unter dem er in der Schlacht gegen den Perseus kämpfte. Er starb als designirter Prätor im J. 153 v. Chr.
229 S. Kap. 2, §. 4.
230 Cato meint insbesondere die Epikureer, welche die Unsterblichkeit der Seele leugneten.