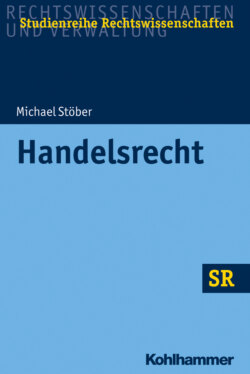Читать книгу Handelsrecht - Michael Stöber - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.Formkaufleute
ОглавлениеIm Fall 2 wird der Obst- und Gemüseladen nicht von K, sondern von einer Unternehmergesellschaft, der Obst und Gemüse Kater UG, betrieben. Die UG ist eine Rechtsformvariante der GmbH. Während eine „reguläre“ GmbH nach § 5 Abs. 1 GmbHG ein Stammkapital von wenigstens 25.000 € haben muss, ist die UG durch die Besonderheit gekennzeichnet, dass ihr Stammkapital unter dem Mindestbetrag von 25.000 € liegt (s. § 5a Abs. 1 GmbHG). Eine UG kann theoretisch mit einem Stammkapital von nur einem Euro gegründet werden (s. § 5 Abs. 2 Satz 1 GmbHG). Dem Umstand, dass das Mindestkapitalerfordernis für die UG nicht gilt, trägt § 5a GmbHG durch eine Reihe von Sondervorschriften Rechnung; insbesondere darf eine UG im Rechtsverkehr nicht als „reguläre“ GmbH auftreten, sondern muss gem. § 5a Abs. 1 GmbHG in ihrer Firma den Rechtsformzusatz „UG (haftungsbeschränkt)“ führen.
Im Übrigen steht die UG aber in vollem Umfang einer „regulären“ GmbH gleich; insbesondere ist auch die UG gem. § 13 Abs. 1 GmbHG eine juristische Person, und für die Verbindlichkeiten der UG gegenüber ihren Gläubigern haftet nur die UG mit dem Gesellschaftsvermögen, wohingegen die Gesellschafter der UG keine persönliche Haftung trifft (§ 13 Abs. 2 GmbHG). K hat den Werkvertrag mit M im Namen der UG als deren Geschäftsführer geschlossen (§ 164 Abs. 1 BGB i. V. m. § 35 Abs. 1 GmbHG). Aus dem Werkvertrag verpflichtet ist daher allein die UG und nicht etwa K persönlich. Demgemäß richten sich auch etwaige Zinsansprüche des M nur gegen die UG.
Wie im Fall 1 (dazu Rn. 23) kann M nach den allgemeinen Vorschriften des BGB mangels vorheriger Mahnung erst ab dem 3. Mai Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 1.500 € verlangen (s. § 288 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 i. V. m. § 286 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 BGB). Ein Anspruch auf Zinsen ab dem 2. April – dem Tag der Fälligkeit der Vergütungsforderung des M – kann sich aber wiederum aus § 353 Satz 1 HGB ergeben. Dies setzt voraus, dass sowohl M als auch die UG Kaufmann ist und der Werkvertrag jeweils zum Betrieb des Handelsgewerbes gehört (s. § 343 Abs. 1 HGB).
Wie bereits zu Fall 1 festgestellt wurde (s. Rn. 47), ist M Kaufmann nach § 2 Satz 1 HGB. Es stellt sich die Frage, ob auch die UG Kaufmann ist. Wie zu Fall 1 dargelegt wurde, erfordert das Obst- und Gemüseunternehmen keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb; es handelt sich also um ein Kleingewerbe, das nach § 1 Abs. 2 Halbs. 2 HGB an sich kein Handelsgewerbe darstellt. Die Kaufmannseigenschaft der UG könnte sich jedoch aus § 6 Abs. 2 HGB ergeben.
55Nach § 6 Abs. 2 HGB sind juristische Personen („Vereine“), denen das Gesetz ohne Rücksicht auf den Gegenstand ihres Unternehmens die Kaufmannseigenschaft zuschreibt, auch dann als Kaufleute anzusehen, wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 HGB nicht vorliegen (sog. Formkaufleute). Formkaufleute sind folgende juristische Personen:
– die GmbH (s. § 13 Abs. 3 GmbHG: „Die Gesellschaft gilt als Handelsgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuchs“);
– die AG (s. § 3 Abs. 1 AktG: „Die Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesellschaft, auch wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht im Betrieb eines Handelsgewerbes besteht“);
– die KGaA (s. § 278 Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 1 AktG);
– die eingetragene Genossenschaft (eG, s. § 17 Abs. 2 GenG: „Genossenschaften gelten als Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs“);
– die mit Wirkung vom 8.10.2004 durch die SE-VO91 EU-weit eingeführte Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea – SE; s. Art. 9 Abs. 1 Buchst. c Ziff. iii SE-VO i. V. m. § 3 Abs. 1 AktG).92
56Die genannten juristischen Personen sind allein kraft ihrer Rechtsform Kaufleute; ob sie ein Handelsgewerbe i. S. d. § 1 Abs. 2 HGB oder überhaupt ein gewerbliches Unternehmen betreiben, ist ohne Belang. Eine GmbH, AG, KGaA, eG oder SE ist also selbst dann Formkaufmann, wenn sie ein nichtgewerbliches, z. B. ein freiberufliches Unternehmen betreibt. Mit der Regelung des § 6 Abs. 2 HGB trägt der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass die von der Regelung erfassten Rechtsformen primär für gewerbliche Unternehmen gedacht sind; aus Gründen der Vereinfachung der Rechtsanwendung legt § 6 Abs. 2 HGB Unternehmensträgern in diesen Rechtsformen daher typisierend stets die Kaufmannseigenschaft bei. Steuerrechtliche Parallelregelungen finden sich in § 8 Abs. 2 KStG, § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG. Danach sind u. a. bei im Inland ansässigen Kapitalgesellschaften und eingetragenen Genossenschaften alle Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln und die Tätigkeit stets und in vollem Umfang als Gewerbebetrieb anzusehen, ohne dass es darauf ankommt, ob die betreffende Körperschaft tatsächlich einer gewerblichen Betätigung i. S. d. § 15 Abs. 2 EStG nachgeht.
Im Fall 2 wird der Obst- und Gemüseladen zwar nicht von einer „regulären“ GmbH, sondern von einer UG betrieben. Bei der UG handelt es sich jedoch lediglich um eine besondere Art einer GmbH, deren Stammkapital nicht den Mindestbetrag von 25.000 € erreicht. Vorbehaltlich des § 5a GmbHG gelten die Vorschriften für die GmbH daher auch für die UG. Auch § 13 Abs. 3 GmbHG ist mithin auf die UG anwendbar; die UG ist also ebenfalls Formkaufmann gem. § 6 Abs. 2 HGB i. V. m. § 13 Abs. 3 GmbHG. Darauf, dass der von der UG betriebene Obst- und Gemüseladen ein Kleingewerbe und damit nach § 1 Abs. 2 Halbs. 2 HGB kein Handelsgewerbe ist, kommt es für die Eigenschaft als Formkaufmann nicht an.
Weil der Werkvertrag über die Malerarbeiten im Ladenlokal auch zum Betrieb des von der UG geführten Obst- und Gemüsehandels gehört, stellt der Werkvertrag auch für die UG ein Handelsgeschäft dar (§ 343 Abs. 1 HGB). Es handelt sich folglich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft. M kann daher von der UG gem. §§ 353 Satz 1, 352 Abs. 2 HGB ab dem 2. April Fälligkeitszinsen aus 1.500 € in Höhe von 5 % p. a. verlangen.