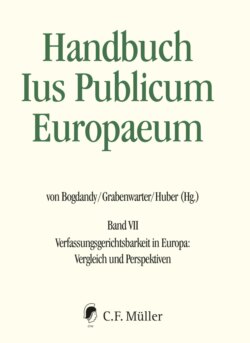Читать книгу Handbuch Ius Publicum Europaeum - Monica Claes - Страница 51
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Die Verfassungsgerichte der europäischen Wende
Оглавление135
Symbolreich erscheint auch die erneute Veranstaltung eines Heidelberger Kolloquiums zur vergleichenden Verfassungsgerichtsbarkeit im Jahr 1998. Dieses Mal geht es um „eine erste Zwischenbilanz des verfassungsrechtlichen Transformationsprozesses in Mittel- und Osteuropa seit 1989“.[237] Tatsächlich tauchen seit diesem Jahr, und eigentlich sogar noch vorher, Verfassungsgerichte in den neuen Verfassungen der Republiken der östlichen Hälfte Europas „in Scharen“ auf.[238] Es ist wiederum ein Moment der Beschleunigung der verfassunggebenden Aktivität in diesen Staaten. Diese Entwicklung steht dieses Mal nicht im Kontext einer Nachkriegszeit, sondern in dem des abrupten Zusammenbruchs eines politischen und sozioökonomischen Modells mit Epizentrum in Moskau.[239]
136
Obwohl Mitglieder des Europarats und des Systems der EMRK, werden sowohl die Russische Föderation als auch die Staaten des Kaukasus hier weitgehend außer Betracht bleiben.[240] Die Aufmerksamkeit soll sich stattdessen auf die Staaten der sogenannten „Visegrad-Gruppe“ sowie die Baltischen Republiken und teilweise den Balkan richten, kurzum die europäischen Staaten, die sukzessiv 2004, 2007 und 2011 der Europäischen Union beigetreten sind, wobei der besondere Fall Deutschlands nicht zu vergessen ist.[241] Manche dieser Republiken hatten schon zum Zeitpunkt der Wende Verfassungsgerichte, die, obwohl in der Theorie dazu berufen, das Fortbestehen der jeweiligen politischen Systeme zu garantieren, in der Praxis eine relevante Rolle bei der Entwicklung zur Rechtsstaatlichkeit spielen sollten. Fast alle diese Republiken haben inzwischen im Rahmen ihrer neuen Verfassungen[242] für das System der konzentrierten Normenkontrolle optiert.
137
Die Geburt dieser neuen europäischen Verfassungsgerichte erfolgte nicht uniform. In manchen Fällen geschah dies in einer Weise, die sich nicht wesentlich von anderen, bereits dargelegten nationalen Entwicklungen unterscheidet. In einigen Fällen allerdings verlief es anders. Denn diese Jahre sind Zeuge eines neuen Phänomens. Bis 1989 war das Muster klar: Zuerst die Verfassungen, dann die Verfassungsgerichte. So war es in der Zwischenkriegszeit und so war es auch in der darauf folgenden Nachkriegszeit. Verfassungsgerichte dienten ausnahmslos und prinzipiell der Garantie einer neuen, aber auf jeden Fall bereits bestehenden Verfassungsordnung, der die Verfassungsgerichte auch ihre Existenz verdankten. Damit ist auch gesagt, dass der nationale Verfassunggeber zu dem Zeitpunkt, in dem die Verfassungsgerichte ihre Tätigkeit aufnehmen, seine Mission bereits erfüllt hat, bisweilen, wie in Italien, schon Jahre vorher. Das galt gleichfalls für die Verfassungsgerichtsbarkeit selbst, deren organische und funktionale Aspekte im Voraus mehr oder minder detailliert vom Verfassunggeber vorgeschrieben waren.
138
In dieser Periode gibt es aber wiederholt Situationen, in denen umgekehrt die Verfassungsgerichtsbarkeit der Verfassung vorausgeht. Es ist keine Ausnahme mehr, dass diese Verfassungsgerichte sich in der Lage befinden, als Geburtshelfer neuer Verfassungen, die darum kämpfen, endlich ins Leben zu treten, aufzutreten.[243] Der Begriff des Gerichtsaktivismus ist in diesen Fällen vielleicht nicht unangebracht, greift aber zu kurz. Es gab schon Gelegenheit, den Aktivismus mancher europäischer Gerichte zu erwähnen, sei dieser substantieller (die Schweiz) oder prozeduraler (Belgien) Natur. Diesmal aber hat man es mit einem Aktivismus neuer Prägung zu tun, der sich ohne Übertreibung dem Begriff der Verfassunggebung annähert. Drei Fälle sollen das Phänomen veranschaulichen.