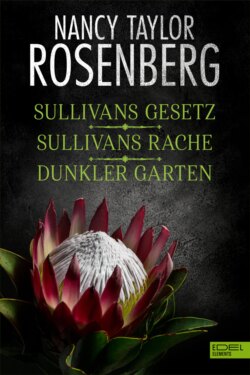Читать книгу Sullivans Gesetz/ Sullivans Rache/ Dunkler Garten - Nancy Taylor Rosenberg - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5
ОглавлениеWährend der Fahrt am Dienstagnachmittag zu ihrer Verabredung mit Daniel Metroix im Seagull Motel nahm Carolyn ihr Handy und rief zu Hause an.
»Wo warst du?«, fragte sie, als sich ihr Sohn meldete.
»Zu Hause«, entgegnete John. »Ich habe dich zurückgerufen. Hast du meine Nachricht nicht bekommen?«
»Nein«, sagte sie. »Als du angerufen hast, war ich wahrscheinlich schon unterwegs. Ich bin heute früher gegangen. Was ist denn los? Hast du den Fleischkäse aufgetaut, wie ich dich heute Morgen gebeten habe?«
»Rebecca hasst Fleischkäse«, erinnerte John sie. »Deshalb liegt er ja schon seit zwei Monaten im Gefrierschrank. Wann kommst du nach Hause?«
»Ich sollte es bis spätestens sieben schaffen«, sagte Carolyn. »Wenn ihr Hunger habt, esst schon mal ohne mich.«
»Und was sollen wir jetzt essen?«, fragte John leicht verärgert. »Du musst vorher noch einkaufen. Wir haben nichts für heute Abend und fürs Mittagessen morgen im Haus.«
»Ich bringe was mit«, beruhigte Carolyn ihren Sohn. »Wo ist deine Schwester?«
»Sie hat sich im Bad eingeschlossen«, sagte John, »und färbt sich die Haare lila.«
»Hol sie mir sofort ans Telefon!«, befahl Carolyn.
»Ich habe nur Spaß gemacht«, sagte John, klang aber bedrückt. »Dir kann’s doch egal sein, du bist ja sowieso nie da. Seit über zwei Tagen komme ich mit meiner Differentialrechenaufgabe nicht weiter. Wenn wir nicht bald eine Lösung für unsere Haushaltsprobleme finden, geht es abwärts mit meinen Noten, Mom. Ich kann nicht alles alleine machen – Kochen, Waschen und Rebecca Nachhilfeunterricht geben.«
»Du hast Recht«, sagte Carolyn. »Wir sprechen am Wochenende darüber. Ich habe dich nur angerufen, um dir zu sagen, dass ich etwas später komme. Wartet mit dem Essen, okay? Ich rufe dich in fünf Minuten wieder an.« Sie wollte die Verbindung schon unterbrechen, merkte dann aber, wie wenig einfühlsam ihre Worte geklungen hatten und fügte schnell hinzu: »John, ich weiß zu schätzen, was du für uns tust und verspreche dir, dass wir einen Weg finden, um dich zu entlasten.«
»Entschuldige, dass ich mich beklagt habe, Mom. Ich bin wohl müde.«
»Ich liebe dich«, sagte Carolyn. »Du musst dich bei mir nicht entschuldigen, denn du hast völlig Recht. Ich bin auch müde und nehme mir vielleicht dieses Semester frei.«
Sie beendete das Gespräch und drückte eine der Speichertasten auf ihrem Handy. Neil nahm nach dem vierten Läuten ab.
»Wie gut, dass du zu Hause bist«, sagte Carolyn. »Ich brauche dich nämlich.«
»Gott ist immer zu Hause, wenn du ihn brauchst«, witzelte Neil. »Was ist denn jetzt schon wieder los?«
»Hast du viel zu tun?«
»Nächste Woche habe ich doch eine Ausstellung«, sagte er. »Und in meinem Schlafzimmer wartet ein hinreißend schönes nacktes Weib auf mich. Ein Model und sie japst vor Ungeduld. Selbst du würdest dich in diese Frau verlieben. Sie hat das Gesicht und den Körper eines Engels.«
»Du weißt doch, dass ich mir nichts aus Frauen mache«, wies Carolyn ihren Bruder zurecht. »Leg die nackte Schöne auf Eis und lade meine Kinder zum Abendessen ein. Ich muss noch einen Haftentlassenen in seinem Motel besuchen. John hat behauptet, es sei nichts mehr zu essen im Haus. Du bist mir noch was schuldig, weil du am Sonntag Mutter nicht besucht hast. Verdammt, ich musste für dich eine Torte backen.«
»Etwa eine von diesen Dingern aus Vanillewaffeln mit Bananen und Schlagsahne, die ich so liebe?«
»Ja«, sagte Carolyn. »Und wenn wir sie nicht gegessen hätten, wäre ich damit zu dir gekommen und hätte sie dir ins Gesicht geworfen. Du weißt doch, dass ich keine Zeit zum Backen habe.«
»Ich hole John und Rebecca in einer Viertelstunde ab.«
»Danke«, sagte Carolyn. »Ruf sie vorher an und sag’s ihnen selbst. Wenn du mir heute Abend aus der Patsche hilfst, backe ich dir eine Bananentorte.«
»Ich glaube, meine Ausstellung wird eine Katastrophe.«
Jetzt fängt das schon wieder an, dachte Carolyn, die nur zu gut diese Anfälle von Selbstzweifeln kannte, mit denen ihr Bruder ihr Herz erweichen wollte.
»Nein, bestimmt nicht«, versicherte sie ihm. »Du wirst damit einen Riesenerfolg haben.«
»Du verstehst mich nicht«, sagte Neil leise, damit ihn das Mädchen im Nebenraum nicht hören konnte. »In Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs investieren die Leute nicht in Kunstobjekte. Nur weil ich letztes Jahr eine Menge Bilder verkauft habe, muss das Geschäft dieses Jahr nicht wieder so gut laufen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das Haus verkaufen soll.«
Wenn Neil auch selbstbewusst auf andere Menschen wirkte, so war er gefühlsmäßig doch sehr labil. Carolyn schrieb dies seiner künstlerischen Veranlagung zu, denn vor jeder Ausstellung war er schrecklich nervös.
»Reg dich ab«, sagte sie. »Hast du nicht letzten Monat ein Bild für dreißigtausend Dollar verkauft?«
»Ja«, räumte er ein. »Aber das war eine Ausnahme. Der Kerl war so blöd, dass er auch eine leere Leinwand gekauft hätte. Aber er war stinkreich. Ich glaube, er ist ein Gangster, der sich in die Gesellschaft einkaufen will. Sollte er herausfinden, dass ich noch nie ein Bild in dieser Preisklasse verkauft habe, kommt er wahrscheinlich und hackt mich in Stücke.«
Ach, du liebe Güte!, dachte Carolyn. Immer wenn sich Neil aufregt, benimmt er sich wie ein Kind.
»Ist nicht in der Los Angeles Times ein Artikel über dich erschienen?«
»Ja, aber ...«
»Hör mir mal gut zu«, sagte Carolyn. »Du bist ein wunderbarer Maler. Und solange du nicht über die Stränge schlägst, kommst du mit deinem Geld mindestens fünf Jahre über die Runden, auch wenn du kein einziges Bild verkaufst. Mutters Eigentumswohnung in Camarillo hast du bar bezahlt, also könntest du sie im Notfall mit einer Hypothek belasten. Und du hast mir öfter Geld geliehen, als mir lieb ist. Ich liebe dich, Neil. Alle lieben dich. Deine Ausstellung wird großartig und du wirst einen Haufen Bilder verkaufen und eine Menge Geld verdienen. Und wenn nicht, spielt es auch keine Rolle.«
»Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde«, sagte Neil und stieß einen tiefen Seufzer aus. »Du machst mir wieder richtig Mut.«
»Du bist doch für mich auch da«, sagte Carolyn. »Du verbringst zu viel Zeit allein in diesem Schuppen hinter deinem Haus, den du als Atelier benutzt. Ruf John und Rebecca an. Fahrt irgendwohin und amüsiert euch. Dann kommst du auf andere Gedanken und fühlst dich gleich besser.«
Ein Blick auf die Uhr im Armaturenbrett zeigte Carolyn, dass es schon nach halb sechs war. Sie warf das Handy in ihre Handtasche und gab Gas.
Ein paar Minuten vor sechs bog Carolyn auf den Parkplatz des Seagull Motels ein. Da sie großen Wert auf Pünktlichkeit legte, machte es sie nervös, wenn sie sich verspätete. Unter den Schlüsseln an ihrem Schlüsselbund suchte sie den passenden für das Handschuhfach, schloss es auf, griff hinein und nahm ihr Schulterhalfter samt Waffe heraus. Dann tastete sie nach dem Magazin und steckte es in ihre 9mm Ruger. Sie hasste Waffen. Obwohl Bewährungshelfer ihrem Status gemäß als vereidigte Sicherheitsbeamte das Recht hatten, Waffen zu tragen, waren bis vor einem Jahr alle Mitarbeiter dieser Dienststellen unbewaffnet gewesen. Erst nachdem ein externer Mitarbeiter einen bedingt Haftentlassenen bei einem nicht angekündigten Hausbesuch bei einem Drogendeal ertappt hatte und dabei erschossen worden war, hatte die Behörde ihre Politik geändert. Auch die Tatsache, dass Bewährungshelfer jetzt mehr auf Bewährung entlassene Häftlinge überwachten, spielte dabei eine Rolle, denn diese Arbeit war mit erhöhten Risiken verbunden.
Carolyn schaltete die Innenbeleuchtung des Infinity ein und prüfte, ob ihre Pistole gesichert war und keine Kugel im Lauf steckte. Seit fünf Monaten hatte sie weder ihr Handschuhfach geöffnet noch die Ruger an sich genommen. Da sie ihre Jacke im Büro vergessen hatte, wäre es ihr zu blöd vorgekommen, das Schulterhalfter über der Bluse zu tragen. Also ließ sie die Pistole in ihre Handtasche fallen und legte das Halfter auf den Beifahrersitz. In ihrem Kofferraum lag zwar eine kugelsichere Weste, aber sie wusste nicht einmal, ob sie ihr passte, weil sie den Karton noch nicht geöffnet hatte.
Carolyn bezweifelte, ob ihr das Tragen einer Waffe mehr Sicherheit bot. Sie hatte in zu vielen Verbrechen ermittelt, in denen Handfeuerwaffen eine Rolle spielten. Die Gesetzgebung hinsichtlich der Registrierung von Schusswaffen war reine Augenwischerei. Ein Großteil der Waffen, die bei Verbrechen benutzt werden, waren Leuten gestohlen worden, die sie ganz legal gekauft hatten. Viele Menschen glaubten, der Besitz einer Waffe böte ihnen Schutz. In neun von zehn Fällen benutzte der Täter jedoch die Waffe seines Opfers, oder ein Familienmitglied bekam die Waffe in die Hand und erschoss damit sich selbst oder einen Angehörigen.
Carolyn war mit dieser Art von Tragödien nur zu vertraut. Ihr Onkel hatte sich die zum Schutz seiner Familie in einem Pfandhaus gekaufte .38er Pistole an die Stirn gesetzt und sich erschossen. Und Carolyn hatte mit ihrer Cousine, seiner Tochter, den Toten gefunden. Die beiden waren damals Teenager gewesen. Doch vergessen konnte sie diese Tragödie nie.
Sie stieg aus und schaltete mit der Fernbedienung die Alarmanlage ein. Der Parkplatz war bis auf einen vor dem Motelbüro abgestellten schwarzen Chevrolet leer. Die Lage ist gut, dachte Carolyn, aber das Motel müsste dringend renoviert werden, was sich der Besitzer wohl wegen Gästemangels nicht leisten konnte. Als sie den Parkplatz überquerte, überkam sie ein unheimliches Gefühl, weil sie Schritte hinter sich zu hören glaubte. Sie drehte sich ein paar Mal um.
Daniel hatte gesagt, er wohne in Zimmer Nummer 221. Die meisten Zimmer in den oberen Stockwerken lagen im Dunkeln, aber ein Fenster stand offen und war erleuchtet. Dort saß ein Mann auf einem Stuhl.
Carolyn ging schnell die Treppe hinauf. Vor der Tür mit der Nummer 221 angekommen, sah sie, dass der Schlüssel außen steckte. Sie stellte sich neben den Türrahmen, umklammerte die Pistole in ihrer Handtasche, streckte den anderen Arm aus und klopfte.
Als Daniel die Tür öffnete, fragte sie: »Warum haben Sie den Schlüssel außen im Schloss stecken lassen?«
»Ich habe gearbeitet«, sagte er, fuhr sich mit der Hand durchs Haar und deutete dann auf einen Stapel Blätter neben der Lampe auf dem Tisch. »Ich lasse den Schlüssel immer stecken, damit ich mich nicht versehentlich aussperre. Das Büro ist oft nicht besetzt. Bei mir gibt’s nichts zu stehlen – außer meiner Arbeit. Was sollte ein Dieb wohl mit einem Haufen Blätter und Aufzeichnungen anfangen, die er nicht einmal entziffern könnte?«
Ob sich Daniel Metroix wohl je wieder an das Leben außerhalb des Gefängnisses anpassen wird?, fragte sich Carolyn. Er trug dasselbe Hemd wie am Vortag, ein Zipfel hing aus dem Hosenbund, sein Haar war zerzaust und er hatte nur eine Socke und keine Schuhe an.
»Ich genieße es sehr, an einem Fenster sitzen zu können«, sagte Daniel, ging durchs Zimmer und legte eine Hand auf die Scheibe. »Meine Zelle im Gefängnis hatte kein Fenster. Wenn meine Augen müde werden, kann ich aufs Meer schauen und mich ausruhen. Ist das nicht wunderbar?«
Während Daniel mit dem Rücken zu ihr stand, überprüfte Carolyn schnell den Wandschrank und das Bad auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen auf Waffen, Drogen oder Alkohol. Verdammt, dachte sie, wenn er in ein Apartment zieht, muss ich noch einen Hausbesuch machen.
»Haben Sie schon eine Wohnung gefunden?«, fragte sie.
»Nein«, antwortete er und drehte sich zu ihr um. »Ich habe doch kein Auto. Ich könnte mir zwar eins kaufen, aber ich habe keinen Führerschein. Ich bin mit dem Bus gefahren und wollte mir ein paar Wohnungen ansehen, aber dann habe ich mich verlaufen und niemand wusste, wo die nächste Bushaltestelle ist. Also bin ich mit dem Taxi hierher zurückgefahren.«
Carolyn ging zu dem mit Papieren übersäten Tisch und griff nach einem Blatt. Eine Seite war mit einer komplizierten Zeichnung bedeckt, mit der sie nichts anzufangen wusste, und die andere mit Gleichungen.
»Was ist das?«, fragte sie.
»Ach«, meinte Daniel schüchtern. »Daran arbeite ich schon seit ungefähr achtzehn Jahren. Das ist ein Exoskelett.«
»Das sagt mir nichts«, entgegnete Carolyn, die das Wort zwar kannte, aber nicht mit einer Apparatur assozierte. Eddie Downly war ein Vergewaltiger gewesen, und sie hatte es nicht erkannt. Je mehr unzusammenhängendes Zeug Daniel Metroix faselte, umso besser würde sie das Risiko einschätzen können, das er für die Gesellschaft darstellte.
»Helfen Sie meinem Gedächtnis auf die Sprünge«, sagte sie deshalb. »Was genau ist ein Exoskelett?«
»Gewisse Tierarten haben Exoskelette, die Panzer der Krabben zum Beispiel sind Exoskelette«, erklärte Daniel. »Ich habe versucht, ein Exoskelett, eine Art Gehhilfe, für die teilweise gelähmte Tochter eines Wärters zu konstruieren.«
Drei Teile Wahnvorstellungen, ein Teil Wissenschaft, dachte Carolyn. Dieses Projekt klingt fast so wie eines der improvisierten Chemie-Experimente meiner Mutter. Um Daniel zum Weitersprechen zu bewegen, fragte sie: »Das ist also eines der Projekte, an dem Sie in Ihrem Labor im Gefängnis gearbeitet haben?«
»Es ist nichts Richtiges dabei herausgekommen«, sagte Daniel, lebhaft auf ihr Interesse reagierend. »Ein menschliches Exoskelett ist ein äußerst komplizierter Apparat. Es gilt, das richtige Material für den Anzug und einen Motor zu entwickeln, der leicht und tragbar ist. Ich glaube, zurzeit arbeiten Wissenschaftler für das Verteidigungsministerium an der Lösung dieser Probleme, damit der einfache Gl problemlos schwere Lasten tragen kann, ohne dass seine Kampfkraft vorher geschwächt wird. Dieses Projekt wird im Institute for Soldier Nanotechnology – kurz ISN –, das zum Massachusetts Institute of Technology gehört, zurzeit realisiert.«
»Mal langsam«, sagte Carolyn und hob ihre Hand, »damit ich das richtig verstehe. Wollen Sie mir erzählen, dass Sie vor achtzehn Jahren etwas erfunden haben, das die Regierung jetzt für das Militär entwickeln und einsetzen will?«
»Ja. Aber ich habe das Exoskelett nicht erfunden«, entgegnete Daniel. »Das einzige Wesen, das ein Patent für das Exoskelett besitzt, ist Gott. Der Homo sapiens kann nur versuchen, die Natur zu kopieren.«
»Gott?«, sagte Carolyn verblüfft, weil Daniel Metroix nach dreiundzwanzig Jahren Gefängnis anscheinend noch immer seinen Glauben bewahrt hatte.
Litt er etwa unter religiösen Wahnvorstellungen? Ein Syndrom, das bei Schizophrenen nicht ungewöhnlich war.
»Ja«, entgegnete Daniel lächelnd. »Und kein Mensch wird jemals in der Lage sein, etwas Ähnliches zu schaffen. Nicht einmal der genialste Wissenschaftler mit allen technischen Möglichkeiten. Glauben Sie etwa, ich könnte eine Ameise, einen Hund, ein Pferd – ganz zu schweigen von einem vernunftbegabten menschlichen Wesen – erschaffen? Allein Gott ist der Schöpfer allen Lebens«, schloss Daniel und rieb sich tief in Gedanken versunken die Stirn.
»Haben Sie im Gefängnis sonst noch etwas erfunden?«, fragte Carolyn.
»Na klar«, sagte Daniel. Ein ähnliches Gespräch hatte er bereits mit seinem Anwalt geführt. »Ich habe alle möglichen Dinge erfunden. Eines meiner ersten Projekte war dieses Multi-Screen-Überwachungssystem mit Videoaufzeichnung. Davon war die Gefängnisverwaltung begeistert, denn sie konnte die Zahl der Wärter drastisch reduzieren.«
Wenigstens diese technische Neuerung kannte Carolyn, denn die meisten Geschäfte hatten inzwischen eine Videoüberwachung installiert. »Hat es diese Videoüberwachung bereits gegeben, als Sie Ihr Gerät entwickelten?«
»Der frühe Prototyp des VCR wurde von einem Mann namens Charles Ginsburg entwickelt, als er für die Firma Ampex gearbeitet hat. Der Apparat war aber fast so groß wie ein Klavier. Später wurde das Patent an Sony verkauft. Der erste kommerziell genutzte VCR kam 1971 auf den Markt. Ich habe mich mit der Konstruktion eines solchen Apparats schon vor meiner Festnahme beschäftigt, weil Komponenten des Fernsehens in Bezug zu dem Kommunikationssystem standen, das ich entworfen hatte. Ich habe weiter daran gearbeitet und vor etwa fünfzehn Jahren wurde es in Betrieb genommen.«
Dieser Zeitpunkt stimmte mit dem Datum des ersten Briefes überein, in dem der Gefängniswärter Daniel Metroix’ Entlassung auf Bewährung empfohlen hatte.
»Haben Sie jemals eine Ihrer Erfindungen verkaufen können?«, fragte Carolyn.
»Nein,«, entgegnete er. »Ehrlich gesagt, ich habe nie daran gedacht, Geld damit zu verdienen. Für mich ist das eine Arbeit, die ich einfach tue. Wenn ich ein Problem sehe, tue ich mein Bestes, um es zu lösen. Außerdem«, fügte er völlig unbekümmert hinzu, »habe ich alle Rechte an meinen Erfindungen, die ich während meines Aufenthalts in Chino gemacht habe, abgetreten. Denn nur unter dieser Bedingung habe ich ein eigenes Labor bekommen.«
Carolyn kannte sich mit dem Patentrecht nicht aus. Sie musste herausfinden, wer jetzt im Besitz dieser Rechte war. Soviel sie bisher begriffen hatte, ging es dabei nicht um die Erfindung banaler Gebrauchsgegenstände. Ihre Müdigkeit war plötzlich verflogen und einem hellwachen Interesse gewichen.
»Haben Sie auch Geräte repariert?«
»Wie kommen Sie denn darauf?«, fragte Daniel. »Der Gefängnisdirektor wollte, dass ich ausschließlich an der Entwicklung des Exoskeletts arbeite. Ich habe ihm immer wieder gesagt, dass mir dafür die richtige technische Ausstattung fehlt.«
Carolyn beschloss, das Thema zu wechseln und fragte: »Können Sie sich daran erinnern, was vor Ihrer Festnahme passiert ist?«
»Nur vage«, sagte Daniel und stieß einen tiefen Seufzer aus. »Ich hatte damals so ernsthafte gesundheitliche Probleme, dass meine Mutter aus Sorge um mich meinen Arzt angerufen hat.«
»Hieß dieser Arzt Walter Gershon?«, fragte Carolyn.
»Ja«, sagte Daniel. »Ich habe ihm aus dem Gefängnis viele Briefe geschrieben, aber nie eine Antwort bekommen.«
»Ich habe versucht, ihn ausfindig zu machen. Aber er steht nicht im Telefonbuch. Entweder hat er sich zur Ruhe gesetzt, ist weggezogen oder bereits gestorben. Haben Sie je ein Medikament Levodopum genommen?«
»Nein. Warum fragen Sie?«
»Weil Sie bei Ihrer Festnahme dieses Medikament bei sich hatten. Ich habe mit einem Psychiater darüber gesprochen und erfahren, dass es eine absolute Fehlmedikation ist, einem Patienten mit Ihrem Krankheitsbild dieses Medikament zu verordnen.«
Mit gesenktem Blick versuchte Daniel, sich zu erinnern. »Wenn ich außer Haus war, hatte ich die Tabletten in einem Umschlag immer dabei«, sagte er schließlich. »Hat die Polizei bei mir einen Umschlag gefunden?«
»Ja«, antwortete Carolyn. »Wie lange haben Sie dieses Medikament genommen?«
»Vielleicht eine Woche«, sagte Daniel. »Vorher hatte mir Dr. Gershon ein anderes Medikament verschrieben. Ich kann mich nicht erinnern, wie es hieß. Ich weiß nur, dass ich mich sehr aufgeregt habe, als mir der Apotheker das Mittel gegeben hat.«
»Warum haben Sie sich aufgeregt?«
»Weil auf der Packung eine andere Bezeichnung stand«, sagte Daniel und malte mit dem Finger kleine Kreise auf die Tischplatte. »Ich habe mich sogar mit dem Apotheker gestritten, weil ich glaubte, er hätte versehentlich mein Rezept mit dem eines anderen Patienten vertauscht. Er hat mich abgewimmelt und behauptet, es handele sich um ein Generikum und habe deshalb einen anderen Namen.«
»Wie hat das Medikament bei Ihnen gewirkt?«
»Alles ist den Bach runtergegangen«, sagte Daniel mit Tränen in den Augen. »Bevor ich das neue Medikament genommen hatte, war ich in der Schule wirklich gut. Und dann hatte ich wieder Probleme. Als ich den Arzt anrief und es ihm sagte, meinte er, ich solle die Dosis verdoppeln. Doch daraufhin wurde alles noch schlimmer.«
Der entscheidende Punkt ist nicht, dachte Carolyn, dass entweder der Psychiater oder der Apotheker einen schwerwiegenden Fehler gemacht haben, sondern dass eine Person, die von dem Geschehen irgendwie betroffen war, diese Information dem Gericht verschwiegen hatte.
»Wissen Sie noch den Namen dieser Apotheke?«, fragte Carolyn deshalb.
»O’Malleys«, sagte Daniel. »Aber der Laden existiert nicht mehr. Ich bin heute mit dem Bus daran vorbeigefahren. Anstelle des Drugstores steht dort jetzt ein neues Shoppingcenter. Alle Drugstores gehören jetzt Ladenketten. O’Malleys war noch ein Familienunternehmen.«
»Ja«, sagte Carolyn, traurig darüber, wie sehr die Welt sich geändert hatte. »Warum hat der Arzt Ihre Medikation überhaupt geändert?«
»Weil ich drei Monate später meine Abschlussprüfung machen sollte«, sagte Daniel und blinzelte ein paar Mal, während er weiter mit dem Finger Kreise auf die Tischplatte malte. »Stress kann einen Anfall auslösen. Entschuldigen Sie bitte, aber darüber zu sprechen, regt mich auf.«
Weil Carolyn jedoch allmählich eine Ahnung von Daniels Krankheitsbild bekam, bohrte sie unbeirrt – wenn auch etwas rücksichtslos – weiter, denn jetzt wollte sie Fakten haben.
»Waren Sie während eines akuten Anfalls je gewalttätig?«, fragte sie.
»Nein, nie«, sagte Daniel. »Zwar bin ich nackt durch die Gegend geirrt und habe andere bizarre Sachen gemacht. Aber ich bin nie gewalttätig geworden. Ich habe mich nicht einmal im Gefängnis gewehrt, als meine Mithäftlinge hinter mir her waren.«
»Konzentrieren wir uns jetzt bitte auf den Tatabend«, bat Carolyn. »Können Sie sich überhaupt an die drei Jungs erinnern?«
»Bewusst gesehen habe ich sie erst im Gerichtssaal«, sagte Daniel und presste seine Hände fest zusammen. »Es war dunkel, als sie mich angegriffen haben. Ihre Gesichter habe ich nicht erkennen können. Vorher war ich in der Bibliothek.«
»Die Tat ist in der kleinen Gasse hinter Rudy’s Bowlingbahn geschehen«, sagte Carolyn. »Was hatten Sie dort zu suchen?«
»Der Weg war eine Abkürzung von der Bibliothek nach Hause. Ich musste mich beeilen, sonst hätte mich meine Mutter wieder angeschrien. Sie hat mich behandelt, als wäre ich ...«
»Konzentrieren Sie sich bitte, Daniel«, unterbrach Carolyn ihn. »Sie müssen mir erzählen, was damals wirklich passiert ist.«
»Ich habe diese drei großen Kerle an der Hintertür der Bowlingbahn stehen sehen. Mir sind immer wieder Bücher aus der Hand gefallen, weil mein Bücherriemen gerissen war. Ein paar davon waren Fachbücher und die anderen hatte ich in der Bibliothek ausgeliehen. Jedes Mal, wenn ich mich gebückt habe, um ein Buch aufzuheben, hat es einer der Jungs weggetreten. Ich habe mich schrecklich aufgeregt. In der Dunkelheit habe ich nicht einmal die Hälfte der Bücher aufsammeln können. Ich wollte doch nicht, dass meine Mutter die teuren Bücher ersetzen muss.«
»Sprechen Sie weiter«, sagte Carolyn und fragte sich, wie groß seine Wut an jenem Abend gewesen sein musste. Bestimmt hätten sich die Geschworenen bei seinem Prozess dieselbe Frage gestellt. Aus diesem Grund hatte ihn sein Pflichtverteidiger wohl nicht vor Gericht aussagen lassen. »Woran erinnern Sie sich sonst noch?«
»Ich bin gestolpert und auf den Bauch gefallen«, sagte Daniel und wieder flatterten seine Lider. »Die Typen haben mich ausgelacht und beschimpft. Als ich aufstehen wollte, haben sie angefangen, mich zu schlagen. Einer von ihnen, ein Schwarzer, hat mich auf den Rücken gerollt und mich gezwungen, den Mund aufzumachen. Danach wird alles ziemlich verschwommen. Als Letztes kann ich mich daran erinnern, dass mir einer der Kerle in den Mund gepisst hat.«
Carolyn stützte ihren Kopf in die Hände. Wenn Daniels Bericht stimmte, war in seinem Fall die Gerechtigkeit verhöhnt worden. Er hatte dreiundzwanzig Jahre im Gefängnis gesessen, während die drei widerlichen Schläger, die ihn verprügelt und gedemütigt hatten, ungeschoren davongekommen waren. Sie korrigierte sich, denn Tim Harrison, der Sohn des Chiefs, hatte sein Leben verloren.
»Haben Sie Tim Harrison absichtlich vor ein Auto gestoßen?«
»Nein«, sagte Daniel und ging im Zimmer auf und ab, während er noch einmal diesen verhängnisvollen Abend durchlebte. »Nachdem die drei angefangen hatten, auf mich einzudreschen, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich erst wieder kurz bevor Tim überfahren wurde, auf die Beine gekommen bin. Mittlerweile hatte ich mir eingeredet, das alles sei eine Wahnvorstellung. Warum sollte ich mich gegen Menschen wehren, die gar nicht existierten?«
»Wo waren Sie, als Tim getötet wurde?«
»Als die drei anfingen zu streiten«, sagte Daniel und verschränkte die Arme vor der Brust, »bin ich in eine Ecke gekrochen und habe mich hinter einer Mülltonne versteckt. Ich war ziemlich übel zugerichtet. Und dort saß ich noch, als die Polizei mich festgenommen hat. Einer der Jungs hat geschworen, ich hätte sie mit einem Messer bedroht. Aber die Polizei hat kein Messer gefunden. Meine Mutter hätte niemals zugelassen, dass ich mit einem Messer – und wäre es auch nur ein Taschenmesser gewesen – aus dem Haus gehe.« Er lächelte kurz. »Mit den Problemen, die ich hatte, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, ein Messer mitzunehmen.«
»Haben die Jungs gestritten bevor oder nachdem Tim von dem Auto angefahren wurde?«
»Vorher«, entgegnete Daniel. »Einer ist stocksauer geworden. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, es war Tim Harrison. Er hat dauernd von seinem Vater geredet, und dass seine Freunde mich nicht hätten schlagen dürfen, dass sie alle aus dem Football-Team rausgeschmissen würden und dass sein Vater ihn windelweich prügeln werde.«
»Haben Sie gesehen, wie Tim angefahren wurde?«
»Ich bin mir nicht sicher«, sagte Daniel, blieb vor Carolyn stehen und holte tief Luft. »Wenn man glaubt, dass etwas nicht wirklich ist, versucht man, es so wenig wie möglich zur Kenntnis zu nehmen.«
»Erzählen Sie mir genau, was Sie gehört haben«, sagte Carolyn, den Kugelschreiber gezückt und bereit, jedes Wort auf ihrem Notizblock festzuhalten.
»Genaue Angaben kann ich nicht machen«, sagte Daniel. »Wir reden von einer Tat, die vor dreiundzwanzig Jahren geschehen ist, und von einem Gehirn, das nicht richtig funktioniert hat. Ich kann Ihnen nur erzählen, was ich glaube gehört zu haben. Wollen Sie das wirklich wissen? Als ich meinem Anwalt den Tathergang geschildert habe, hat er mir gesagt, dass alles, was ich gesehen oder gehört hätte, grundsätzlich wertlos sei. Deshalb hat er mich vor Gericht nicht aussagen lassen.«
»Ich weiß, dass Sie nicht ausgesagt haben«, entgegnete Carolyn. »Aber ich bin nicht Ihr Anwalt, Daniel. Und Tims Tod war keine Wahnvorstellung.«
»Also gut«, brauste er auf. »Ich habe Motorengeräusch, quietschende Reifen und Geschrei gehört. Und dann saß ich auch schon im Gefängnis.« Mit verbittertem Gesicht ließ er sich auf einen Stuhl plumpsen. »Was für einen Unterschied macht es schon, ob ich schuldig oder unschuldig war? All die Jahre habe ich gesessen.«
Carolyn wusste, dass für viele Menschen die Komplexität des Strafrechtsystems nahezu unverständlich war, deshalb sagte sie: »Ihr Urteil lautete zwölf Jahre bis lebenslänglich. Sie sind nur auf Bewährung frei und könnten also bis zu Ihrem Tod wieder ins Gefängnis gesteckt werden.«
Da schrillte das Telefon und Carolyn schrak zusammen. Sofort reagierte sie instinktiv. Als Daniel zum Nachttisch ging, um den Hörer abzunehmen, schweifte ihr Blick durchs Zimmer. An der Decke entdeckte sie Drähte. Zwei FBI-Agenten waren vor kurzem getötet worden, als sie ein Zimmer betreten hatten, in dem eine Bombe versteckt war.
»Gehen Sie nicht ran!«, rief sie Daniel zu.
»Warum nicht?«
»Wem haben Sie Ihre Telefonnummer gegeben?«
»Nur Ihnen«, sagte er und nahm den Hörer ab. »Wahrscheinlich hat sich jemand verwählt.«
Carolyn riss ihm den Hörer aus der Hand und ließ sich neben dem Nachttisch zu Boden fallen. Dort entdeckte sie nahe am Telefonkabel noch einen dicken schwarzen Draht und fragte sich kurz, ob es sich dabei um ein Modemkabel handelte. Was immer es auch sein mochte, sie würde keine Zeit damit vergeuden, das herauszufinden.
»Wir müssen hier raus!«, schrie sie, rappelte sich auf, packte Daniel am Hemd und zerrte ihn hinter sich her. »Schnell! Das könnte eine Falle sein. Mit dem Anruf wollte sich jemand vergewissern, ob Sie in Ihrem Zimmer sind.«
»Meine Unterlagen«, rief Daniel und streckte seine Hände danach aus.
»Kommen Sie! Wir haben keine Zeit zu verlieren«, rief Carolyn, schon in der offenen Tür.
Sie schafften es nur ein paar Meter den Korridor entlang, als sie die Explosion hörten. Sofort schlugen Flammen aus dem Hotelfenster. Die Wucht der Detonation schleuderte beide zu Boden. Der Gang bebte wie bei einem Erdbeben.
»Sind Sie verletzt?«, rief Carolyn.
»Ich glaube nicht«, sagte Daniel und blickte in Richtung seines Zimmers.
»Wir müssen die Treppe runter, ehe das Gebäude einstürzt. Da«, rief sie, zerriss ihre Baumwollbluse und gab ihm einen Stofffetzen. »Bedecken Sie damit Mund und Nase und bleiben Sie so dicht wie möglich am Boden.«
Während Glassplitter durch die Luft flogen und Rauchschwaden durch den Flur quollen, krochen Carolyn und Daniel so schnell wie möglich zur Treppe. Der Qualm war so dicht, dass sie nichts sehen konnte. Ihre Arme und Knie waren aufgeschürft und bluteten. Sie hörte Daniel hinter sich husten und keuchend nach Luft ringen. Es gab noch eine Explosion und sie hatte Angst, der Gang des dritten Stocks könnte auf sie herabstürzen.
In der Ferne hörte Carolyn Sirenen. Sie konnte nicht warten, bis die Feuerwehr eintraf. Mit ausgestrecktem rechtem Arm tastete sie über den Boden und spürte endlich den Treppenabsatz. Sie griff hinter sich und packte Daniels Hand. »Drehen Sie sich um!«, schrie sie. »Wir müssen rückwärts runterkriechen.«
»Ich ... ich ... kriege keine Luft mehr«, keuchte Daniel und rollte sich auf den Rücken.
Carolyn setzte sich rittlings auf ihn, hob seinen Arm und ließ ihn wieder fallen. Keine Reaktion. Daniel war ohnmächtig geworden. Mit den Fingern öffnete sie seinen Mund, holte tief Luft und unterdrückte ein Husten. Wenn sie zu viel Rauch einatmete, würden sie beide sterben. Dann hielt sie ihm die Nase zu, presste ihren Mund auf seinen und pustete so stark sie konnte. Als er nicht reagierte, hob sie abrupt den Kopf und blickte in Richtung Treppe. John und Rebeccas Gesichter blitzten vor ihrem geistigen Auge auf. Ihre Kinder brauchten sie. Was hätte es für einen Sinn, wenn sie beide starben?
Sie musste sich entscheiden.
Noch einmal holte Carolyn tief Luft und blies sie in Daniels Lungen. Ihr war schwindelig vor Sauerstoffmangel und ihre Augen brannten und tränten. Als sie Daniel husten hörte, packte sie sein linkes Bein und zerrte ihn hinter sich her die Treppe hinunter, bis er anfing sich zu bewegen und allein weiterkroch. Als sie es bis nach unten geschafft hatten, kamen auch die Feuerwehr und die Rettungswagen. Carolyn brach mit dem Gesicht nach unten auf dem Rasen neben dem Parkplatz zusammen.
Sie hörte Männerstimmen Befehle bellen und spürte, dass jemand sie auf den Rücken drehte. Als der Sanitäter ihr die Sauerstoffmaske aufs Gesicht stülpte, öffnete sie die Augen.
»Bringt eine Trage rüber«, rief der Sanitäter. »Hier liegt noch ein Opfer.«
Carolyn riss sich die Maske vom Gesicht und flüsterte: »Ein Mann war bei mir.« Ihre Kehle war so ausgedörrt, dass sie kaum sprechen konnte.
»Ihrem Freund wird es bald wieder gut gehen«, sagte der Sanitäter und riss eine sterile Packung mit einer Infusionsnadel auf. »Ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze in den Arm. Versuchen Sie, sich zu entspannen und normal zu atmen.«
Carolyn schloss die Augen. Ein paar Augenblicke später fiel ihr Kopf zur Seite. Es wurde ganz still, als sie in einem dunklen Nebel versank.