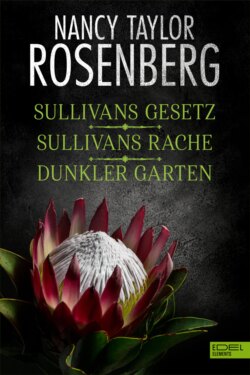Читать книгу Sullivans Gesetz/ Sullivans Rache/ Dunkler Garten - Nancy Taylor Rosenberg - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 8
ОглавлениеDaniel Metroix hockte in der Ecke einer Zelle des Ventura-County-Gefängnisses. Heute war Mittwoch und er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen.
Zwar konnte er sich an die Explosion, das Krankenhaus und die Polizisten erinnern, aber er wusste nicht, ob alle die Ereignisse auch wirklich geschehen waren. Jetzt brauchte er dringend seine Spritze, denn die Stimmen in seinem Kopf hallten wie ein dämonischer Chor wider.
Er hatte eine Vision: seine Mutter. Ruth Metroix war eine schwergewichtige Frau mit dunklem, krausem Haar und Beinen wie Baumstümpfe. Sie trug ihren alten, rosa Morgenmantel aus Satin.
»Mein Schatz, mein Baby«, sagte die Erscheinung. »Was hast du denn jetzt schon wieder getan?«
»Gar nichts! Ich habe gar nichts getan!«, rief Daniel, verwirrt und zornig zugleich.
Er starrte auf die Gitterstäbe und wurde von Erinnerungen überwältigt. Da schloss er die Augen und trat eine Zeitreise in seine Vergangenheit an. Jetzt war er wieder in seinem Zimmer, in den Carlton West-Apartments.
In der kleinen Küche läutete das Telefon. Daniel hörte, wie seine Mutter mit dem Psychiater sprach.
»Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie zu Hause störe, Dr. Gershon«, sagte Ruth Metroix. »Daniel geht es gar nicht gut. Schon seit zwei Tagen hat er sein Zimmer nicht mehr verlassen. Ich wollte die Tür öffnen, aber er muss sie mit irgendetwas blockiert haben. Er isst nicht. Er geht nicht zur Schule.«
Sie schwieg und hörte zu.
»Wie soll ich wissen, ob er seine Medikamente nimmt? Warten Sie bitte. Ich will versuchen, ihn zu bewegen, mit Ihnen zu reden. Bitte, Schatz!«, rief sie. »Komm her und sprich mit Dr. Gershon. Er ist am Telefon.«
Daniel reagierte nicht und er hörte ihre schweren Schritte auf dem Holzfußboden.
»Wenn du nicht aus deinem Zimmer kommst, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Polizei zu bitten, die Tür aufzubrechen. Und dann stecken sie dich wieder in eine Anstalt.«
Daniel schob die schwere Kommode beiseite, die er vor die Tür gerückt hatte, und öffnete.
»Warum tust du mir das an?«, fragte er. »Ich bereite mich auf mein Examen nächste Woche vor.«
»Aber du musst doch zur Schule gehen«, wandte seine Mutter ein.
Daniels Hände zitterten. Er hatte sich seit fast einer Woche nicht rasiert und sein Zimmer roch nach seinem ungewaschenen Körper.
»Komm in die Küche und rede mit Dr. Gershon«, bat Ruth und streckte bittend die Hand nach ihm aus. »Wenn du das für mich tust, dann verspreche ich dir, dich in Ruhe zu lassen.«
Nur zögernd gab Daniel der Bitte seiner Mutter nach.
Als sie ihren Sohn mit dem Arzt sprechen hörte, ging sie sofort in sein Zimmer.
»Geh da raus!«, rief Daniel, lief über den Flur und stieß sie beiseite.
Ruth deutete auf die Fotos, die Daniel an der Fußleiste einer Wand aufgereiht hatte. Schnappschüsse von Daniel als Kleinkind oder auf seinem Fahrrad vor dem Mietshaus. Bilder von Tanten, Onkeln, Cousins und Cousinen.
»Was machst du da? Was soll das? Warum hast du die Fotos aus deinem Album genommen?«
Er starrte sie an, antwortete nicht.
»Willst du mir nicht sagen, was Dr. Gershon dir geraten hat?«
»Er sagte, ich solle meine Dosis erhöhen«, antwortete Daniel. »Gehst du jetzt bitte aus meinem Zimmer, damit ich lernen kann?«
»Will er dich denn nicht sehen?«
»Dr. Gershon macht zwei Wochen Urlaub«, murmelte Daniel. »Ich habe einen Termin bei ihm, wenn er wieder da ist.«
Als Ruth die aufgeschlagene Bibel am Boden entdeckte, war sie entsetzt. Denn Dr. Gershon hatte ihr geraten, alle religiösen Bücher sowie Symbole aus der Wohnung zu entfernen, sogar das Kruzifix über seinem Bett, das während seiner Kindheit dort gehangen hatte – und das, obwohl sie eine gläubige Frau war.
Daniel konnte sich genau erinnern, wann der Albtraum begonnen hatte, aber er wusste nicht, warum das geschehen war. Anlässlich einer Tanzveranstaltung in der Schule hatte er dem unerklärlichen Zwang nachgegeben, Gracie Hildago im Wasserspeicher der Stadt zu taufen. Ohne zu wissen, was er tat, hatte er ihren Kopf so lange unter Wasser gehalten, dass die Arme fast ertrunken wäre. Daraufhin hatte er das nächste Vierteljahr im Camarillo State Mental Hospital verbracht, in einer Anstalt, in der die Insassen ganz legal gefoltert werden durften.
Ruth bückte sich zu der Bibel hinunter, doch Daniel entriss sie ihr und drängte sie aus dem Zimmer, wobei er ihr die Tür ins Gesicht schlug. Um sicher zu sein, dass sie nicht wieder hereinkommen könnte, schob er die Kommode davor.
»Idiot«, sagte die Stimme in seinem Kopf, »wenn du dich weiter so benimmst, wirst du nie dein Examen machen. Schon im Juni wirst du tot sein. Tot und begraben.«
»Nein!«, sagte Daniel und hielt sich die Ohren zu. »Ich höre dir nicht mehr zu. Du existierst nur in meiner Fantasie.«
Er ließ sich auf die Knie fallen, kroch durchs Zimmer und starrte die Fotos an. Er musste wissen, wer er war. Irgendwie musste es ihm gelingen, den Bezug zur Realität nicht zu verlieren. Dr. Gershon hatte ihm gesagt, er solle die Dosis seines Medikaments erhöhen. Das hatte er schon vor ein paar Tagen getan, doch die Symptome waren nur schlimmer geworden. Morgen würde er drei Tabletten statt zwei nehmen.
Aber er brauchte Fachbücher aus der Bibliothek. Denn für das Fach Naturwissenschaften hatte er eine Anlage zur Reinigung von Wasser konzipiert, von der sein Lehrer begeistert war. Aber seine Mutter bestand darauf, dass er nach der Schule direkt nach Hause kam. Seine Mutter behandelte ihn wegen seiner Krankheit noch immer wie ein Kind, obwohl er schon siebzehn war.
Da fiel ihm ein, dass sie ihm gesagt hatte, sie werde am nächsten Tag erst spät heimkommen, weil seine Großmutter krank war und sie zum Arzt gefahren werden müsse. Also beschloss er, die Gelegenheit zu nutzen und dann die nötigen Bücher aus der Bibliothek zu holen. Er arbeitete auch gern dort im Lesesaal, denn die vielen Bücher gaben ihm ein Gefühl der Sicherheit.
»Wenn du aus der Wohnung gehst, kriegen sie dich«, flüsterte eine der Stimmen. »Sie warten auf dich. Für sie bist du nichts als ein Stück Dreck.«
Tränen rannen ihm übers Gesicht. Warum ließen die Stimmen ihn nicht in Ruhe? Warum beschimpften sie ihn ständig? Hatten die Ärzte denn kein Mittel, die Stimmen zum Verstummen zu bringen? Wäre die Amputation eines Arms ein effizientes Mittel dagegen gewesen, er hätte sich eine Kettensäge gekauft.
Nach Reichtum strebte er nicht. Er hatte bereits jede Hoffnung aufgegeben, eines Tages zu heiraten und Kinder zu haben. Und selbst wenn er die Gelegenheit gehabt hätte, mit einem Mädchen zu schlafen, so war das wegen seiner Medikamente unmöglich. Jetzt wünschte er sich nur noch, ein Leben so normal wie möglich zu leben, jeden Morgen aufzustehen und zur Arbeit zu gehen und etwas Produktives zu tun.
Daniel hämmerte mit den Fäusten auf den Boden.
»Oh, mein Gott, ist das zu viel verlangt?«, jammerte er. »Muss ich denn so sehr leiden? Gibt es keinen Weg aus dieser Misere? Warum bestrafst du mich?«
»Was weißt du schon von Gott, du Muttersöhnchen? Wenn du bis morgen wartest, kannst du ihm begegnen. Dann bist du nämlich tot, du widerliches Arschloch. Dann stecken sie dich wieder in eine Gummizelle. Und das ist doch so ähnlich wie der Tod, oder nicht?«
Mit zitternden Händen blätterte Daniel in der Bibel und zitierte einzelne Stellen laut. Die rot markierten Stellen des Neuen Testaments verschwammen vor seinen Augen und wurden dann zu Strömen von Blut. Seinem Blut. Teufelsblut. Bösem Blut.
Er ging zum Schrank und tastete nach dem großen Bowie-Messer im obersten Fach. Dann legte er es mitten ins Zimmer. Das Messer fing langsam an sich zu drehen. Er hielt den Atem an, denn er hörte, wie es zu ihm sprach. Zischend, wie eine Schlange.
»Nimm mich, du Versager. Du willst doch eine Antwort auf deine Probleme, oder? Ich bin die Antwort. Nimm mich und schneide dir die Pulsadern auf. Dann hat alles ein Ende.«
Daniel presste die Daumen auf seine Lider, damit die Halluzinationen aufhörten.
»Du weißt, dass es nur einen Ausweg gibt. Du musst nur das Messer nehmen. Vielleicht solltest du dir lieber die Kehle durchschneiden. Auf diese Weise stirbst du schneller.«
»Oh, mein Gott, hilf mir!«, stammelte er und presste die Hände im Gebet aneinander. Er hatte das Gefühl, in der Hölle zu sein. Die Konturen der Möbel verschwammen zu abstrakten braunen Flecken. Die Wände seines Zimmers kamen auf ihn zu: Plötzlich war er gefangen. Gefangen in einer kleinen Schachtel. Er verschluckte sich an seinem Speichel und rang nach Luft. Da packte er das Messer, ohne zu denken, und setzte es sich direkt an die Kehle, an die Halsschlagader.
Eine Brise durchs geöffnete Fenster irritierte ihn. Der leichte Wind blätterte die Seiten der Bibel um. Fasziniert starrte er auf die aufgeschlagenen Seiten.
Gott hatte ihm eine Botschaft gesandt.
Daniel las aus dem Buch Prediger, Kapitel 4, Vers 10 und 12: »Fällt ihrer einer, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist! Wenn er fällt, so ist kein anderer da, der ihm aufhelfe ... Einer mag überwältigt werden, aber zwei mögen widerstehen und eine dreifältige Schnur reißt nicht leicht entzwei.«
Daniel riss die Augen auf, als er hörte, wie der Gefängniswärter seine Zelle aufschloss. Der unbekannte Weisheitslehrer des Alten Testaments hatte Recht gehabt. Diese drei entsetzlichen Rowdys hatten ihm in der Gasse aufgelauert.
»Steh auf!«, befahl ihm der bullige Mann. »Du wirst in eine andere Zelle verlegt.«
Daniel gehorchte; er verbannte die Vergangenheit aus seinen Gedanken. Warum war er im Gefängnis? Seine ganze Arbeit war vernichtet worden. Hatte er jetzt noch einen Grund, am Leben festhalten zu wollen? Wieder war er in diesen Abgrund gestürzt.
Als er sich nicht rührte, ging der Wärter in die Zelle und packte ihn grob.
»Beweg deinen Arsch, Metroix!«, bellte er. »Bist du taub?«
Nachdem sich Carolyn drei Tassen Pulverkaffee und zwei Schüsseln Frühstücksflocken gegönnt hatte, zog sie Jeans und ein T-Shirt an und machte sich auf den Weg zur Bank. Wenn sie eine neue Karte für den Geldautomaten beantragt und etwas Bargeld abgehoben hatte, wollte sie ins Gefängnis gehen. Daniel würde sicher erst morgen freigelassen werden, da sich die beiden Behörden uneins waren; und sie konnte sich gut vorstellen, wie er sich fühlen musste. Erst seit zwei Wochen entlassen und jetzt schon wieder hinter Gittern. Und sein Lebenswerk vernichtet. Letzteres machte ihm sicher mehr zu schaffen.
Sie nahm ihre Wagenschlüssel und eine alte braune Handtasche und trat aus der Tür. Als sie ihren Wagen in der Auffahrt sah, blieb sie abrupt stehen.
Die Windschutzscheibe und das Heckfenster ihres Infinity waren zerschmettert und fast die ganze Karosserie war zerbeult. Carolyn fragte sich kurz, ob ihr Auto von den umherfliegenden Trümmern der Explosion so demoliert worden sei, verwarf den Gedanken aber sofort, da John es dann nicht hätte nach Hause fahren können. Außerdem hätte er ihr davon berichtet.
Als sie den Schaden näher begutachten wolle, entdeckte sie zwischen den Resten der Windschutzscheibe und einem Scheibenwischer ein Stück Karton. In der Hoffnung, man würde Fingerabdrücke darauf finden, nahm sie es mit spitzen Fingern. Darauf stand in fetten, mit Filzstift geschriebenen Blockbuchstaben: »METROIX IST EIN MÖRDER. MÖRDER HABEN KEINE ZUKUNFT. WENN SIE IHM HELFEN, WERDEN SIE MIT IHM STERBEN.«
Carolyn fror plötzlich, obwohl die Mittagssonne warm schien. Sie hatte das Gefühl, eine dunkle Wolke würde sie verdecken. Noch immer fassungslos, starrte sie die bedrohlichen Lettern an. Denn nicht nur ihr eigenes Leben, auch das ihrer Kinder war in Gefahr.
Die meisten Nachbarn arbeiteten tagsüber und die Kinder waren bis zum Abend in der Schule. Warum hatte sie nichts gehört? Der Täter musste sein Zerstörungswerk nach acht Uhr begangen haben, nachdem John und Rebecca aus dem Haus gegangen waren. Und er hätte es getan haben können, als sie unter der Dusche stand, im rückwärtigen Teil des Hauses.
Carolyn nahm den Karton mit ins Haus und steckte ihn in der Küche in einen Frischhaltebeutel. Sie setzte sich an den Tisch und versuchte zu überlegen, was sie als Nächstes tun sollte.
Sie musste die Polizei benachrichtigen. Wenn sie das nicht tat, würde ihre Versicherung nicht für den Schaden aufkommen. Aber sie hatte ein Problem: Sie wusste nicht, ob sie Hank Sawyer trauen konnte. Oder anderen Polizeibeamten in Ventura, deren Chef früher einmal Charles Harrison gewesen war. Doch sie hatte keine andere Wahl.
Nachdem sie die Polizei informiert hatte, rief sie ihren Bruder an.
»Neil«, sagte sie, nachdem er sich mit verschlafener Stimme gemeldet hatte. »Du musst mir deinen Van leihen.«
»Wie spät ist es?«
»Nach Mittag«, antwortete Carolyn. »John hat versucht, dich gestern Abend zu erreichen, aber du hattest deine Telefone bereits abgestellt. Ich wurde bei einer Explosion leicht verletzt. Und heute Morgen hat mir jemand mein Auto zertrümmert. Außerdem werde ich mit dem Tod bedroht.«
Sie hörte, wie Neil mit jemandem flüsterte und vermutete, es war das Model mit dem Gesicht und dem Körper eines Engels.
»Ich leihe mir Melodys Auto und komme gleich zu dir«, sagte er. »Du kannst meinen Van nicht haben, denn alle meine Bilder für die Vernissage liegen darin. Ich muss die Dinger heute Nachmittag in der Galerie abliefern.«
»Dann bin ich völlig aufgeschmissen«, jammerte Carolyn, mit ihren Nerven am Ende. »Ich brauche einen fahrbaren Untersatz. Und deine Freundin wird mir ihr Auto doch sicher nicht eine ganze Woche leihen, oder? Denn die Polizei wird den Infinity bestimmt erst abschleppen und nach Spuren untersuchen und dann muss ich ihn reparieren lassen.«
»Kannst du nicht einen Wagen von deiner Dienststelle fahren?«
»Das sind die reinsten Schrotthaufen, Neil«, entgegnete sie. »Beim letzten Auto, das ich fuhr, versagten die Bremsen. Ich wurde fast durch die Windschutzscheibe geschleudert und musste zwei Tage ins Krankenhaus. Kannst du dich nicht erinnern?«
»Melody bleibt den ganzen Nachmittag hier«, sagte Neil. »Wir bereden das, wenn ich bei dir bin. Beruhige dich, Schwesterchen. Du überforderst mich gerade mit dem ganzen Mist, denn ich bin noch nicht mal richtig wach. Koch mir einen starken Kaffee.«
»Ich habe die Kaffeekanne kaputtgemacht.«
»Das auch noch«, stöhnte er. »Also, vergiss es. Bis gleich.«
Carolyn sah, dass zwei Streifenwagen und der schwarze Ford Crown Victoria – ein Zivilfahrzeug der Polizei – mit Hank Sawyer am Steuer vorfuhren. Sie ging nach draußen, um mit den Männern zu reden.
Während die Leute von der Spurensicherung Fotos machten und ein Officer seinen Bericht schrieb, gingen Carolyn und Hank auf die andere Seite des Gartens, damit sie in Ruhe miteinander reden konnten. Sie lehnte sich an den Stamm der großen Trauerweide und sah Hank an.
»Jetzt haben Sie Ihre Meinung hoffentlich geändert«, sagte er und deutete mit dem Kopf in Richtung der Beamten. »Offensichtlich hat Metroix gegen die Bewährungsauflagen verstoßen. Habe ich Ihnen nicht schon gestern Nacht erzählt, dass Sie auf der falschen Seite stehen?«
Carolyns Schock hatte sich in Zorn verwandelt. »Vielleicht haben Sie ja die Nachricht geschrieben und einen Ihrer Männer mit einem Vorschlaghammer zu mir geschickt«, sagte sie böse und sah den Detective aus schmalen Augen an.
Hank lachte sarkastisch. »Na, hören Sie mal«, sagte er und wurde wieder ernst. »Auch wenn ich, was Metroix betrifft, nicht mit Ihnen übereinstimme, so bedrohe ich niemanden, noch schicke ich meine Leute los, um Privateigentum zu zerstören. Ich weiß ja, dass Ihnen schwer zugesetzt wurde, aber da liegen sie wirklich schief.«
»Wie sollte Metroix denn das getan haben? Schließlich sitzt er im Knast.«
»Wahrscheinlich hat er einen Kumpel, wie ich schon gestern vermutete. Wir überprüfen das. Solche Typen arbeiten oft zu zweit, wenn sie entlassen werden.«
Obwohl sich Polizisten und Bewährungshelfer im selben Milieu bewegen, ist ihre Sicht der Dinge oft ganz anders.
»Wann haben Sie zum letzten Mal ein Gefängnis von innen gesehen?«, fragte Carolyn. »Ich schätze mal, dass in Chino am Entlassungstag von Metroix noch fünfzig weitere Häftlinge auf freien Fuß gesetzt wurden. Und alle sind scharf darauf, diese Jungs wieder einzusperren. Aber keiner macht sich darüber Gedanken, wo sie einsitzen sollen. Die Hälfte der Gefängnisse in diesem Staat ist so überfüllt, dass gezwungenermaßen Gefangene vorzeitig entlassen werden müssen. Das ganze Prozedere ist nichts als eine Farce, es gleicht einer Drehtür.«
»Aber Metroix hat jahrelang im Knast gesessen«, wandte Hank ein, wickelte einen Zahnstocher aus und steckte ihn sich zwischen die Zähne. »Er hatte Zeit genug, Freundschaften zu schließen. Eine ganze Gang könnte hinter ihm stehen.«
Carolyn verschränkte die Arme vor der Brust. Nur mühsam konnte sie ihren Zorn im Zaum halten. Aus den Augenwinkeln sah sie einen Mann am Straßenrand stehen. Zuerst dachte sie, es sei Neil, doch so schnell konnte ihr Bruder noch nicht hier sein.
Sie starrte den Mann an. Er war etwa ein Meter achtzig groß und schlank, hatte ergrauendes, lockiges Haar und trug ein weißes Hemd und graue Hosen. Als er näher kam, sah sie, dass seine Augen hellblau waren und sein Teint ziemlich hell. Das musste Professor Leighton sein, der von ihrem Sohn so geschätzte Lehrer.
Warum unterrichtet er nicht?, fragte sie sich. Und mehr noch: Warum hat er ein Haus in Ventura gekauft, wenn er an dem Caltech in Pasadena Vorlesungen hält, das doch zwei Autostunden von hier entfernt ist?
Carolyn beugte sich vor und sah Hank in die Augen. »Metroix hat dreiundzwanzig Jahre sitzen müssen, weil jemand dafür gesorgt hat«, sagte sie wütend. »Sie reden Unsinn, Hank. Und Sie wissen genau, was hier gespielt wird. Es könnte doch gut sein, dass Charles Harrison mir seine Handlanger auf den Hals gehetzt hat, als er erfuhr, dass ich Metroix nicht wieder in den Knast stecken wollte. Nur, um mir Angst zu machen, damit ich spure.«
»Beweise, Carolyn«, sagte der Detective. »Ohne Beweise können Sie niemanden beschuldigen. Und schließlich wird Harrison in dieser Stadt respektiert.«
»Anfangs hatte ich auch Zweifel, was Metroix betrifft«, sagte Carolyn. Sie beschloss, Hank nichts von ihrem Telefonat mit dem Gefängnisdirektor zu erzählen, bis sie weitere Nachforschungen angestellt hatte. »Doch da sich die Lage jetzt derart zugespitzt hat, bin ich davon überzeugt, dass Metroix reingelegt wurde. Decken Sie und die gesamte Polizei vielleicht Harrison, Hank? Ich glaube immer mehr, dass Sie das tun. Und dann richten Sie Harrison bitte etwas von mir aus, okay? Sagen Sie ihm, dass sich jeder, der noch einmal ungebeten seinen Fuß auf mein Grundstück setzt, auf etwas gefasst machen kann.«
»Sie müssen Carolyn Sullivan sein«, hörte sie da eine Stimme hinter sich und drehte sich um. Der Fremde stand vor ihr und streckte seine Hand aus. »Ich bin Paul Leighton. Ihr Sohn ...«
»Nett, Sie kennen zu lernen«, unterbrach Carolyn den Professor schnell. Sie wollte nicht, dass der Detective John mit in das Geschehene einbezog. An Hank gewandt, sagte sie: »Entschuldigen Sie uns bitte. Es dauert nicht lange.«
»Was soll das?«, fragte der Detective. »Vielleicht hat der Mann gesehen, wer Ihren Wagen demoliert hat. Und jetzt wollen Sie mich daran hindern, mit einem möglichen Zeugen zu reden.«
»Tut mir Leid, Officer«, sagte Leighton höflich. »Aber ich habe nichts gesehen. Ich nehme an, dass Sie Polizist sind«, fügte er hinzu und warf einen Blick über die Schulter zu den anderen Männern. »Ja, Sie müssen Detective sein, da Sie keine Uniform tragen. Verzeihen Sie mir, aber in Polizeiangelegenheiten bin ich nicht sehr bewandert.«
»Detective Hank Sawyer«, stellte sich Hank vor und gab dem Professor die Hand. »Wie Sie sehen, Mr. Leighton, ermitteln wir hier wegen schwerer Sachbeschädigung und wären froh, wenn Sie zur Aufklärung beitragen könnten.«
»Gegen zehn Uhr habe ich Lärm gehört«, sagte Leighton, »und dachte, es wäre die Müllabfuhr. Ich weiß nämlich nicht genau, an welchem Tag sie kommt.« Er massierte seine Hand, als hätte Hanks Händedruck ihm wehgetan. »Wenn ich arbeite, vergesse ich alles andere.«
»Ich verstehe«, entgegnete Hank. »Und woran arbeiten Sie?«
»Woran ich arbeite?«, wiederholte Leighton die Frage. Offensichtlich gehörte er nicht zu den gesprächigen Menschen. »Im Moment versuche ich, ein Buch fertig zu schreiben.«
»Sicherlich handelt es sich dabei nicht um einen Krimi«, sagte Hank und lachte.
»O nein«, entgegnete Leighton, ebenfalls lachend. »Ich habe mir ein Jahr frei genommen. Sonst lehre ich Physik an der Uni.«
Allein das Wort Physik hatte genügt, um Hank zum Rückzug zu bewegen. Carolyn begleitete den Professor zur Veranda ihres Hauses. Physiker und Erfinder, normalerweise seltene Exemplare der menschlichen Gattung, tauchten plötzlich in ihrem Leben auf.
»Ich möchte mich noch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich so rührend um John gekümmert haben«, sagte sie, setzte sich in einen der weißen Korbstühle und bat Leighton, ebenfalls Platz zu nehmen. »Sobald es bei uns wieder etwas ruhiger geworden ist, müssen Sie mit Ihrer Tochter zum Abendessen kommen.«
»Oh«, sagte er und setzte sich neben sie. »Das habe ich doch gern getan. Wissen Sie schon, wer Ihren Wagen demoliert hat? Und steht diese Tat in Verbindung mit der Explosion im Motel, oder war das nur ein Akt des reinen Vandalismus?«
»Im Moment weiß das noch niemand«, sagte Carolyn und zuckte mit den Schultern.
»Mir war gar nicht bewusst, dass es hier in der Nachbarschaft Probleme gibt«, sagte er nachdenklich. »Ich habe noch ein Haus in Pasadena, wollte aber von der Uni eine Weile Abstand gewinnen, weil ich dadurch hoffte, mit meiner Arbeit schneller voranzukommen. Denn wenn man sich so lange wie ich in Akademikerkreisen bewegt, neigen die Leute dazu, sich ins Privatleben einzumischen.«
John hat Recht gehabt, dachte Carolyn. Professor Leighton schien ein interessanter und kultivierter Mann zu sein. Und ausgerechnet heute musste sie ihn kennen lernen. Sie schämte sich, weil sie so nachlässig gekleidet war, während er fast elegant wirkte. Ein Mann, der das ganze Gegenteil von Brad Preston war. Vielleicht fand sie ihn deshalb so attraktiv.
»Mein Bruder muss jeden Moment kommen«, sagte sie und fuhr dann fort, als sie beobachtete, wie die Polizei ihr Auto auf einen Tieflader zur kriminaltechnischen Untersuchung lud: »Ich muss mir einen Wagen mieten. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Normalerweise ist das eine sehr ruhige Gegend hier.«
»Sie sind Bewährungshelferin, wie ich erfahren habe«, entgegnete Leighton. »Und das heißt automatisch, dass Sie mit Kriminellen zu tun haben.«
»Mehr oder weniger«, gab Carolyn zu. »Aber bisher haben sie sich noch nie auf meinem Grundstück ausgetobt. Ich hoffe nur, das war das erste und letzte Mal.«
Paul Leighton schwieg. Er schien zu den seltenen Menschen zu gehören, die nicht pausenlos redeten und denen Schweigen auch nicht peinlich war.
»John ist ganz begeistert von Ihnen«, sagte Carolyn. »Er hat Ihnen sicher erzählt, dass er gerne am MIT studieren möchte.«
Der Professor ging nicht auf ihre Bemerkung ein, sondern sagte: »Ich habe einen Zweitwagen. Der steht in der Garage, bis meine Tochter alt genug für den Führerschein ist. Den würde ich Ihnen gerne leihen. Er steht nur da und verstaubt.«
Wie reizend von ihm, mir dieses Angebot zu machen, dachte Carolyn. Aber sie sagte: »Nein, danke. Sie haben schon so viel für mich getan.«
»Ich bitte Sie«, sagte Paul Leighton, jetzt eindringlich. »Lucy war gar nicht glücklich, weil ich sie zu diesem Schulwechsel gezwungen habe. Sie war sogar böse auf mich. Aber Rebecca hat sie gleich so herzlich in ihren Freundeskreis aufgenommen, dass ich nun ein großes Problem weniger habe. Die beiden sind unzertrennlich geworden. Und wie Sie ja wissen, ist es nicht leicht, allein Kinder aufzuziehen. Also sitzen wir beide im selben Boot.«