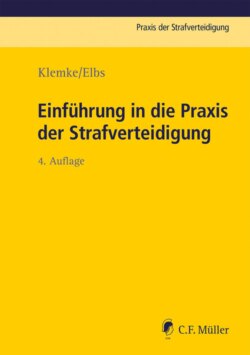Читать книгу Einführung in die Praxis der Strafverteidigung - Olaf Klemke - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11. Die zivilrechtliche Haftung des Strafverteidigers[42]
Оглавление68
Da es sich bei dem Anwaltsvertrag um einen Dienstvertrag „höherer Art“ gem. § 627 BGB handelt, ist der Verteidiger verpflichtet, das Mandat nicht ohne zwingenden Grund zur Unzeit zu kündigen, bspw. wenige Tage vor der Hauptverhandlung. Sonst kann er sich nach § 627 Abs. 2 BGB schadensersatzpflichtig machen.
69
Erfüllt der Verteidiger seine vertraglichen Verpflichtungen aus dem Anwaltsvertrag schlecht, schuldet er seinem Mandanten eventuell Schadensersatz aus § 280 BGB. In der Praxis sind allerdings wenige Fälle bekannt, in denen sich ein Strafverteidiger gegenüber dem Mandanten schadensersatzpflichtig gemacht hat. Soweit ersichtlich, hatten sich Zivilgerichte bisher in den folgenden veröffentlichten Entscheidungen mit Schadensersatzklagen gegen Verteidiger wegen fehlerhafter Mandatsbearbeitung zu befassen:
70
BGH NJW 1964, 2402: Der Verteidiger in einem Bußgeldverfahren hatte die eingetretene Verfolgungsverjährung nicht bereits in der ersten Instanz, sondern erst im Rechtsbeschwerdeverfahren geltend gemacht. Dem Mandanten war deshalb zu Unrecht die Fahrerlaubnis für zwei Monate vorläufig entzogen worden. Eine Amtshaftungsklage gegen das Land wurde unter Hinweis auf die Möglichkeit, den Verteidiger in Anspruch zu nehmen, abgewiesen.
71
Dieser Entscheidung ist entgegenzutreten. Der Verteidiger ist nicht dafür verantwortlich zu machen, dass das Gericht und die Strafverfolgungsbehörden von Amts wegen zu beachtende Verfahrenshindernisse übersehen. Zu einer Ablehnung der Anwaltshaftung in derartigen Fällen tendiert auch das BVerfG. In seinem Nichtannahmebeschluss vom 12.8.2002 hat die 2. Kammer seines 1. Senates die Auffassung des BGH als verfassungsrechtlich bedenklich angesehen, einen Anwalt für eine missverständliche Formulierung in einem zivilprozessualen Vergleich haftbar zu machen, obwohl dieser Fehler bei einem prozessordnungsgemäßen Verhalten des Zivilgerichtes nicht zum Schadenseintritt geführt hätte. Auch wenn eine Amtshaftung des Gerichtes wegen des Richterprivilegs regelmäßig ausscheide, legitimiere dies keine Haftungsverschiebung zu Lasten der Rechtsanwälte. Diese würden hierdurch in ihrem Grundrecht auf Freiheit der Berufsausübung verletzt. Auch als „Organe der Rechtspflege“ haften die Rechtsanwälte nach Ansicht des BVerfG nicht ersatzweise für Fehler der Rechtsprechung, nur weil sie haftpflichtversichert sind. Das Gleiche gelte nach Ansicht des BVerfG, soweit der BGH dem beschwerdeführenden Rechtsanwalt anlaste, das Gericht nicht darauf hingewiesen zu haben, dass dessen Rechtsauffassung falsch sei. Die Gerichte sind verfassungsrechtlich nicht legitimiert, den Rechtsanwälten auf dem Umweg über den Haftungsprozess auch die Verantwortung für die richtige Rechtsanwendung aufzubürden.[43]
72
Im Ergebnis ist der Verteidiger zwar immer noch berufsrechtlich verpflichtet, den Mandanten vor Fehlentscheidungen des Gerichts und der anderen Strafverfolgungsorgane zu schützen. Soweit diese Fehler jedoch Rechtsanwendungsfehler sind, insbesondere auf der mangelnden Beachtung der von Amts wegen zu prüfenden Verfahrensvoraussetzungen beruhen, wird zukünftig zumindest die zivilrechtliche Sanktionierung einer anwaltlichen Pflichtverletzung nicht mehr möglich sein.
73
OLG Düsseldorf StV 1986, 211: Der Verteidiger hatte den Mandanten über die Erfolgsaussichten des Einspruches gegen einen Strafbefehl zu beraten. Er unterließ einen Hinweis darauf, dass das Verschlechterungsverbot bei einem Einspruch gegen den Strafbefehl nicht gilt, § 411 Abs. 4 StPO. Des Weiteren klärte er nicht hinreichend die für die Berechnung der Höhe des Tagessatzes maßgeblichen Einkommensverhältnisse des Mandanten auf. Dies führte zu einer erheblichen Anhebung der Tagessatzhöhe und damit der vom Gericht im Urteil verhängten Geldstrafe. Die Differenz zwischen der im Strafbefehl und der im Urteil ausgeworfenen Geldstrafe habe der Verteidiger dem Mandanten zu erstatten.
74
LG Berlin StV 1991, 310: Der Verteidiger hatte eine Verfahrensrüge, mit welcher er einen absoluten Revisionsgrund geltend machte, nach Auffassung des Revisionsgerichts nicht in zulässiger Weise erhoben. Die Revision wurde verworfen. Das Zivilgericht wies die Schadensersatzklage mangels hinreichender Substantiierung ab. Der Kläger habe nicht dargelegt, dass er zu Unrecht verurteilt worden sei.
75
OLG Nürnberg StV 1997, 481: Ein Ruhestandsbeamter legte im Rahmen einer sog. „Absprache im Strafverfahren“ ein Geständnis ab und wurde absprachegemäß zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Dem Gericht war § 59 Abs. 1 Nr. 2a BeamtVG nicht bekannt. Nach dieser Vorschrift verliert ein Beamter ab einer Verurteilung zu Freiheitsstrafe von zwei Jahren seine Versorgungsbezüge. Das Zivilgericht gab der Klage statt. Zwar ließe sich nicht feststellen, dass die Strafe niedriger ausgefallen wäre, wenn das Gericht § 59 Abs. 1 Nr. 2a BeamtVG gekannt hätte. Dieses „non liquet“ gehe jedoch zu Lasten des Verteidigers, da sich der Kläger in besonderer Beweisnot befände.
76
Diese Beweislastumkehr wird von Krause[44] zu Recht als systemwidrig kritisiert. Er verweist auf die gesetzliche Beweiserleichterung des § 287 BGB, welche auch für die Frage des hypothetischen Ausganges des Vorprozesses gelte. Im Übrigen gilt hier die geäußerte Kritik an der Entscheidung BGH NJW 1964, 2402 entsprechend.
77
OLG Düsseldorf NJW-RR 1999, 785: Bei der Beratung über die Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels gegen die Verurteilung eines Beamten zu 1 Jahr Freiheitsstrafe wies der Verteidiger den Mandanten nicht darauf hin, dass diese Bestrafung nach § 51 LBG NRW das Ausscheiden aus dem Dienst zwingend nach sich zog. Das Rechtsmittel war hinsichtlich der Strafzumessung objektiv aussichtsreich. Wegen der fehlerhaften Beratung ließ der Mandant das Urteil rechtskräftig werden. Das OLG Düsseldorf befand, dass dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch gegen den Verteidiger bestünde.
78
OLG Braunschweig BRAK-Mitt. 2001, 213: Der Verteidiger beriet einen im Ausland lebenden Angeklagten, gegen den ein Haftbefehl erlassen worden war, falsch dahin, dass die diesem zur Last gelegte Tat verjährt sei. Bei der Einreise des Angeklagten nach Deutschland wurde der Haftbefehl vollstreckt. Der Verteidiger wurde vom Zivilgericht verurteilt, dem Angeklagten die nach § 153a StPO für die Einstellung des Strafverfahrens gezahlte Geldauflage sowie die Verteidigerkosten zu erstatten.
79
KG NJW 2005, 1284: Der Verteidiger eines ausländischen Angeklagten hatte es trotz eines entsprechenden Auftrages des Mandanten versäumt, rechtzeitig einen Terminverlegungsantrag zu stellen. Dieser wollte zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung in seinen Heimatstaat reisen, um dort zu heiraten. Der Verteidiger versäumte es weiter, den Mandanten über das Risiko einer Verhaftung bei dem Nichterscheinen zur Hauptverhandlung aufzuklären. Das Gericht erließ Haftbefehl nach § 230 Abs. 2 StPO. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland wurde der Mandant verhaftet und verbrachte 76 Tage in Untersuchungshaft. Das KG sprach dem Mandanten ein Schmerzensgeld von 7.000 € zu. Anspruchsmindernd wertete es ein erhebliches Mitverschulden des Mandanten. Er habe sich bei seinem Verteidiger nicht nach dem Stand der Terminverlegung erkundigt und habe zudem die Reise in sein Heimatland angetreten, obwohl ihm bekannt gewesen sei, dass der Hauptverhandlungstermin nicht verlegt worden war.
80
Es lässt sich das Resümee ziehen, dass sich sämtliche bislang ergangenen Entscheidungen auf Fälle fehlerhafter Rechtsprüfungen des Verteidigers bezogen. Wegen einer angeblich falschen Verteidigungsstrategie ist bisher noch kein Verteidiger zum Schadensersatz verurteilt worden. Ein derartiger Anspruch liegt bereits deshalb fern, da es sich bei der Erarbeitung einer Verteidigungsstrategie immer um eine anwaltliche Tätigkeit mit stark prognostischem Charakter handelt. Hier ist dem Verteidiger regelmäßig ein weitreichender Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum zuzugestehen. Dieser hindert den Kläger bereits am substanziierten Vortrag einer Pflichtverletzung.