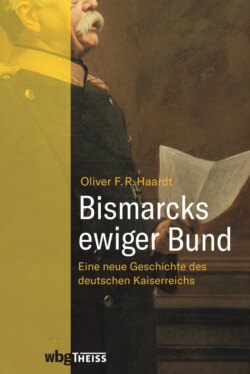Читать книгу Bismarcks ewiger Bund - Oliver Haardt - Страница 19
Kapitel 2: Die Legende vom Fürstenbund
Оглавление„ Seid gegrüßt, Mitvasallen!“ Die Aufregung war groß, als der junge Fürst Georg Albert von Schwarzburg-Rudolstadt den Spiegelsaal von Versailles betrat und mit dieser saloppen Bemerkung die anderen gekrönten Häupter der deutschen Einzelstaaten begrüßte, die an diesem 18. Januar 1871 zur Proklamation des neuen Kaisers gekommen waren. Einige konnten sich ein Lachen nicht verkneifen. Andere nickten dem Prinzen von Arkadien, wie sie den Schwarzburger Lebemann überall nannten, verstohlen zu. Die anschließende Zeremonie sorgte für weiteres Unbehagen. Der preußische Hofprediger Bernhard Rogge hielt eine langatmige Ansprache, die den „Charakter einer Hausandacht“ hatte und nicht gerade würdevoller dadurch wurde, dass „der improvisierte Altar […] einer nackten Venus“ gegenüberstand, wie der preußische Oberstleutnant Paul Bronsart von Schellendorff berichtete. Erschien dieser Anblick einigen Monarchen noch durchaus amüsant, waren viele tief getroffen von dem, was sie sich anhören mussten. Rogge predigte zu einem Psalm, der ihre schlimmsten Ängste zu bestätigen schien. Die Bibelstelle, die er ausgesucht hatte, suggerierte ziemlich unverhohlen, dass die Geburt des neuen preußisch-dominierten Bundes das Ende ihrer Souveränität bedeuten würde: „So lasset euch nun weisen, ihr Könige, und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden! Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern!“1
Eigentlich waren die Großherzöge von Baden und Oldenburg, die Herzöge von Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Meiningen und Sachsen Altenburg, die Fürsten von Schaumburg-Lippe und Schwarzburg-Rudolstadt, der Kronprinz von Sachsen, die Erbgroßherzöge von Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, die Erbprinzen von Sachsen-Meiningen und Anhalt, die Prinzen Luitpold, Otto und Leopold von Bayern und die Prinzen Wilhelm und August sowie die Herzöge Eugen der Ältere und Jüngere von Württemberg gekommen, um den Sinn der Zeremonie zu unterstreichen. Mit ihrer Anwesenheit wollten sie deutlich machen, dass der preußische König aus der Mitte der regierenden Fürsten zum Deutschen Kaiser erhoben und so zum ersten unter vielen grundsätzlich gleichgestellten Souveränen gemacht wurde. Statt mit dem angemessenen Respekt behandelt zu werden, wurden sie jetzt aber in aller Öffentlichkeit gedemütigt. Es fühlte sich an, als würden sie vor aller Augen dem Joch der preußischen Monarchie unterworfen. Otto von Bayern schrieb einige Tage später an seinen Bruder König Ludwig II., der wie zahlreiche andere Landesherrscher die Proklamation von vornherein als unerträglichen Akt des preußischen Militarismus abgetan und sein Kommen verweigert hatte: „Ach, Ludwig, ich kann Dir gar nicht beschreiben, wie unendlich weh und schmerzlich mir während jener Zeremonie zumute war, wie sich jede Phase in meinem Innern sträubte und empörte gegen all das, was ich mit ansah. […] Welchen wehmütigen Eindruck machte es mir, unser Bayern sich da vor dem Kaiser neigen zu sehen. […] Alles so kalt, so stolz, so glänzend, so prunkend und großtuerisch und herzlos und leer.“2
Bismarck, der von der Bedeutung der symbolträchtigen Veranstaltung wusste und sich deswegen trotz akuter Gallenschmerzen aus dem Bett gequält hatte, schäumte vor Wut. Den Sarkasmus des Schwarzburger Dandys konnte er gerade noch so mit Humor nehmen, die taktlosen Worte des ihm ohnehin verhassten Predigers brachten das Fass für ihn aber zum überlaufen: „Mehr als einmal dachte ich mir, warum kann ich diesem Pfaffen nicht an den Leib? Jede Thronrede muß vorher Wort für Wort beraten werden, und dieser Pfaffe darf sagen, was ihm gerade einfällt.“ Worüber sich Bismarck so echauffierte, war vor allem, dass die bewusste Auswahl dieser Bibelstelle einen der wichtigsten Leitgedanken untergrub, die er in den letzten Jahren während des schwierigen Vereinigungsprozesses der deutschen Staaten verfolgt hatte. Seit der Auflösung des Deutschen Bundes hatte er größte Anstrengungen unternommen, um die Gründung des neuen Nationalstaates als einen freiwilligen Zusammenschluss der monarchischen Herrscher und eben nicht als Unterwerfung der anderen Einzelstaaten unter die preußische Hegemonie erscheinen zu lassen.3
Am deutlichsten wurde dieses Anliegen in der Eingangsformel, die er für die neue Verfassung durchgesetzt hatte. In Anlehnung an die Verfassungsverträge des alten Bundes hatte die Präambel die Form einer feierlichen Erklärung der regierenden Fürsten. Darin gelobten diese, einen „ewigen Bund […] zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes, sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen Volkes“ zu schließen. Laut diesem Schwur ging die Vereinigung Deutschlands also nicht von der Nation, sondern von den monarchischen Souveränen der Einzelstaaten aus. Das deutsche Volk tauchte nur als Nutznießer ihrer Entscheidung auf, sich zu seinem Wohle zusammenzuschließen. Die verfassungsgebende Gewalt, die pouvoir constituant, lag allein bei den gekrönten Häuptern. Der neue gesamtdeutsche Staat, den diese Herrscher als gleichberechtigte Partner schufen, war demnach eine monarchische Allianz, durch die sie ihre jeweiligen Länder in einer Art Dachorganisation miteinander verbanden. Kurz gesagt: Die Präambel erklärte das Reich zu einem Fürstenbund.4
Dieses Zerrbild hatte mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Von Gleichberechtigung unter den Fürsten konnte ob der Vormachtstellung der preußischen Monarchie, die den anderen Einzelstaaten durch Krieg, Annexion und Diplomatie ihre Lösung der deutschen Frage aufgedrückt hatte, keine Rede sein. Außerdem waren die einzelstaatlichen Souveräne und ihre Regierungen mitnichten die einzigen, die die neue Ordnung geschmiedet hatten. Der konstituierende Reichstag und die deutschen Landtage hatten die Verfassung verhandelt beziehungsweise gebilligt und dadurch eine äußerst wichtige Rolle in der Umgestaltung Deutschlands gespielt. Die Präambel zeichnete daher ein Bild der Reichsgründung, das mit den historischen Vorgängen, die wir im vorhergehenden Kapitel kennengelernt haben, wenig gemein hatte.
Aber nicht nur das. Die einleitende Beschwörung eines Fürstenbundes passte auch so gar nicht zum Hauptteil der Verfassung. Dieser richtete nämlich keine staatenbündische Union zwischen monarchischen Souveränen, sondern einen föderalen Bundesstaat mit teils stark unitarischen Zügen ein. Das war ganz offensichtlich. Mit Kaiser und Reichstag standen zwei Organe, die die gesamte Nation und nicht einzelne Staaten vertraten, an der Spitze der Exekutive beziehungsweise im Mittelpunkt des Gesetzgebungsprozesses. Das Reich genoss außerdem weitaus mehr und umfangreichere Rechte gegenüber den Einzelstaaten, als es jemals für die Zentralgewalt des Deutschen Bundes der Fall gewesen war. Dazu kam noch die erdrückende Hegemonie Preußens, die zum Beispiel in Gestalt der Stimmverteilung im Bundesrat für jeden sichtbar war. Bereits durch diese herausstechenden Merkmale – von den strukturellen Details ganz zu schweigen – schrieb die Verfassung in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil von dem fest, was als gleichberechtigtes Bündnis zwischen gekrönten Häuptern von nach wie vor souveränen Staaten hätte gelten können.5
Dementsprechend war die Vorstellung, dass die Reichsgründung einen Fürstenbund hervorgebracht hatte, schon unter Zeitgenossen äußerst umstritten. Unter den Staatsrechtswissenschaftlern jener Tage gab es nur wenige, die argumentierten, das Reich sei aus einem völkerrechtlichen Vertrag zwischen den einzelstaatlichen Souveränen entstanden. Die meisten hielten diese Interpretation für Humbug. Einige sahen die Einrichtung des Nationalstaates als einen Akt der Bundes- beziehungsweise parallelen Landesgesetzgebung, andere als Folge einer Vereinbarung zwischen allen monarchischen Regierungen und dem Reichstag. Der berühmte Rechtsprofessor Georg Jellinek behauptete in seiner 1882 veröffentlichten Lehre von den Staatenverbindungen gar, dass die Reichsgründung überhaupt kein rechtlicher Vorgang war, sondern ein rein historisch-politisches Ereignis. Es herrschten also völlig verschiedene Ansichten darüber, wie das Reich zustande gekommen und was es infolgedessen eigentlich war. „Die Kategorien des Staatsrechts“, konstatierte der preußische Historiker Heinrich von Treitschke, „werden an diesem Bau zu Schanden.“ Einig waren sich die meisten Beobachter nur in einem Punkt, nämlich darin, dass aus der Reichsgründung eben kein Fürstenbund hervorgegangen war.6
Wenn daran so augenscheinliche Zweifel bestanden, wieso legte Bismarck dann so viel Wert darauf, diese Fassade aufrechtzuerhalten? Woher kam die Idee des Fürstenbundes? Was war ihr Zweck? Und welche Folgen hatte sie für die bundesstaatlichen Strukturen, die während des Vereinigungsprozesses geschaffen wurden? Auf diese Fragen gibt es trotz der Fülle an Darstellungen über die Reichsgründung bisher keine Antworten. Auch 150 Jahre nach der Kaiserproklamation von Versailles bleibt der Fürstenbund ein Rätsel. Wenn Historiker überhaupt von diesem Konzept Notiz genommen haben, haben sie es für gewöhnlich sogleich mit Verweis auf die preußische Hegemonie und die unitarische Bundesstaatsordnung als reine Fiktion verworfen. Sie haben gewissermaßen direkt hinter die Fassade geblickt, ohne zuerst innezuhalten und zu betrachten, wie diese genau aussah und warum sie überhaupt errichtet wurde. Typisch ist die Einschätzung Ernst Rudolf Hubers in seiner Tour de Force durch die deutsche Verfassungsgeschichte seit der Französischen Revolution: „Während die Formel vom Fürstenbund in den Grundgesetzen des Deutschen Bundes ein sinnadäquater Ausdruck der Verfassungswirklichkeit war, war sie in der Präambel der Bismarckschen Reichsverfassung eine bloß verbale Beteuerung, die die nationalunitarische Verfassungswirklichkeit durch eine bündische Legende ideologisch zu verdecken suchte.“7
Diese Sichtweise wird der Fürstenbundidee aus mehreren Gründen nicht gerecht. Zum einen kann sie nicht deren Langlebigkeit erklären. Während der Kanzlerschaft Bismarcks tauchte die Vorstellung vom Reich als Fürstenbund immer wieder auf, wenn die monarchischen Regierungen untereinander oder mit dem Reichstag in Konflikt gerieten. Noch 1890 versuchte Bismarck, seine drohende Entlassung durch den Vorschlag eines Staatsstreichplans abzuwenden, der die Verfassung mit der Begründung auflösen wollte, dass die einzelstaatlichen Souveräne den Fürstenbund, den sie zwei Jahrzehnte zuvor gegründet hatten, auch jederzeit wieder aufkündigen könnten. Die einzelnen Krisenmomente, die den Fürstenbund aufs Tableau brachten, werden wir im Laufe dieses Buches näher kennenlernen, vor allem, wenn wir uns in Kapitel 7 mit der eigentümlichen Verfassungsgerichtsbarkeit des Reiches beschäftigen werden. An dieser Stelle genügt es, eine grundsätzliche Beobachtung festzuhalten: Der Fürstenbund spielte eine zu wichtige Rolle, um ihn als bloßes Ammenmärchen des Reichsgründers abzutun.8
Zum anderen beruht die Einschätzung, dass der Fürstenbund nur eine „bündische Legende“ ohne jeglichen Bezug zur Wirklichkeit war, auf einer ganz bestimmten Herangehensweise. Wenn man nach einer bestimmten staatsrechtlichen Organisationsform sucht, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass die Verfassung keinen Fürstenbund einrichtete. Wie wir im Laufe dieses und des nächsten Kapitels sehen werden, umfassten die bundesstaatlichen Strukturen der Verfassung einzelne, mitunter sehr wichtige Bausteine eines derartigen Regierungssystems. Ihr Gesamtgefüge war aber schon aus den oben genannten Gründen eindeutig kein Fürstenbund. Während uns diese Erkenntnis hilft, den normativen Aufbau der Verfassung besser zu begreifen, sagt sie uns rein gar nichts über den Ursprung, die Hintergründe und den Zweck der Vorstellung, dass das Reich ein Fürstenbund war. Anders gesagt: Da es beim Fürstenbund mehr um den Anschein als um die Substanz ging, verfehlt man den Kern der Sache, wenn man versucht, eine konkrete Rechtsform nachzuweisen.
Wollen wir diesen Kern treffen, ergibt es mehr Sinn, den Fürstenbund als eine kreative Idee über die organisatorische Gestaltung Deutschlands ins Visier zu nehmen. Diese Idee entsprang wohlkalkulierten Überlegungen über das Verhältnis der deutschen Einzelstaaten, entwickelte sich in enger Wechselwirkung mit der politischen Lage stetig weiter und hatte ganz konkrete strukturelle Auswirkungen. Um sie zu verstehen, müssen wir tief in die Reichsgründungszeit eintauchen und die Gedankenwelt der Dokumente nachzeichnen, die den neuen Bund auf den Weg brachten. Dazu gehörten neben der Verfassung selbst diverse Entwürfe und Denkschriften, zahlreiche Beschlüsse des preußischen Kabinetts, dem sogenannten Staatsministerium, die Protokolle der Verhandlungen der einzelstaatlichen Regierungen und des konstituierenden Reichstages, die Einigungsverträge zwischen dem Norddeutschen Bund und den süddeutschen Staaten sowie die Urkunden zur Wiedererrichtung des Kaisertitels.
Diese Vorarbeiten zur Reichsverfassung waren mehr als bloße Begleiterscheinungen des größeren politischen Umwälzungsprozesses, der die deutsche Landkarte so radikal veränderte. Sie waren gedankliche Schlüsselmomente, die ihre Urheber zu Papier brachten, um nach einer Lösung für jene Verfassungsfragen zu suchen, von denen die Umgestaltung Deutschlands abhing. Es bietet sich an, sich diesen Momenten in zwei Schritten zu nähern. Zunächst müssen wir verstehen, aus welchen Überlegungen die Grundkonzeption des neuen Bundes entstand. Dazu untersucht dieses Kapitel, wie Bismarck und die einzelstaatlichen Regierungen die Verfassung des Norddeutschen Bundes 1866/67 entwickelten und drei Jahre später auf die süddeutschen Staaten ausdehnten. Aus den Dokumenten, die der Denk- und Verhandlungsprozess der exekutiven Entscheidungsträger produzierte, ergibt sich ein Mosaik, das uns in seiner Gesamtheit ein viel klareres Bild von der bündischen Reorganisation Deutschlands zeigt, als es seine einzelnen Bestandteile könnten. Durch das Fenster, das sich uns so öffnet, können wir in den neuen Verfassungsbau hineinschauen und den parlamentarischen Beitrag zu dessen Gestaltung besser in den Blick nehmen. Das nächste Kapitel widmet sich demzufolge den Beratungen des Reichstages über den Verfassungsentwurf, den Bismarck dem Parlament im Namen der verbündeten Regierungen vorlegte und den die liberalen Abgeordneten in mehreren wichtigen Punkten erheblich anpassten. Im Spiegel dieser Amendements sowie jener Änderungen, die Bismarck verhindern konnte, geben sich die Erwartungen, Hoffnungen und Ängste zu erkennen, die liberale und konservative Kräfte jeweils mit der Schöpfung der neuen Ordnung verknüpften.
In diesen beiden Schritten entfaltet sich vor uns eine vollständige Entstehungsgeschichte der Verfassung. Diese Genesis zeigt uns, wie die föderalen Strukturen des Bundes zustande kamen und welche Absichten dahinter standen. Bisher wissen wir nur wenig darüber. Zwar haben Historiker immer wieder einzelne Etappen auf dem verschlungenen Weg zur Reichsverfassung beleuchtet. Die Leitgedanken, die auf diesem Pfad die Richtung vorgaben, liegen aber im Halbdunkeln. Eine große ideengeschichtliche Erzählung über die Geburt des neuen föderalen Regierungssystems, wie es sie zuhauf etwa über die Entstehung der amerikanischen Bundesverfassung gibt, ist nie geschrieben worden. Das liegt vermutlich daran, dass die genauen Vorgänge um das Zustandekommen der Verfassung lange Zeit von der mächtigen Legende überstrahlt wurden, die sich nach der Vereinigung der deutschen Staaten um Bismarck bildete. Zu dieser mythischen Verklärung des „Reichsgründers“ gehörte auch die Vorstellung, er habe die Verfassung des neuen Nationalstaates in einem Akt genialer Improvisation ganz alleine erdacht. Sein Sekretär und früher Biograf Robert von Keudell strickte als erster an dieser Legende. In seinen 1901 veröffentlichten Erinnerungen an Fürst und Fürstin Bismarck schilderte er, wie sein Chef ihm „mit der fürstlichen Gelassenheit“ an nur einem Nachmittag „die wichtigsten Abschnitte des Entwurfs […] teils im Wortlaut“ aus dem Kopf heraus diktiert habe.9
In Wirklichkeit war die Verfassung alles andere als eine „staatsrechtliche Stegreifrede“, wie der bedeutende Staats- und Völkerrechtler Heinrich Triepel erstmals 1911 in einem wenig beachteten Aufsatz über die Vorgeschichte der Norddeutschen Bundesverfassung nachgewiesen hat. Die Verfassung ging auf zahlreiche Vorarbeiten zurück, die teils von Bismarck, teils von anderen Staatsmännern aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern stammten. Die „geniale“ Leistung Bismarcks bestand darin, zur Erfüllung bestimmter politischer Ziele die in diesen Entwürfen enthaltenen Gedanken auf ganz besondere Art und Weise zu kombinieren und das daraus resultierende Konstrukt halbwegs unbeschadet durch die verschiedenen Instanzen zu bringen, die es durchlaufen musste, um als neue deutsche Verfassung in Kraft zu treten.10
Eindrucksvoll gezeigt hat das Otto Becker in seiner klassischen Studie über Bismarcks Ringen um Deutschlands Gestaltung. Die Entstehungsgeschichte dieses Werkes ist ähnlich abenteuerlich wie die der Verfassung. Becker war ein Schüler der beiden berühmtesten liberal-konservativen Historiker des späten Kaiserreiches und der Weimarer Republik, Hans Delbrück und Friedrich Meinecke, dem Begründer der Ideengeschichte. Nach mehreren Jahren in Asien, inklusive japanischer Kriegsgefangenschaft, habilitierte er sich 1924 in Berlin und nahm 1931 einen Ruf auf den Lehrstuhl für neue Geschichte in Kiel an. Hier begann er, seine langjährigen Forschungen zu Bismarcks Umgestaltung der deutschen Verfassungsordnung zu Papier zu bringen. 1943 übergab er das Manuskript einem Leipziger Verlagshaus zur Veröffentlichung. Bei einem Bombenangriff auf die Buchhandelsstadt ging sein Opus in Flammen auf. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges machte sich Becker daran, eine Neufassung zu schreiben. Er starb 1955, bevor er die Arbeit daran abschließen konnte. Die fehlenden Teile wurden auf Grundlage seiner Notizen von seinem Kieler Kollegen Alexander Scharff ergänzt, der das Buch schließlich 1958 als Herausgeber veröffentlichte.11
Beckers Studie geht also auf eine Zeit vor der nationalsozialistischen Machtergreifung zurück, in der die Geschichtswissenschaft noch stark unter dem Eindruck des gerade erst untergegangenen Kaiserreiches stand. Der glänzende Mythos vom unfehlbaren Reichsgründer hatte nach der Revolution von 1918 zwar erste Risse bekommen, überdeckte in der Weimarer Geschichtsschreibung aber nach wie vor die nüchternen historischen Vorgänge. Dementsprechend ist Beckers Blick auf die Vorgeschichte der Verfassung vor allem eine Auseinandersetzung mit der außergewöhnlichen Rolle Bismarcks bei der Gründung des deutschen Nationalstaates. Seine Studie räumt mit der Vorstellung auf, dass Bismarck Deutschland quasi im Alleingang Einheit und Verfassung geschenkt habe. Sie zeigt den vermeintlichen Solisten umgeben von einer ganzen Reihe unterschiedlicher Akteure, die an der strukturellen Umgestaltung Deutschlands mehr oder weniger stark beteiligt waren, allen voran die verschiedenen einzelstaatlichen Regierungen und die nationalliberalen Volksvertreter. In dem polyphonen Stimmenwirrwarr dieser Protagonisten bleibt Bismarck für Becker aber stets derjenige, der schon im Vorhinein den Kurs kannte, der das Staatsschiff in den Hafen der Einheit bringen würde. Dadurch liest Becker die Entstehungsgeschichte der Verfassung vom Ende her. Diese teleologische Sichtweise vereinfacht den umkämpften, in weiten Teilen unvorhersehbaren intellektuellen und politischen Findungsprozess des föderalen Regierungssystems gewaltig und verzerrt so unser Bild von der Verfassung, die dieser Prozess Schritt für Schritt formte. Sie stellt ein Genie vielen Dilettanten gegenüber und unterschätzt so die Komplexität und den Kompromisscharakter der Ordnung, auf die man sich schließlich einigte.
Trotzdem öffnet uns Becker eine wichtige Tür in die Gedankenwelt, in der die Verfassung entstand. Die breite Vielfalt an Quellen, die er aus den Archiven zahlreicher Landesregierungen ausgegraben hat, gewährt uns einen tiefen Einblick in den Widerstreit verschiedener Ideen über die Organisation des entstehenden Nationalstaates. Er stellt uns gewissermaßen auf eine erhöhte Plattform, von der aus wir die Errichtung des vermeintlichen Fürstenbundes betrachten können. Auch wenn seine Studie als Interpretation der Reichsgründung obsolet sein mag, ist sie als Quellensammlung unverzichtbar. Wir müssen sie aber mit Sorgfalt behandeln. Es gilt, die Dokumente, die Becker in mühevollster Kleinarbeit über Jahrzehnte zusammengetragen hat, völlig neu zu bewerten. Statt sie unter dem Gesichtspunkt der angeblich vorausschauenden Genialität des Reichsgründers zu interpretieren, müssen wir sie als ein Netzwerk von Ideen betrachten, deren Konkurrenzkampf den Ausgang vollkommen offen ließ. Mit anderen Worten: Wir müssen Beckers Arbeit vor dem Mythos des Reichsgründers retten.
So ist dieses Kapitel auch eine Neuauslegung eines der großen Klassiker der Kaiserreichshistoriografie. Aus der alten Geschichte von Bismarcks Ringen um Deutschlands Gestaltung macht es eine neue Erzählung über Deutschlands Ringen um Bismarcks gestalterische Ideen. Auf diese Weise schafft es einer Klage Abhilfe, die Heinrich Triepel schon gegen Ende des Kaiserreiches formulierte. Es hebt „den Schleier, der sich über jene wichtige Zeit der deutschen Verfassungsgeschichte breitet“ und legt dadurch das wahre Gesicht der föderalen Strukturen offen, die durch die Vereinigung der deutschen Staaten geschaffen wurden. Dabei wird deutlich werden, dass der Fürstenbund in der Tat eine Legende war, an deren Wahrheitsgehalt weder ihr Urheber noch ihre Nutznießer glaubten. Bismarck und die einzelstaatlichen Regierungen entwickelten beziehungsweise folgten diesem Gründungsmärchen aber aus guten Gründen. Denn es hatte ganz bestimmte Funktionen und strukturelle Folgen, die das Reich über Jahrzehnte hinaus prägen sollten. So ersponnen die Legende vom Fürstenbund auch war, sie bildete einen entscheidenden Teil der Wirklichkeit des Bundesstaates, den die Reichsgründung hervorbrachte.12