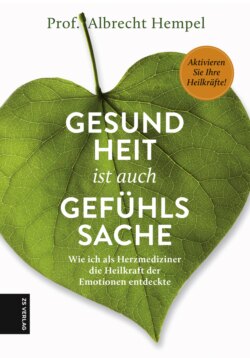Читать книгу Gesundheit ist auch Gefühlssache - Prof. Albrecht Hempel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gefühle sind ein Korrektursystem des Körpers
ОглавлениеWie wir von Psychotherapeuten wissen, ruft ein Herzinfarkt, bei dem ja unser zentrales Organ oder auch nur ein Teil davon abstirbt, bei dem Betroffenen ein Gefühl der Angst vor der totalen Vernichtung hervor, eine regelrechte Todesangst. Immerhin stirbt auch heute noch jeder zweite, wenn der Infarkt nicht möglichst schnell in einer Klinik behandelt wird. Alles, was jemand in solchen Stunden angesichts des möglichen Todes fühlt, müsste ihn doch dazu bewegen, sein Leben grundlegend zu verändern. So jedenfalls dachte ich damals. Doch bei diesem Mann schien dieser »Mechanismus« ganz offensichtlich nicht zu funktionieren. Hatte er den Zusammenhang zwischen seiner Katastrophe und seiner bisherigen Art zu leben gar nicht gefühlt oder zumindest nicht hinreichend stark, nicht klar genug? War es für ihn vielleicht nur eine leichte Ahnung gewesen, auf die man nicht unbedingt etwas geben musste? Und wenn das zutraf, trug dann nur er allein Verantwortung für diese Wahrnehmungsschwäche? Oder waren wir Mediziner mit in der Verantwortung? Gab es da Lücken, die auch ich bislang noch nicht gesehen hatte?
Seit diesem Schlüsselerlebnis beobachtete ich meine Patienten noch genauer und machte eine Feststellung, die meine Art, über Krankheit und Heilung nachzudenken, nachhaltig verändern sollte: Viele Patienten waren krank geworden, weil sie nicht auf ihre Gefühle gehört hatten. Müsste also nicht der entscheidende Ansatz sein, Gefühle stärker ins Leben einzugliedern, um sie als eine Art Frühwarn- und Korrektursystem des Körpers zu nutzen?
Nur kurze Zeit später begegnete mir ein Patient, der mir deutlich machte, dass es so einfach dann doch nicht war. Wir hatten die bedrohlich verstopften Herzkranzgefäße des 62-Jährigen bereits zum zweiten Mal an zwei verschiedenen Stellen mit einem Stent wieder »gängig« gemacht. Da ich, nicht zuletzt durch das Erlebnis mit besagtem rauchenden Infarktpatienten, noch neugieriger auf die Lebensumstände meiner Patienten geworden war als zuvor, interessierte ich mich auch in diesem Fall sehr dafür, was diese ernste Erkrankung beeinflusst haben könnte.
Wie erstaunt war ich, als ich zunächst feststellen musste, dass der Patient offenbar ein extrem gutes und ausgeglichenes Leben führte. Raucher war er nie gewesen, Hektik schien für ihn ein Fremdwort zu sein. Nie hatte er zu viel oder gar zu fett gegessen, und auf Wander- und Spazierwegen fand man ihn deutlich häufiger als vor dem Fernseher. Man sollte meinen, dass es ihm zumeist leicht ums Herz und dieses damit wenigen schlimmen Belastungen ausgesetzt war.
Dennoch plagte ihn diese Enge in der Brust (Angina pectoris), und ich stellte mir die Frage, wie das zusammenpasste. Bei einem ausführlichen Gespräch erfuhr ich dann, dass es in seiner familiären Umgebung immer wieder zu schwierigen Situationen gekommen war. Er erzählte intensiv von verschiedenen Krankheiten bei Angehörigen, von Jobverlusten, Scheidungen, auch von einem Autounfall war die Rede, darüber hinaus noch so manch andere Laune des Zufalls. Entscheidend schien dabei die Rolle zu sein, die er übernahm: Er war immer der Helfer, musste vermitteln, überreden und überzeugen, Auswege suchen, Zeit, oft auch Geld und nicht zuletzt Trost spenden.
Was ich in diesem Gespräch sehr deutlich spürte: Das Unglück der anderen war immer häufiger auch zu seinem persönlichen Unglück, fremdes Pech zu eigenem Pech geworden. Diesen Mann schien gerade seine Fähigkeit, Gefühle zuzulassen, in die Katastrophe geführt zu haben: Er hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes immer alles zu Herzen genommen. Viel zu sehr, wie ihm Freunde schon oft gesagt hatten, und wie wir Ärzte nun an seinen Herzkranzgefäßen sahen. Das gute und für unser soziales Zusammenleben unverzichtbare Gefühl des Mitfühlens hatte hier das erträgliche Maß überschritten und diesen Mann selbst krank werden lassen. Mitleid war zu herzergreifendem Mitleiden geworden.