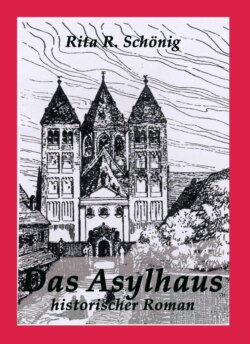Читать книгу Das Asylhaus - Rita Renate Schönig - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Nürnberger Kaufleute - 1599
ОглавлениеSchon in den frühen Morgenstunden strömte viel Volk aus den umliegenden Zentdörfern und Weilern durch die Stadttore. Es war der Donnerstag nach Lätare, drei Wochen vor dem Osterfest und niemand wollte das außergewöhnliche Spektakel verpassen, das jährlich, genau an diesem Tag, stattfand. Hauptsächlich in der Obergasse drängten sich alsbald die Schaulustigen.
Auch Elisabeth, ihre Geschwister und die Mutter reckten immer wieder voller Ungeduld die Köpfe. Dann endlich passierte der Handelszug der Nürnberger das Oberstadttor, angeführt von den kurfürstlichen Geleitstruppen, an deren Spitze der Reiterhauptmann mit seiner Rotte – den Einspännigen – ritt; gefolgt vom Vizedom aus Aschaffenburg mitsamt seinem Landhauptmann und Landschreiber, sowie dem Oberkeller.
Gleich hinterher, auf einem nervös tänzelnden Ross sah man Adam Stirn, den derzeitigen Fauth von Seligenstadt, neben dem Zentgrafen von Groß-Ostheim. Seit der Grasbrücke bei Stockstadt, der letzten kurmainzischen Zollstation vor Seligenstadt, befanden sich die amtlichen Herren im Geleit.
Fauth Stirn würde gemäß der kurfürstlichen Verfügung in den nächsten zwei Messewochen diese Strecke einmal täglich, zusammen mit seinem Knecht abreiten, um sicherzustellen, dass einzeln Reisende nicht von der vorgeschriebenen Geleitsstraße abwichen und somit den Wegezoll schuldig blieben.
Allein die Vorstellung, seine ohnehin begrenzte Zeit, mit solch einer lästigen Aufgabe zu vergeuden, selbst aber keinen klingenden Nutzen davonzutragen, wurmte Adam Stirn aufs Äußerste.
Dennoch bedachte er nun seine Seligenstädter Untertanen, die ihm und den Kaufleuten zujubelten, mit einer gnädig fächelnden Geste und einem gefälligen Lächeln. Und für einen flüchtigen Zeitraum lenkten ihn die freudig strahlenden Gesichter von seinen Sorgen ab, die ihn in den letzten Nächten um den Schlaf gebracht hatten. Aber nur so lange, bis ihn erneut die Frage einholte, ob er recht getan, als er dem verlockenden Vorschlag zugestimmt hatte.
Mit Gewissheit konnte man die vergangenen Weinjahre jämmerlich benennen. Und auch in diesem Jahr zeigte der Heilige Urbanus, trotz der vielen guten Wachskerzen, die ihm gespendet worden waren, kein Einsehen. Leere, hohl klingelnde Weinfässer lagerten in kalten Gewölbekellern und zeichneten so manchem Wirt tiefe Sorgenfalten ins Gesicht.
Adam Stirn – selbst Besitzer eines Weinberges im Freigericht – verstand die Seelennot der Weinbauern und Ausschankwirte nur allzu gut. Unzählige Stunden verbrachte er liebend gern in seinem Weinkeller, wovon er nicht mal die Hälfte sein Eigen nennen durfte. Der größere Teil der dort lagernden Fässer war städtisches Besitztum und wurde in der Schankstube im Parterre des Ratsgebäudes häufig bei offiziellen festlichen Anlässen ausgeschenkt.
Doch das war für Fauth Stirn eine kaum beachtenswerte Kleinigkeit, die er nur allzu gern übersah, wenn er sich zwischen den Rebenfässern niederließ. Was nicht bedeutete, dass er sich an fremdem Eigentum gütlich tat. Dazu war er zu rechtschaffen. Stirn träumte lediglich seinen Traum, Besitzer all dieser Kostbarkeiten zu sein und behauptete, in der Stille, bei einem oder auch zwei Bechern Rebensaftes die besten Einfälle zu haben.
Dennoch fiel ihm, trotz der vielen Stunden, die er in den letzten Tagen bei seinen Lieblingen verbracht hatte, diesmal keine Lösung für sein Dilemma ein. Es stand nun mal nicht in seinem Ermessen, der Natur zu befehlen. Dagegen überkam ihn immer öfter ein Gefühl der Schwermut, angesichts des schwindenden Vorrats seiner flüssigen Schätze.
Als sein Weib ihm in der vergangenen Woche auch noch eine Weinschaumsoße vorsetzte und dazu freudestrahlend erklärte, sie hätte einen der besten Tropfen aus seinem Weinkeller verarbeitet, seufzte Adam Stirn nur über so viel Gefühlskälte und Unvernunft.
Auf seine Frage, ob ein Frankfurter Äppelwoi nicht genügt hätte, verzog Susanne Stirn nur beleidigt den Mund und meinte: „Vielleicht, aber dann hätte ich es den Ausschankwirten gleichtun müssen, die ihrem Wein, außer den üblichen Kräutern, Dinge beimischen, die ihre Gäste vor der Zeit schlaftrunken machen.“
Adam Stirn sprang entsetzt auf. Nicht, weil er sich durch die Ansage seines Weibs bedroht fühlte – Susanne redete viel, wenn Gott den Tag lang werden ließ. Nein! Vielmehr erschütterte ihn seine Unwissenheit über derlei rechtswidriges Vorgehen in seiner Stadt. Daneben begriff er schlagartig die ganze Tragweite dieser Weinverknappung.
Die Nürnberger – der Hänselbrauch!
Man würde doch den hochlöblichen Händlern nicht einen, mit wer-weiß-was gepanschten Rebensaft anbieten? Unvorstellbar! Das Ansehen der Stadt und - ganz besonders seines, des Fauths - wären für alle Zeiten dahin. Eine solche Schmach musste verhindert werden. Aber wie? Beim Anblick der wenigen Fässer, die er sein Eigen nennen durfte, schob sein Unterbewusstsein vehement den Gedanken zur Seite, diese kärglichen Bestände zu opfern.
„Die Menge reicht sowieso nicht aus, die durstigen Kehlen der Handelsleute zu laben“, murmelte er vor sich hin.
Seufzend erhob er sich und beschloss sich mit dem Wolfenwirt Strutmann, in dessen Gasthaus alljährlich der Löffeltrunk vorgenommen wurde, zu beraten.
„In der größten Not frisst der Bauer Fliegen“, zitierte er am gleichen Abend gegenüber Strutmann. Womit er schweren Herzens vorschlug, die Abtei um Hilfe zu bitten. „In deren Kellern lagern ganz gewiss noch genügend Fässer von bester Güte.“
„Die Kuttenträger anbetteln?“, polterte Strutmann. „Zu Kreuze kriechen vor den Betbrüdern? Ja, wisst Ihr denn, was das bedeutet? Bis zum jüngsten Gericht wird der Abt uns seines Großmuts versichern. Nie und nimmer! Eher noch gehe ich rüber zum Ochsenwirt, unserem Großherzoglichen Hoflieferanten.“
Strutmann spie den, dem Ochsenwirt verliehenen Titel verächtlich aus, auf den er selbst begehrlich war. „Auch wenn sich mir dabei der Magen umdreht. Allemal besser, als bei den Schwarzkitteln zu katzbuckeln.“ Mit hochrotem Kopf leerte er seinen Becher und knallte ihn auf den Tisch.
Gesagt – getan. Doch der Ochsenwirt konnte oder wollte nicht helfen. Dessen ungeachtet schaffte Berthold Strutmann es, einige Fässer Rebensaft zu besorgen; aber zu einem horrenden Entgelt, zu dem er die Stadtkasse ermunterte, ihren Teil beizusteuern.
Gleichwohl schien die Welt soweit wieder in Ordnung, bis sich die Zunftbrüder, wie üblich, beim Wolfenwirt Strutmann trafen, um in geselliger Runde das Geschäftliche - insoweit es die Gilde anging - zu bereden.
Kurz vor dem Zapfenschlag schlug Strutmann – schon leicht angeheitert – vor, den „Guten Tropfen“, der den Nürnbergern ausgeschenkt werden sollte, wenigstens selbst einmal probiert zu haben. Zumal er, der Wolfenwirt, in erster Reihe in Verantwortung gegenüber der Stadt und den Nürnberger Händlern stünde und man sich ja auf keinen Fall blamieren wollte.
Die anfänglich strahlenden Mienen der Genötigten verzogen sich aber alsbald zu säuerlichen Fratzen und nicht wenige spien den teuren Wein in hohem Bogen in die allgegenwärtig bereitstehenden Spucknäpfe.
„He Strutmann. Wollt Ihr uns vergiften?“, erbosten sich einige. Und der Löwenwirt meinte spöttisch: „Den Fusel könnt Ihr nicht mal in den Main kippen. Sämtliche Fisch’ würden Reißaus nehmen.“
„Was können wir denn jetzt noch tun?“, fragte Fauth Stirn entmutigt in die Runde. „Es sind nur noch zwei Tage, bis die Nürnberger eintreffen. Herr im Himmel, hilf.“ Er rang die Hände zur kassettenförmigen Holzdecke, als ob er eine göttliche Eingebung von dort empfangen könnte.
Einige Augenblicke später begaben sich die hiesigen Gastwirte mit gesenkten Häuptern auf den Heimweg. „Jetzt hilft nur noch ein Wunder“, murmelte einer beim Hinausgehen.
Das Wunder näherte sich in der Gestalt von Hannes Bergmann, der dem ganzen Lamento, ohne sich einzumischen, zugehört hatte.
Mit einem listigen Grinsen im Gesicht flüsterte er Fauth Stirn ins Ohr: „Ich denke, Ihr müsst Euch etwas einfallen lassen. Ich jedenfalls würde den Nürnbergern von diesem Brachwasser nichts einschenken. Denkt an Euren guten Ruf.“
Fauth Stirn dachte an nichts anderes.
„Aber, Wunder geschehen häufiger als man annehmen würde“, raunte Hannes Bergmann. „Ihr solltet nur genau überlegen, bei wem Ihr darum bittet, wenn Ihr wisst, was ich meine?“
Indessen der Handelszug sich langsam dem Freihofplatz näherte, bedeckten Schweißperlen die Stirn des Fauths. Mit einem Leinentüchlein, eingesäumt mit edler Brüsseler Spitze, wischte er über sein Gesicht und wünschte sich, die Unannehmlichkeiten ließen sich ebenso leicht wegwischen.
Auf dem Freihofplatz, dem sogenannten Asylplatz vor dem Kloster, hatten sich Abt Martinus Krays und die Ältesten der Zunft eingefunden. Nach einigen Worten des Willkommens – deutlich zu schnell nach Adam Stirns Empfinden – zogen sich die „Pfeffersäcke“, wie die begüterten Kaufleute volkstümlich betitelt wurden, in die Gaststätte „Zum Wolfen“ zurück. Dort war alles für die Initiation vorbereitet.
Der Magen des Fauths rebellierte und er hatte einen bitteren Geschmack im Mund. Skeptisch betrachtete er den „Großen Löffel“ auf dem Tisch, der mitsamt Kette, aus einem einzigen Stück Lindenholz geschnitzt war.
Der junge Seidenhändler, Justus von Oyrl war diesjährig zum ersten Mal auf der Reise nach Frankfurt und schaute seinerseits angespannt zum Wolfenwirt, der den Löffel mit 1 Liter Wein füllte. Besorgt fragte sich Justus, ob es ihm gelänge, diesen in einem Zuge und ohne abzusetzen auszutrinken. Denn, nur wenn die „Nagelprobe“ ergab, dass nicht ein Tropfen übergeblieben war, erst dann würde er – genau wie sein Vater vor etlichen Jahren – in die „Löbliche Compagnie“ aufgenommen werden.
Gleichwohl war er nicht der einzige Neuling. Maria, die hübsche Tochter des Patriziers, Hans Christoph Tetzels, nahm ebenfalls an der Zeremonie teil. Wobei den weiblichen Anwärterinnen der kleinere Löffel gereicht wurde, der nur einen ½ Liter Wein fasste.
Justus’ Kumpane stichelten seit Miltenberg, wer - ob das Weib oder er - die Nagelprobe bestehen würde.
***
Indessen das dienstbare Gefolge der Händler für die Versorgung der Pferde verantwortlich war, begaben sich die Geleitsreiter, sowie die kurfürstlichen Beamten in die Obhut des Klosters, das ihnen die Servitium regis, die „Zehrung“ zu reichen, pflichtig war.
Hingegen Matthes Amling, der Syndikus von Nürnberg andere Pläne hatte. Er eilte flugs in die Räumlichkeiten zum SCHWARZEN HANNES. Jetzt, wo alles Volk in den Straßen und Gassen der Stadt unterwegs war, konnte er sicher sein, dass niemand sie stören würde. Denn, die Neuigkeiten, die er für seinen Freund hatte, sollten fremden Ohren nicht zugänglich sein.
Amling, verantwortlich für die Geleitswerbung und der damit erforderlichen Beschaffung der Bewilligungsbriefe, war drei Wochen zuvor kreuz und quer durchs Land geritten. Vom Landgrafen von Ansbach-Bayreuth, zum Bischof von Würzburg dem Herzog von Ostfranken, sowie zu den Grafen von Castell und von Wertheim. Weiter zum Schenken von Limburg-Speckfeld und zum Burggrafen von Miltenberg, sodann zum Amtmann von Tauberbischofsheim und dem Vicedomus von Aschaffenburg. Jeden dieser hohen Herren ersuchte Matthes Amling um deren Genehmigungen zur Durchquerung ihrer Ländereien; fraglos zu den zu entrichtenden Gebühren.
Jetzt freute er sich auf eine Sitzgelegenheit, die sich nicht ständig unter seinem Allerwertesten hin und her bewegte und seinen ohnehin schmerzenden Rücken noch mehr peinigte. Vor allem aber hoffte er auf einen erquickenden Becher Bier, gebraut von Hannes’ Weib Gretel, deren Braukunst er über die Landesgrenzen hinaus rühmte.
Voller Schwung stieß Amling die Tür zur Schankstube auf. „Hannes, bist du hier?“, rief er in den Raum, der einzig durch das Tageslicht, das durch die gelblichen Butzenscheiben fiel, mäßig erhellt wurde.
Erschrocken zuckte der Angerufene zusammen. Es dauerte einen kurzen Augenblick, bis Hannes erkannte, dass es sich nur um Amling handelte, und nicht um sein, vorzeitig zurückgekehrtes, liebendes Eheweib.
Erleichtert erhob er sich von der Bank und begrüßte seinen Freund mit breitem Grinsen und einem kräftigen Handschlag.
„Matthes, bin ich froh dich gesund zu sehen. “
„Gott zum Gruße auch dir Hannes.“
„Komm her. Setz dich und spül dir erst mal den Staub aus der Kehle.“ Hannes deutete auf den Krug, der auf dem Tisch stand, und nahm einen Becher aus dem Regal hinter dem Schanktisch. „Ist ein ganz ein besonderer Tropfen. Gleichsam ein gesegnetes Scherflein.“ Er zwinkerte belustigt. „Eine Imßt richt‘ ich dir auch gleich. Die Weiber und auch meine Buben sind alle außer Haus.“
Hannes verschwand in die gegenüberliegende Küche.
Wein? Na, was soll’s, urteilte Amling und schenkte sich den Becher randvoll. Er nahm einen großen Schluck und stutzte. In dem Moment kam Hannes mit einem Holzbrett zurück, auf dem sich kalter Braten, Zwiebeln, Käse und Brot stapelten.
„Der Pfründner ist bei dir kein Gastgeber“, stellte Matthes, beim Anblick der Köstlichkeiten, grienend fest.
„Noch werden die Mäuler meiner Familie satt“, bestätigte Hannes. „Aber was sagst du zu diesem himmlischen Säftchen?“
„Nun, erwartet und gehofft hatte ich auf das gute Bier, von deinem Weib, aber ...“
„Ja, ja, das bekommst du auch noch“, unterbrach ihn Hannes. „Aber sag, hast du jemals einen solchen Rebensaft gekostet?“
Matthes setzte den Becher erneut an die Lippen. „Ich muss gestehen … nein, einen solchen Tropfen habe ich noch niemals getrunken. Aus welchem Gebiet, oder besser gefragt, aus wessen Keller stammt diese Köstlichkeit?“
Hannes lachte spitzbübisch. „Wie heißt es so schön? Gottes Wege sind unergründlich und seine Absichten rätselhaft.“
„Ha, ha“, keckerte Matthes. „Wenn du Bibelworte in den Mund nimmst, dann hör ich den Teufel das Feuer schüren. Komm, erzähl schon, welche Schandtat hast du diesmal wieder vollbracht, du alter Halunke.“
Hannes setzte sich, goss in aller Ruhe seinen Becher voll und trank ihn in einem Zug aus und wischte mit dem Handrücken über seine Lippen.
„Keine Schandtat, mein lieber Freund, eher einen Spaß und unserem Fauth habe ich dadurch zusätzlich aus einer misslichen Lage geholfen. Dafür wird er mir allzeit dankbar sein, das glaube mir.“
„Der Fauth?“, Matthes bekam große Augen. „Lass hören.“
Hannes beugte sich über den Tisch. „Genau diesen guten Tropfen“, er zeigte auf die Becher, „lassen sich die Pfeffersäcke nun auch schmecken.“
Und dann erzählte er, im Flüsterton, wie er drei große Fässer dieses edlen Rebensafts des Nachts, derweil die Brüder in der Kirche in ihre Gebete versunken waren, aus der Abtei entwendet und in den Ratskeller geschafft hatte.
„Aber, weil der Bruder Cellerar vor einigen Tagen seinen Lagerbestand mal wieder zu gründlich begutachtet hatte und mit schmerzendem Kopf und Gliederreißen daniederlag, konnte keiner mit Gewissheit sagen wann der Wein die heiligen Gewölbe verlassen hatte.“
„Aber, woher konntest du wissen, dass Bruder Durstig …?“
„Das, mein lieber Matthes bleibt mein Geheimnis.“ Hannes Augen blitzten verschmitzt und er hob erneut seinen Becher.
„Auf die göttliche Stiftung.“
„Eines Tags holt dich der Teufel“, murmelte Matthes und grinste.
Die beiden Freunde schlugen ihre Becher aneinander und ließen sich die dunkelrote Flüssigkeit durch ihre Kehlen laufen.
Indessen schlenderten die weiblichen Mitglieder der Bergmannschen Familie weiter durch die Reihen der Marktstände. Beeindruckt von den roten, goldenen und silbernen Kordeln und Bändern, die zur Schnürung und Verzierung an festlicher Kleidung Verwendung fanden, entfuhr den Mädchen oftmals ein sehnsüchtiges „Oh“ und „Ah.“
Inmitten der sich bald scharenweise durch die engen Zwischenräume der Stände drängelnden Menschen, tänzelten Gaukler und auffällig herausgeputzte Schausteller. Teils nur durch Gestik oder mit lauten Schellentrommeln, Gesang und Musik, buhlten sie um die Aufmerksamkeit ihrer Zuschauer.
Freilich mischte sich, bei solch buntem Treiben, desgleichen Gaunergesindel unters brave Volk. Just in dem Moment, derweil Elisabeth und ihre Schwestern die seidenen Brusttücher und die schweren, mit Goldfäden durchwirkten Stoffe bestaunten, ertönte von der anderen Seite des Platzes lautes Geschrei.
„Räuber, Diebe! Halt, bleib stehen!“
Gleich einem Wiesel huschte ein schmächtiger Bursche inmitten der Marktstände hindurch.
„Haltet den Dieb“, brüllte ein fülliger Kaufmann.
Mit hin- und herschwingen Armen, versuchte er hinterherzukommen, aber der Abstand zwischen den beiden wurde zusehends größer.
Der flinke Beutelschneider riskierte einen kurzen Blick über seine Schulter und prallte just in dem Moment gegen Elisabeth. Dabei fiel eine schwere Geldkatze, mit sattem Plumps auf das Pflaster. Für einen Sekundenbruchteil sah Elisabeth in zwei vergnügt leuchtende, blaue Augen. Dann war der kleine Halunke behände in einem angrenzenden schmalen Gässchen verschwunden.
Beherzt griff Elisabeths Mutter nach dem Beutel, um ihn vor weiteren Langfingern in Sicherheit zu wissen, und einen Augenblick später stand der rechtmäßige Besitzer vor ihnen.
Die ungewohnt schnelle Fortbewegung seines wohlgenährten Körpers hatte den Kaufmann an seine Grenzen gebracht. Schweißperlen liefen von seiner Stirn über seinen hochroten Kopf hinab in seine Halskrause.
„Gott zum Gruße, werte Bürgersfrau“, keuchte er. „Ich danke Euch. Ihr habt mich gerettet. Wie ist Euer Name?“
„Ich bin die Gretel Bergmann“, antwortete Elisabeths Mutter ohne Zögern. „Mein Mann ist bekannt als der SCHWARZE HANNES. Uns gehört die Häckerwirtschaft, gleich da vorn.“ Sie deutete in Richtung ihres Hauses. „Ihr könnt ja mal reinschauen, wenn’s genehm ist.“ Ein pfiffiges Lächeln umspielte ihre Lippen. Sodann fuhr sie im ernsten Ton fort. „Ich rate Euch, Euren Geldbeutel sicherer zu verwahren. Diebesgesindel treibt sich überall herum. Gerade bei solch einer Juchhei.“ Bevor der verdutzte Kaufmann zu einer Erwiderung fähig war, drückte Gretel ihm seine Geldkatze in die feuchten Hände, nickte freundlich und wünschte ihm „Einen gesegneten Tag“.
Binnen Kurzem war die kleine Ausschreitung vergessen und die Leute wandten sich einem Gaukler zu, der sein Publikum staunen ließ, indem er sich brennende Fackeln in den Mund steckte. Ausgerechnet vor dem Eingangsbereich des Klosters hatte sich eine Zigeunergruppe niedergelassen. Dunkelhäutige Tamburin schwingende Frauen bewegten sich aufreizend zu rhythmischen Klängen, die ihre Begleiter aus Fideln und Pfeifen hervorzauberten.
Einige, besonders gottesfürchtige Seligenstädter Weibsleute schüttelten angewidert die Köpfe; umso herausfordernder schwangen die Zigeunerfrauen ihre Röcke und lachten den Frömmlerischen direkt ins Gesicht.
Mittlerweile schlug die Glocke der Abteikirche zur sechsten Stunde und Gretel besann sich auf das Mittagsmahl.
Das gebratene Fleisch, das Käthe, ihre Dienstmagd schon gestern vorbereitet hatte, stand abgedeckt in der Speisekammer. Frisches Brot und Zwiebeln dazu und das Essen für heute wäre auf dem Tisch. So hatte Gretel das geplant. Was sie nicht wusste, war, dass Hannes zusammen mit seinem Gast sich den Braten soeben schmecken ließ.