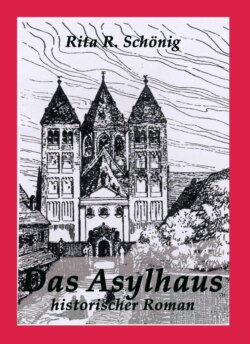Читать книгу Das Asylhaus - Rita Renate Schönig - Страница 8
Konrad
ОглавлениеSeit endlos langen Minuten starrte Elisabeth mit offenen Augen in die Dunkelheit. Sie konnte den anbrechenden Morgen kaum erwarten. Beim ersten Lichtschein, der zaghaft durch die Butzenscheiben drängte, hielt sie es nicht länger aus. Sie schlüpfte aus dem Bett, das sie mit ihren Schwestern, der elfjährigen Anna und der neunjährigen Marie teilte. Beide schliefen tief und fest.
Hastig warf sie sich den braunen Leinenkittel über ihr Hemd und eilte aus der Stube. Einen Moment zögerte sie vor der Kammer der Eltern. Einzig das regelmäßige Schnarchen des Vaters drang an ihr Ohr. Ihre Mutter logierte mit dem drei Tage alten Zuwachs der Familie noch immer in der oberen Mansardenkammer. Ähnliche Schlafgeräusche kamen aus der Stube ihrer Brüder, dem vierzehnjährigen Christoph und Elisabeths Zwillingsbruder Martin.
Sie huschte über den Flur, den nur eine kleine Luke zum Hof hin erhellte und im Winter mit einer Schweinehaut abgedeckt wurde. Die verräterisch knarrenden Stellen auf der steilen Treppe vermeidend, stieg sie hinab und verharrte auf der untersten Stufe. Abgestandener Bier- und Essensgeruch waberte aus der offenstehenden Tür des Schankraums und in der gegenüberliegenden Küche entfachte Käthe gerade die Glut in der Feuerstelle neu. Sie bückte sich nach einem Holzscheit, streckte dabei Elisabeth ihr ausladendes Hinterteil entgegen und ließ das Holz in die obere Öffnung des Ofens fallen, sodass feine rot glühende Funken in die Höhe tanzten. Dann verschloss sie die Luke mit einer schweren Eisenplatte.
Seit Elisabeth sich erinnerte, lebte Käthe im Haushalt, und der Vater äußerte einst scherzhaft, sie gehöre zu Mutters Heiratsgut.
Käthe war jeden Morgen die Erste, die im Haus rumorte und die Letzte, die zu Bett ging. Sie sprach wenig, über sich schon gar nicht, und erledigte ohne Klagen ihre Tagespflichten.
Leichtfüßig schlich Elisabeth durch den Flur und die drei ausgetretenen Sandsteinstufen hinab in den Innenhof, vorbei am Stall, in dem die Schweine und Kühe untergebracht waren oder manchmal merkwürdige Gestalten ... nach Käthes Meinung.
Burgel und der Braune, die beiden Kaltblüter wieherten leise, als würden Sie Elisabeth begrüßen, indessen aus dem Hühnerstall noch kein einziger Laut drang. Hinter der Mauer, die die elterliche Hofreite begrenzte gluckerte der Klosterbach, der das große hölzerne Rad der „Roten Mühle“ in Bewegung hielt.
Elisabeth öffnete die Holzpforte und setzte ihre nackten Füße ins morgenfeuchte Gras. Die ersten zaghaften Strahlen der Sonne bezwangen eben die Kämme der Spessarthöhen und badeten den Sandstein des Mühlengebäudes in glutrotem Licht. Einen Moment ergötze sie sich an diesem Anblick bevor sie am Badehaus vorbei, durch den Häuserwinkel zur Maingasse eilte. Vor ihr, auf der anderen Seite, erhoben sich die romanischen Türme der Basilika, die zu einem späteren Zeitpunkt dem ursprünglich karolingischen Gotteshaus hinzugefügt worden waren. Nach einem kurzen Blick die Maingasse entlang huschte Elisabeth durch die Öffnung in der Klostermauer und vorbei an der Laurentiuskapelle.
Erst seit einigen Jahren – und nur unter unablässigem Druck der Stadtoberen – genehmigte die Abtei das Durchqueren ihres geweihten Bodens für das gemeine Volk. Insbesondere für die Totenträger war es immer eine Tortur, die Leichenkiste durch die gesamte Oberstadt zu tragen, um den Verstorbenen auf dem Gottesacker neben der Gemeindekirche „Zu Unserer Lieben Frau“ zur letzten Ruhe zu betten.
Das jetzt grob in die Mauer geschlagene Loch war eben mal so groß, dass eine Totenkiste samt ihren Trägern hindurchpasste und zeugte von der Missbilligung des Abtes gegenüber derart Vergünstigung. Desgleichen bedeutete dieses „Zugeständnis“ vonseiten der Abtei einen weiteren Sieg der Seligenstädter, im immerwährenden Machtspiel zwischen der Bevölkerung und dem Klerus.
An der östlichen, dem Main zugewandten Klostermauer zog Elisabeth einen Schlüssel hervor und öffnete das Türchen. Sofort verbarg sie sich hinter der Hecke im Inneren. Vor ihr erstreckte sich der Konvent Garten – Konrads Reich. Friedlich, nahezu andächtig präsentierten sich die gepflegten Kräuter- und Gemüsebeete im frühmorgendlichen Licht.
Während Elisabeth ungeduldig wartete, schweifte ihr Blick zu dem mächtigen Vierungsturm der Basilika, dessen ohnehin weithin sichtbares Kreuz auf der Spitze jetzt im Sonnenlicht erstrahlte, wie von einer Korona umgeben.
***
Auch in dieser Nacht hatte Bruder Konrad kaum ein Auge zugetan. In den kurzen Traumphasen ereilten den tief gottesfürchtigen Benediktinermönch Erinnerungen, die er in den letzten Jahren erfolgreich verdrängt zu haben glaubte; weshalb er einen Großteil der vergangenen Nächte kniend auf dem harten Steinfußboden des Kreuzgangs verbracht hatte. Trotz etlicher Vaterunser und Rosenkränze setzte der gewünschte Erfolg nicht ein. Allein die Kälte lähmte seine Knochen und es kostete ihn Mühe aufzustehen.
„Weiche von mir Satan“, flüstert er in Gedanken auf dem Weg zur Kapelle um mit seinen Brüdern, seiner eigentlichen Familie, am ersten Morgengebet, der „Virgil“ teilzunehmen.
Im Alter von vier Jahren brachte Konrads Vater, Stephan Herdegen, ein angesehener Münzmeister aus Nürnberg, ihn nach Seligenstadt, nachdem die Mutter bei der Geburt des jüngsten Bruders und ebenso das Kind gestorben waren, und anschließend eine Seuche den Rest der Familie dahingerafft hatte. Stephan Herdegen wusste sich keinen besseren Rat, als seinen einzigen, noch lebenden Sohn in die gütigen Hände des Abts Philipp Merkel, im Kloster der Benediktiner zu Seligenstadt zu geben und damit weit weg von der wütenden Seuche.
Mit Abt Philipp pflegte Herdegen freundschaftliche Bande, als dieser noch Abt eines Klosters im Rheingau gewesen war und immer, wenn Stephan Herdegen auf seiner Reise von Nürnberg nach Frankfurt in Seligenstadt Zwischenstation machte, versäumte er es nicht, dem Abt einen Besuch abzustatten. Beim Genuss von etlichen Bechern Wein disputierten die beiden bis spät in die Nacht hinein, sowohl über kirchliche wie auch profane Dinge und tauschten Neuigkeiten, aus den jeweiligen Regionen aus. Daher sah es Abt Philipp als seine heilige Pflicht, dem langjährigen Freund die schwierige Aufgabe der alleinigen Erziehung seines Sohnes abzunehmen und Konrad eine neue Heimstatt zu geben.
Von Beginn an kümmerte sich Bruder Wenzel um den verängstigten schmächtigen Knaben und päppelte ihn körperlich wie auch seelisch auf, wobei er bei der geistigen Nahrungszufuhr mehr Erfolg hatte. Egal was Bruder Wenzel dem kleinen Konrad an förderlich Nährendem zukommen ließ, er behielt immer seine schlaksige knochige Gestalt.
Konrad seinerseits fasste schnell Vertrauen zu seinem Lehrer und väterlichen Freund und verschlang gierig, was der ihm beibrachte. Sein besonderes Interesse galt der Kräuterkunde und Bruder Wenzel sah es mit Freuden. Im Laufe der Jahre wusste er in Konrad einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben und, falls es Gott gefiele, ihn aus seinem irdischen Dasein zu erlösen und in sein ewiges Reich aufzunehmen, würde er beruhigt diesem Ruf folgen können … so dachte er. Doch Bruder Wenzels Traum wurde mit einem Schlag zunichtegemacht.
Ein Gichtanfall des Kurfürsten und Erzbischofs Wolfgang von Dalberg, aufgrund eines allzu üppigen Festmahls, überschattete dessen letzten Besuch in der Abtei zu Seligenstadt. Der Landesfürst musste zwei Tage lang das Bett hüten, woraufhin sein Leibarzt die klösterliche Küche für die Erkrankung seines Bischofs verantwortlich machte.
Auf Geheiß Abt Philipps stellte Konrad eine Reihe Heiltränke her, die tatsächlich dem Erzbischof wieder auf die Beine halfen.
„Einen wie Ihn könnten Wir gut um uns haben“, bemerkte der Landesfürst daraufhin anerkennend.
Abt Philipp wusste, was das bedeutete: Konrad würde nach Mainz befohlen, in diesen Sündenpfuhl. Der Abt machte sich größte Sorgen. Nur zu gut kannte er die unsittlichen Lebensbedingungen, die im bistümlichen Zentrum herrschten. Selbst wenn Erzbischof von Dalberg über diese exzessiven Ausschweifungen in seinem Umfeld erhaben sein dürfte - davon ging Abt Philipp aus - so waren sie doch eine Tatsache. Überdies traute er dem Leibarzt des Kurfürsten nicht über den Weg. Der würde sich nicht so ohne weiteres mit einem Nebenbuhler abfinden und unter Umständen Konrad das Leben im wahrsten Sinne des Wortes zur Hölle machen.
Just erst hatte Konrad die Gelübde der Bruderschaft der Benediktiner abgelegt und Abt Philipp war überzeugt, dass der Jungmönch noch nicht bereit war, sich in einer fremden, moralisch nicht einwandfreien Umgebung zu behaupten. Gleichwohl konnte und durfte er sich dem Begehren seines Kurfürsten nicht entgegensetzen.
So reiste Konrad im Frühjahr 1590 ins erzbischöfliche Ordinariat und Wolfgang von Dalberg schickte den Ordensbruder Wolfgang Keller aus seinem eigenen Konvent ins Seligenstädter Kloster.
„Auf diese Weise, entsteht der Abtei keine Schmälerung im sakralen und im persönlichen Bereich“, erklärte er in dem Schreiben, das er Bruder Wolfgang mit auf den Weg gab.
Für Konrad bedeutete diese Änderung in seinem Leben keineswegs Freude, sondern einfach nur Furcht. Daran änderte auch der feudale Raum nichts, in den ihn ein Priesterschüler führte, nachdem er im kurfürstlichen Konvent angekommen war.
In der ersten Nacht schlief er ermattet von der Reise und dem ungewohnt weichen Bett. Doch in der Folgenden weckten ihn seltsame Geräusche. Er meinte, ein Flüstern zu hören, dann wieder ein Kichern wie von Weibsvolk wahrzunehmen. Er fegte den Gedanken als ad absurdum und ein Produkt einer Sinnestäuschung zur Seite. In diesem Teil der Residenz waren die engsten Berater des Kurfürsten untergebracht. Da hatte Weibervolk nichts zu suchen.
In der nächsten Nacht vernahm er aber das gleiche Spektakel. Letztendlich öffnete er einen Spalt breit seine Tür. Im spärlichen Mondlicht, das durch die bleiverglasten Fenster fiel, erkannte Konrad, dass zwei Weiber mit raschelnden Röcken hinter einer Tapisserie-Ware verschwanden. Neugierig zog er den Wandbehang zur Seite und entdeckte eine Nische und eine Tür. Vorsichtig legte er sein Ohr an die selbige. Dahinter vernahm er leise Stimmen und Gekicher. Er konnte sich keinen Reim darauf machen, als unvorhergesehen die Tür geöffnet wurde und Konrad erschrocken zurückwich.
„Oh. Ihr müsst der junge Klosterbruder sein, dem unser teurer Fürst so wohlwollend zugetan ist.“ Nicht im Geringsten beunruhigt raunte ihre samtene Stimme in sein Ohr.
Konrad hingegen war verwirrt. Im selben Augenblick legte das Weib einer ihrer Hände auf seine Brust. Mit dem ganzen Gewicht ihres Körpers drückte sie ihn an die Wand, dass es ihm den Atem nahm. Er wollte fliehen, starrte jedoch die Frau nur an. Einen Moment später packte ihre erfahrene Hand unter seine Kutte. Ein unbekannter, aber wohliger Schauer durchfuhr seinen Körper. Panik überkam ihn.
„Welch Freude“, wisperte die Stimme an seinem Ohr und ihre Zunge fuhr über seine Lippen. „Solltest du meiner bedürfen, junger Bruder; ich bin stets bereit. Doch heute habe ich andere Verpflichtungen.“ Mit einem kurzen kehligen Lachen rannte sie zur hinteren Treppe.
Konrads gesamter Leib schien lichterloh zu brennen. Er litt Höllenqualen. Weshalb hatte er dieses Weib nicht von sich gestoßen? Der Geist soll die Kontrolle über den Körper haben und nicht umgekehrt, so lautete eine Regel der Benediktiner. Warum war er so schwach?
In seinem Zimmer überkam ihn der Wunsch, Dominikanermönch zu sein, dann hätte er sich jetzt geißeln dürfen – sogar müssen. Aber den Benediktinern war die Selbstbestrafung durch körperliche Züchtigung verboten. Hingegen war es nicht verboten, anstatt des weichen Bettes den harten Fußboden als Nachtlager zu wählen.
Sein gesamtes Vertrauen in Gottes Diener auf Erden war ins Wanken geraten. Das entsetzlichste aber war, jetzt musste er dem Gerücht Glauben schenken, das hinter vorgehaltener Hand unter den klerikalen Domestiken die Runde machte.
In der ersten Zeit nach dem Zwischenfall empfand Konrad Scham, später nur Trauer über dieses Sodom und Gomorra, in dem er verdammt war zu leben. Sein sehnlichster Wunsch war es, wieder in sein Kloster nach Seligenstadt und zu Bruder Wenzel zurückzukehren.
Schneller als erwartet sollte sich diese Hoffnung erfüllen.
Am 22. Dezember 1590, eine Stunde nach Ende der Komplet, ließ ihn der Kurfürst zu sich rufen. Er hielt ein Schreiben in den Händen, das ihm augenfällig schwer auf den Magen schlug, denn er kam gleich zur Sache.
„Prior Rudensherer aus deinem Heimatkloster teilt mir mit, dass mein geschätzter Glaubensbruder Abt Philipp schwer erkrankt daniederliegt und es wäre der Wunsch des Abts dich noch einmal zu sehen, bevor er seine Augen für immer schließen würde, um zu unserem Herrn zu gehen.“
Einige Sekunden des Schweigens erfüllten den Raum. Einen tiefen Atemzug später fuhr der Erzbischof fort. „Wir erteilen dir hiermit die Erlaubnis nach Seligenstadt in die Abtei zurückzukehren, für immer.“
Konrads Herz hüpfte vor Freude. Gleichzeitig überfiel ihn schlagartig Schuld. Seinen Wunsch, wieder in sein geliebtes Kloster, in dem ihm keinerlei Gefahr drohte zurückkehren zu dürfen, hatte er jeden Tag in seine Gebete eingefügt. Doch dadurch, davon war Konrad überzeugt, hatte er sich Gottes Willen widersetzt. Wie sonst konnte es sein, dass Abt Philipp dafür mit dem Leben bezahlte?
Nach all den Jahren saß – wenn auch tief verborgen – dieser Stachel noch immer in seinem Herzen. Und in den letzten Nächten schien es, als bohre er sich erneut an die Oberfläche. Doch was war der Auslöser, für die wiederkehrenden Albträume in denen er diese unmoralische Weibsperson vor sich sah? Noch erschreckender war aber, dass sich das Gesicht des Weibs in das liebenswerte Antlitz von Elli verwandelte.
Prüfend ertastet Konrad in den weiten Ärmeln seiner Kutte das kleine, in weiches Leder gebundene Buch, das er mit einem Band an seinem Arm befestigt hatte. Wochenlang schrieb er Rezepturen verschiedener Heilpflanzen auf die schneeweißen Seiten. Elli sollte kein Fehler unterlaufen, wollte sie von dem Medizinwissen Gebrauch machen. Und heute, an ihrem sechzehnten Geburtstag, würde er ihr dieses Büchlein überreichen.
Konrad seufzte. Wie konnte er dem liebsten Wesen auf Gottes Erde in die Augen sehen, mit dem Wissen, dass er des Nachts unzüchtig von ihr träumte?
„Alis suis obumbrabit tibi, et sub pennas eius confugies“, ertönt die klare Stimme des Priors und brachte Konrad wieder in die Gegenwart zurück. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln unter seinen Schwingen findest du Zuflucht.
„Scutum et lorica veritas eius, non timeris a timore nocturno. Schild und Schutz ist dir seine Treue, du brauchst den Schrecken der Nacht nicht zu fürchten.“ Das laute Canto der Brüder hallte von den massiven Steinwänden zurück.
Konrad wähnte sich in einer riesigen Glocke. Jeder Ton dröhnte in seinem Gehirn.
Ja, die Schrecken der Nacht. Herr lass mich erkennen, damit ich Buße tun kann, flehte er lautlos.
„… hac die mysterio celebrato, in pace tua securi a malis omnibus quiescamus, et in tua resurgamus laude gaudentes. Per Christum Dominum Nostrum.” Lass uns ohne Furcht vor allem Bösen ruhen und in Freude wieder auferstehen, um dich zu loben. Durch Christus unseren Herrn.
Unachtsam antwortete Konrad im Einklang mit seinen Brüdern „Amen“, bekreuzigte sich und verließ schweren Herzens die Kirche.
Aus der nahen Klosterküche zog der Duft frisch gebackener Pfannkuchen durch den Kreuzgang. Konrads leerer Magen rebellierte. Aber er ignorierte den Hinweis. Indessen seine Ordensbrüder kichernd und leise flüsternd im Sommerrefektorium verschwanden, um ein leichtes Frühmahl einzunehmen. Er selbst trat auf den Wirtschaftshof hinaus. Es schmerzte ihn gar sehr, zu beobachten wie der Schlendrian auf das Schaffen im Kloster übergriff. Denn, obwohl zurzeit mindestens etwa achtzig Leute zum Klostergesinde zählten, sah oder hörte er weder in den Werkstätten, noch bei den Ställen eine Menschenseele arbeiten. Einzig an der Klostermühle luden der Müller und sein Gehilfe Kornsäcke von einem Wagen ab. Zu Zeiten von Abt Philipp oder Abt Johannes III. wäre solcher Müßiggang nicht vorgekommen. Doch dem jetzigen Abt Martinus, freilich ein frommer Diener Gottes, fehlte es von Anfang am nötigen Durchsetzungsvermögen.
Schon bald nachdem er von Erzbischof Wolfgang von Dalberg die Abtswürde angetragen bekam, zeigte sich, dass er den Aufgaben und der Verantwortung nicht gewachsen war. Die an Martini zu entrichteten Gefälle der Zentdörfer blieben aus, sodass das Kloster selbst in geldliche Misslichkeit kam und seinerseits nicht in der Lage war, die Abgaben an den Kurfürsten zu begleichen. Ebenso wie Abt Martinus die Aufsicht über die geschäftlichen Verhältnisse einbüßte, so erkrankte gleichsam die Moral der Mitbrüder. Häufig hielten sich einige lieber im Weinkeller auf, als sich um anfällige Arbeiten zu kümmern. Aber Konrad stand nicht der Sinn zu urteilen. Dennoch wäre es nur eine Frage der Zeit, bis der Abtei eine Visitation bevorstand. Der Erzbischof, gleichzeitig Landesherr und oberste gesetzgebende Gewalt würde sich auf Dauer nicht hinhalten lassen.
Nur noch wenige Schritte, dann würde er seiner Elli ein unvergessliches Geschenk machen. Seiner Elli? Welch seltsame Formulierung bemächtigte sich seiner Gedanken? Er hielt inne und lehnte seinen Kopf an die kühle Sandsteinwand des Abteigebäudes.
Hätte er nicht längst erkennen müssen, dass Elli vom einstigen Kind zur Frau herangewachsen war? Ihre Fragen drehten sich immer häufiger um weltliche Dinge, anstatt um Gott und die biblischen Glaubenssätze. Ja doch, bemerkt hatte er es wohl, aber er wollte dieses wissenshungrige liebenswerte und eigensinnige Wesen nicht verlieren, das sich in sein kontemplatives Mönchsdasein gedrängt und seinen spirituellen Wirkungskreis durcheinandergebracht, gleichzeitig aber auch neu belebt hatte. Oh, was für ein Narr er doch war. Wie hatte er nur annehmen können, dass die Zeit für sie beide stillstehen würde?
Er faltete die Hände und hob seinen Blick zum blassblauen Morgenhimmel hinauf. „Danke, Herr“, murmelte er. „Hab Dank für deine unendliche Güte. Zu lange habe ich mich gegen die Wahrheit gesträubt. Doch du in deiner Langmut zeigst mir wieder den richtigen Weg.“
***
Elisabeth sah die hagere Gestalt ihres geliebten Konrad um die Ecke des Abteigebäudes biegen. Den Kopf gesenkt und verdeckt durch die tief ins Gesicht gezogene Kapuze und die Hände in den weiten Ärmeln der schwarzen Kutte verborgen, näherte er sich dem Platz, an dem sie wartete. Sein ansonsten beschwingter Gang wirkte heute schleppend und müde, so, als würde er eine schwere Last hinter sich herziehen.
„Konrad, endlich.“ Kaum, dass er ihr Versteck erreicht hatte, streckte sie ihren dunkelbraunen Lockenkopf hervor und ihre dunklen Augen strahlten ihn an. „Ich habe schon befürchtet, du kommst heute auch nicht.“ Elisabeth verzog leicht ihren Mund.
Erneut spürte Konrad das Blut in seinen Adern pulsieren.