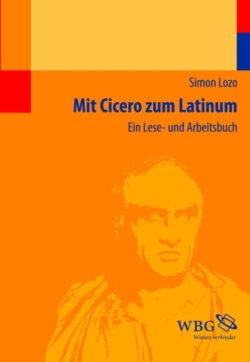Читать книгу Mit Cicero zum Latinum - Simon Lozo - Страница 10
3 Das idealisierte Bild von der Staatsverfassung
ОглавлениеZunächst ist festzuhalten, dass es im antiken Rom, anders etwa als in Athen, keine geschriebene Verfassung gab. Als verlässliche Basis, als ungeschriebenes Gesetz, galt hier der mos maiorum.
Die „Verfassungsväter“ der römischen Republik griffen auf Staatsverfassungen der griechischen Antike zurück. Der Einfluss Spartas ist unübersehbar: den zwei spartanischen Königen entsprechen in Rom die zwei Konsuln, dem Ältestenrat in Sparta (gerusía) der Senat („Ältestenrat“, vgl. „Senior“). Hierbei ist das lateinische Wort senatus wohl ein Übersetzungslehnwort aus dem Griechischen. Der Senat setzte sich zunächst aus den Oberhäuptern der Patrizierfamilien zusammen, später, im Zuge der Ständekämpfe, wurde er „durchlässiger“ und wurde zur Versammlung der ehemaligen höheren Beamten.
Die Volksversammlung in Rom ist ein demokratisches Element, z.B. in der attischen Demokratie als „ekklesía“ bezeichnet.
In Griechenland war der relativ kleine, überschaubare Stadtstaat, die pólis, das Ideal (daher unser Wort „Politik“), eine bürgerliche Gemeinschaft, in der, wie im Falle der attischen Demokratie, die Bürger sich selbst unmittelbar regierten (direkte Demokratie); demgegenüber sah man die Autokratien des Ostens, z.B. das persische Großreich mit seinem „Großkönig“, nicht als Staaten an, da der Einzelne sich dort nicht politisch betätigen konnte (politeúesthai). Aus diesem Grunde war, zumal im Rückblick auf die am Ende autokratische Königsherrschaft, auch in Rom das Wort rex damals ein Reizwort.
Die römischen Theoretiker, z.B. Cicero, sprechen von einer auf Gleichberechtigung beruhenden libera res publica. So die Theorie in Rom; nur sah die Realität anders aus, hier klaffte, wie gezeigt, ein „Widerspruch, der geradezu ungeheuerlich zu nennen ist“ (MEYER).
Tatsächlich lag ja die Leitung des Staates bei immer denselben, wenigen aristokratischen Familien (ca. zwei Dutzend).
Den locus classicus für das idealisierte Bild von der Verfassung der römischen Republik finden wir bei POLYBIOS, der im 2. Jh. v. Chr. lebte und mit seiner Verfassungstheorie stark auf Cicero wirken sollte. Dieser griechische Historiker war als Kriegsgefangener nach der Eroberung Griechenlands nach Italien gekommen und lebte und wirkte im sog. Scipionenkreis, einer Gruppe gebildeter Römer, die sich „aufklärerisch“ für die Integration griechischen Bildungs- und Gedankengutes in Rom einsetzten, was damals nicht von allen gutgeheißen wurde; so ließ z.B. der erzkonservative Römer Cato d.Ä. im Jahre 155 eine ganze Gruppe hoch angesehener griechischer Philosophen wegen angeblicher Unterwanderung altrömischer Traditionen des Landes verweisen – ein Vorgang, der 100 Jahre später, also zur Zeit Ciceros, wohl nicht mehr denkbar gewesen wäre, da sich zu diesem Zeitpunkt die griechische Bildung längst in Rom etabliert hatte, woran auch Cicero entscheidend gearbeitet hatte.
Gemäß POLYBIOS, auf den Cicero in seinem Werk De re publica (s.u.) rekurriert, ist es unmöglich, ein besseres Verfassungssystem als das römische zu finden; er schreibt unter Zugrundelegung der in der griechischen politischen Theorie (PLATON und ARISTOTELES) erarbeiteten Klassifikationsparameter und Terminologie:
Es gab (…) also drei Teile, die im Staat Gewalt hatten. So gerecht und angemessen aber war alles geordnet, waren die Rollen verteilt und wurden in diesem Zusammenspiel die staatlichen Aufgaben gelöst, dass auch von den Einheimischen niemand mit Bestimmtheit hätte sagen können, ob die ganze Verfassung aristokratisch, demokratisch oder monarchisch war. Und so musste es jedem Betrachter ergehen. Denn wenn man seinen Blick auf die Machtvollkommenheit der Konsuln richtete, erschienen die Staatsformen vollkommen monarchisch und königlich, wenn auf die des Senates, wiederum aristokratisch, und wenn man auf die Befugnisse des Volkes sah, erschien sie unzweifelhaft demokratisch.
(Übers. von SCHÜTZ/DE BUHR u.a.)
Diese auch in Ciceros Augen ideale Mischverfassung findet, wie KISSEL hervorhebt, ihren architektonisch-topographischen Niederschlag auf dem Forum Romanum: Die – auch heute noch erhaltene – curia war der Tagungsort des aristokratischen Senats, das in der Nähe liegende comitium (von co-ire, also „zusammenkommen“) war der Versammlungsort des Volkes, die regia, ein Kultbau aus der Königszeit, nahe dem Vesta-Tempel gelegen, zunächst „Königspalast“, später Sitz des höchsten Priesters pontifex maximus, steht für die Monarchie.