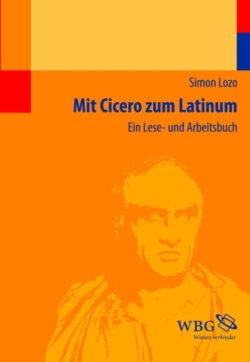Читать книгу Mit Cicero zum Latinum - Simon Lozo - Страница 18
2 Theorie des orator perfectus
ОглавлениеIn Ciceros Ausbildung wurde das Fundament gelegt für die später von ihm verfochtene Bildungsprogrammatik, gemäß welcher der Redner und der Philosoph eine organische Einheit bilden; das Bild des Redners koinzidiert mit dem des Philosophen: Für einen vollkommenen Redner reicht es nicht, nur disertus (rhetorisch versiert) zu sein, er muss auch eloquens sein, d.h. er braucht eine umfassende, besonders philosophische Bildung; vice versa muss der Philosoph neben seiner Sachkenntnis auch rhetorisch adäquat ausgebildet sein, er muss ornate dicere können. Diese Form der Verbindung von Rhetorik und Philosophie war im klassischen Griechenland so nicht vorhanden; bei PLATON Z.B. sind diese beiden Disziplinen Antipoden: Die Philosophie sei eine Wissenschaft und suche die Wahrheit, die Rhetorik dagegen sei bloß „Routine“ und „Schmeichelei“. Freilich wird bei dem Griechen ISOKRATES die Rhetorik höher bewertet: Sie solle praxisnahe Philosophie sein. Diesen Gedanken greift Cicero auf und expliziert sein Bildungsprogramm in den drei Büchern De oratore, die er in der ersten Phase seiner philosophischen Schriftstellerei verfasste (s.u.). Dieses Werk ersetzte, wie er selbst sagt, sein Jugendwerk De inventione, in dem er schon deutlich seine wissenschaftliche und bildungsprogrammatische Lebensaufgabe formuliert hatte, nämlich Rhetorik mit Philosophie zusammenzuführen. Ciceros vielleicht griffigste Definition der eloquentia finden wir in seinen Oratoriae partitiones; sie kann hier geradezu als Motto dienen: Nihil est aliud eloquentia […] nisi copiose loquens sapientia.
Wie das Spätwerk Brutus, dem der oben zitierte „Ausbildungsbericht“ entnommen ist, ein Werk, dem in der europäischen Kulturgeschichte eine exponierte Stellung einzuräumen ist, weil hier zum ersten Mal die Konzeption einer Literaturgeschichte anzutreffen ist, in der Cicero sich selbst – unausgesprochen – als Kulminationspunkt der literarischen Entwicklung Roms sieht, stammt auch das Werk Orator aus der zweiten Phase (s.u.) seiner philosophisch-rhetorischen Schriftstellerei während der Diktatur Caesars, während der nox rei publicae, als für das freie Wort kein Raum war. Die Schrift Orator widmet der Autor dem Redner und späteren Caesar-Mörder M. Iunius Brutus, hier entwickelt er u.a. die von den Griechen vorgezeichnete Lehre von den drei Stilhöhen: Tria sunt omnino genera dicendi, nämlich leve, medium und grave; mutatis mutandis kann man diese Dreiteilung auch ansatzweise auf Ciceros Gesamtwerk applizieren: Briefe, philosophische Schriften und Reden, klassifiziert nach dem Grad der Rhetorisierung. Auch wenn einige Briefe rhetorisch sehr ausgefeilt sind, so lebt doch der gewöhnliche Briefstil laut Cicero vom plebeius sermo: Quid enim simile habet epistola aut iudicio aut concioni, heißt es in einem Brief an Paetus aus dem Jahre 44.
Der folgende Textabschnitt aus dem Orator (14ff.) verdeutlicht Ciceros Forderung der Einheit von orator perfectus und philosophus, die Koalition von Rhetorik und Philosophie.
1 1 Positum sit igitur imprimis, quod post magis intellegetur: sine philosophia non
2 2 posse effici, quem quaerimus eloquentem; non ut in ea tamen omnia sint, sed ut
3 3 sic adiuvet ut palaestra histrionem; parva enim magnis saepe rectissime confe-
4 4 runtur. Nam nec latius atque copiosius de magnis variisque rebus sine philosophia
5 5 potest quisquam dicere, si quidem etiam in Phaedro Platonis hoc Periclen prae-
6 6 stitisse ceteris dicit oratoribus Socrates, quod is Anaxagorae physici fuerit auditor;
7 7 a quo censet eum, cum alia praeclara quaedam et magnifica didicisse, tum ube-
8 8 rem et fecundum fuisse gnarumque, quod est eloquentiae maximum, quibus ora-
9 9 tionis modis quaeque animorum partes pellerentur; quod idem de Demosthene
10 10 existimari potest, cuius ex epistulis intellegi licet, quam frequens fuerit Platonis
11 11 auditor, nec vero sine philosophorum disciplina genus et speciem cuiusque rei
12 12 cernere neque eam definiendo explicare nec tribuere in partes possumus nec
13 13 iudicare, quae vera, quae falsa sint, neque cernere consequentia, repugnantia vi-
14 14 dere, ambigua distinguere. Quid dicam de natura rerum, cuius cognitio magnam
15 15 orationis suppeditat copiam?
1 Z. 1 post – hier für postea; post wird nicht nur als Präposition, sondern auch, wie hier, als Adverb gebraucht.
2 2 quem quaerimus eloquentem – äquivalent mit: eloquentem, quem quaerimus
3 3 ut palaestra histrionem – Was Bühne, Schauspiel und Wettkampfspiel angeht, sind die Römer besonders von zwei Seiten beeinflusst, den Griechen (Drama) und den Etruskern (Gladiatorenspiele); das hat sich auch sprachlich niedergeschlagen: Aus dem Griechischen stammen z.B. theatrum und scaena (Bühne, daher unser Wort „Szene“), auch palaestra ist aus dem Griechischen entlehnt (Ringschule, Sportplatz), histrio (Schauspieler) stammt aus dem Etruskischen, ebenso wie unser Allerweltswort „Person“: persona – Maske, nämlich die des Schauspielers. Unsere Stelle will sagen: Schauspieler müssen auch körperlich durchtrainiert sein; in analoger Weise sorgt philosophische Bildung für die fundamentalen intellektuellen Voraussetzungen für eine überzeugende und erfolgreiche Tätigkeit als Redner.
4 3 parva … magnis … conferuntur – Ganz anders als in Griechenland war das Ansehen der Schauspielkunst in Rom sehr gering.
5 5 Phaedro – Phaidros ist einer der berühmtesten Dialoge PLATONS, benannt nach dem Gesprächspartner des Sokrates, der ja in den Dialogen seines Schülers PLATON als Gesprächsteilnehmer verewigt ist.
6 5 Periclen – ist ein griechischer Akkusativ; Perikles ist der bedeutendste Staatsmann im Athen des 5. Jhs. vor Christus, der Zeit der griechischen Klassik.
7 6 Anaxagorae – ANAXAGORAS war ein sog. „Vorsokratiker“, ein physikós – so nannten die Griechen oft ihre spekulativen Naturphilosophen der Frühzeit (griech. phýsis – Natur); es geht hier nicht um Physik im modernen Sinne, die ja in der Neuzeit seit FRANCIS BACONS Novum Organum von 1620 neue, experimentell-messende, mathematische Wege eingeschlagen hat. Die griechischen physikoí sind die Urväter der europäischen Philosophie; ARISTOTELES nennt sie „die ersten Philosophen“.
8 7 cum … tum – sowohl … als auch
9 9 animorum partes – Wie weiter unten im Kontext der Seelenlehre näher ausgeführt werden wird, unterscheidet Platon drei Seelenteile: einen als Sitz der Vernunft, einen zweiten als Sitz des Mutes, einen dritten als Sitz der Begierde; seit eh und je setzt man – auch in der Alltagssprache – drei Körperbereiche in Analogie dazu: Kopf, Herz und Bauch; die entsprechenden Tugenden sind Klugheit, Mut und Maßhalten. Den Rhetoriker interessiert das alles lediglich unter dem Aspekt der Beeinflussung durch Rede, im Griechischen auch psychagogía, d.h. Seelenführung genannt; psychagogía ist bei PLATON ein Synonym für Rhetorik.
10 9 Demosthene – Der Grieche DEMOSTHENES ist der größte Redner der Antike; Cicero war in der Wahl seiner Vorbilder nicht bescheiden: von den Philosophen wählte er sich den größten – er nennt PLATON einmal deus quidam philosophorum –, von den Rednern DEMOSTHENES, den er, wie den Philosophen PLATON bei einigen philosophischen Schriften, auch in einem Werktitel imitiert, s.u. Philippische Reden gegen Antonius; dass DEMOSTHENES Schüler PLATONS gewesen sei, ist wohl spätere Fiktion, die Schriften PLATONS freilich hat er studiert.
11 11f. genus, speciem, definiendo – Die Lehre von der Definition („Grenzen ziehen“) gehört zum Kleinen Einmaleins der Logik, wie es ARISTOTELES expliziert hat; eine Sache wird definiert, indem man zunächst das genus proximum (Gattung), dann die differentia specifica benennt (artbildender Unterschied); für die Definition des Menschen z.B. heißt das: homo est animal rationale; die Gattung ist Lebewesen, der artbildende Unterschied die ratio.
12 14 natura rerum – das lateinische Gegenstück zu griech. phýsis – Natur, „Schöpfung“.