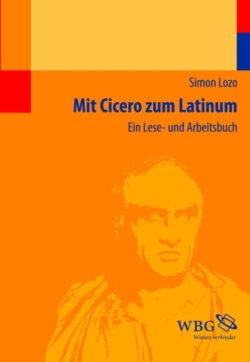Читать книгу Mit Cicero zum Latinum - Simon Lozo - Страница 15
2 Der Heimatort Arpinum
ОглавлениеGeboren wurde Marcus Tullius Cicero im Jahre 106 v. Chr. in Arpinum, dem heutigen Städtchen Arpino, ca. 100 km südöstlich von Rom, im südlichen Lazio. Nach dem römischen ius trium nominum war sein Vorname (praenomen) Marcus, sein Familien- oder Sippenname (nomen gentile) Tullius, sein Beiname (cognomen) Cicero. Solche Beinamen waren z.B. „Wunschnamen“, z.B. Felix, gerne wurden hierdurch aber auch körperliche Auffälligkeiten aufs Korn genommen; solche Beinamen konnten dann auch vererbt werden: z.B. Calvus (Glatze), Varus (O-Bein), Sulla (dünne Wade, von der Diminutiv-Bildung surula, abgeleitet von sura – Wade), Crispus (Krauskopf) usw.; nach PLUTARCH hatte der erste exponierte Vertreter der Tullius-Sippe wegen seiner auffälligen Nasenform den Beinamen Cicero erhalten; seine Nasenspitze hatte nämlich die Form einer Kichererbse (cicer). Wegen dieses vererbten Beinamens sei Marcus Tullius oft verspottet worden, zu Beginn seiner Ämterlaufbahn habe man ihm zu einer Namensänderung geraten, was Cicero souverän abgelehnt habe. Es zeugt von Humor, wenn er während seiner Quästur auf Sizilien (s.u.), als bei einem Einweihungsakt sein Name auf einer Gedenktafel verewigt werden sollte, er dem Steinmetz auftrug, den Vor- und Familiennamen einzumeißeln und daneben eine Gravur in Form einer Kichererbse anzubringen. Im Folgenden wird Cicero nur mit seinem Beinamen genannt, ebenso die meisten anderen Römer (Griechen haben nur einen Namen, z.B. Sokrates), also z.B. Crassus (der Dicke) anstelle von Marcus Licinius, Caesar anstelle von Gaius Iulius; die vollständigen Namen sind im Namenregister verzeichnet.
Ciceros Vater war nicht Patrizier, sondern gehörte zum ländlichen Ritterstand; Das war ein vererbtes „Handicap“ für die Karriere des Sohnes, schotteten sich doch die mächtigen Familien der Nobilität in einem inner circle der Macht, in einer Art „Machtkartell“ (MEYER), sozusagen ab. Nach den Worten SALLUSTS gaben sich die Mitglieder der Nobilität das Konsulat untereinander weiter, das Volk vergab nur die anderen Ämter; naserümpfend nannte man jeden Neuling im Konsulat homo novus, Parvenu.
Nur ganz wenige Nicht-Patrizier schafften den Aufstieg zum Konsulat, die berühmtesten sind Cato, Marius und eben Cicero.
Auch Marius (158 bis 86) stammte aus Arpinum; auch für ihn war es natürlich ebenso schwer gewesen, in die Phalanx der Privilegierten einzubrechen, er musste – wie Cicero – mit seinen spezifischen außergewöhnlichen Leistungen aufwarten; Marius’ ganze Geringschätzung der Aristokratensöhne fasst SALLUST in seinem Bellum Iugurthinum in Worte:
1 1 Non possum fidei causa imagines neque triumphos aut consulatus maiorum
2 2 meorum ostentare, at, si res postulet, hastas, vexillum, phaleras, alia militaria
3 3 dona, praeterea cicatrices advorso corpore. Hae sunt meae imagines, haec nobili-
4 4 tas, non hereditate relicta, ut illa illis, sed quae ego meis plurumis laboribus et
5 5 periculis quaesivi.
1 Z. 1 imagines/triumphos/consulatus maiorum – Die imagines sind die Wachsmasken der Ahnen; nur diejenigen, deren Vorfahren hohe Ämter innegehabt hatten, waren berechtigt, solche imagines aufzustellen. Der dafür vorgesehene Ort war ein Schränkchen (armarium), wie das lararium, der Hausaltar mit den Hausgöttern (Lares), eine Art Herrgottswinkel im Atrium des Hauses. Auch die imagines sind somit ein Mittel und Zeichen der sozialen Abgrenzung, sozusagen über den Tod hinaus und die Existenzspanne des Einzelnen transzendierend; mit ihnen vergewissert sich die privilegierte Schicht ihrer perpetuierten Sonderstellung. Diese imagines kommen bei Leichenzügen sozusagen zum Einsatz; der schon erwähnte Grieche POLYBIOS bietet uns im sechsten Buch seines Geschichtswerkes einen Augenzeugenbericht: Klienten der Familie oder Schauspieler tragen, auf einem hohen Wagen sitzend, die mit Lorbeerkränzen geschmückten Totenmasken und die Amtsinsignien der Ahnen. Die Ahnen führen den Leichenzug an und holen gleichsam das gerade verstorbene Familienmitglied in die Unterwelt ab. Genauso wenig wie Marius hatte also Cicero solche imagines vorzuweisen.
2 1 fidei – hier: Vertrauenswürdigkeit
3 2 phaleras – militärische Orden
4 3 advorso corpore – vorne am Körper, an der Brust; Gegensatz: averso corpore – hinten, im Rücken; advorso ist natürlich wieder ein Archaismus.
5 4 plurumis – Archaismus, wie üblich bei SALLUST
6 4f. laboribus et periculis – Die persönliche Leistungs- und Risikobereitschaft wird hier den durch Geburt gegebenen Privilegien gegenübergestellt.
Man könnte diese Zugehörigkeit Ciceros (nur) zum ländlichen Ritterstand als eine Art soziales Geburtstrauma bezeichnen, das Cicero gleichsam aus einem Inferioritätsgefühl heraus zu Höchstleistungen anspornte; er wurde zum „politischen Selfmademan“ (GIEBEL). Cicero schreibt in einer Mischung von Stolz und Verbitterung:
Mihi quidem de meis maioribus dicendi facultas non datur; non possunt omnes esse patricii,
ihm hätten sich nicht die gleichen Möglichkeiten geboten wie den Sprösslingen des Adels, denen die Ehren und Auszeichnungen des römischen Volkes in die Wiege gelegt seien. Dieses Persönlichkeitsmerkmal wird uns später mehrfach begegnen, z.B. in der Rede gegen Piso; hier wird zunächst ein Abschnitt aus dem philosophischen Dialog De legibus (II, 3) geboten; die Teilnehmer an diesem fiktiven Gespräch sind Marcus Tullius Cicero selbst, sein Bruder QUINTUS TULLIUS CICERO und der schon oben erwähnte enge Freund Titus Pomponius Atticus; der Autor lässt den Dialog in der Nähe von Arpinum stattfinden, wo er dem Freund während eines Spaziergangs im Grünen bewegt sein Geburtshaus zeigt:
1 1 Haec est mea et huius fratris mei germana patria. Hinc enim orti stirpe antiquis-
2 2 sima sumus, hic sacra, hic genus, hic maiorum multa vestigia. Quid plura? Hanc
3 3 vides villam, ut nunc quidem est lautius aedificatam patris nostri studio, qui, cum
4 4 esset infirma valetudine, hic fere aetatem egit in litteris. Sed hoc ipso in loco, cum
5 5 avos viveret et antiquo more parva esset villa, […] me scito esse natum. Quare
6 6 inest nescio quid et latet in animo ac sensu meo, quo me plus hic locus fortasse
7 7 delectat, si quidem etiam ille sapientissimus vir, Ithacam ut videret, immortalita-
8 8 tem scribitur repudiasse.
1 Z. 1f. Die auffällige Rhetorisierung dient der Pathossteigerung, unterstreicht die Ergriffenheit von der Magie des Ortes und des Augenblicks, vom „Hier und Jetzt“: Haec […]. Hinc […], hic […], hic […], hic […]. Harte […].Neben den Anaphern entfalten in diesen Zeilen Asyndeta (fehlende Bindewörter), Ellipsen (fehlende finite Verbformen) und die elliptische rhetorische Frage (quid plura?) ihre Wirkung.
2 2 sacra – hier als Substantiv, Plural zu sacrum
3 2 maiorum – ebenfalls als Substantiv im Sinne von „Vorfahren“
4 3 lautius – Adverb des Komparativs
5 4 infirma valetudine – ablativus qualitatis als Prädikatsnomen
6 5 avos – hier Nominativ Sg., also ein Archaismus, wie er oft z.B. bei SALLUST anzutreffen ist, hier als stilistisches Mittel verwendet, da ja von alten Dingen die Rede ist.
7 5 scito – recht seltener „futurischer“, etwas feierlich wirkender Imp. II
8 6 nescio quid – erscheint manchmal auch zusammengeschrieben, ein Indefinitpronomen
9 7 sapientissimus vir – gemeint ist Odysseus, dessen Heimat die Insel Ithaka ist
10 7f. vir … scribitur repudiasse – NCI
11 7f. immortalitatem – HOMER, Odyssee, 5. Gesang: Dort verspricht die Nymphe Kalypso dem bei ihr gestrandeten Odysseus, ihn „unsterblich und auf ewig alterslos zu machen“.
12 8 repudiasse – Kurzform für repudiavisse