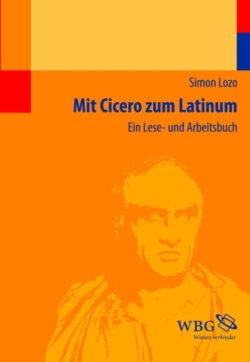Читать книгу Mit Cicero zum Latinum - Simon Lozo - Страница 8
1 Formen der Ungleichheit und Unterdrückung
ОглавлениеBekanntlich gliedert sich die antike römische Verfassungsgeschichte in drei Epochen: erstens das Königtum, von 753 v. Chr., dem vom römischen Universalgelehrten VARRO, einem Freund Ciceros, „errechneten“ Gründungsdatum Roms, bis ca. 510, mit Romulus als dem ersten, Tarquinius Superbus als dem siebten und letzten König, zweitens die Republik, ca. 510–30 v. Chr., und drittens das Kaiserreich, ab Augustus.
Die Phase der Republik segmentiert die Geschichtswissenschaft (z.B. CHRIST) in drei Abschnitte, erstens die frühe Republik, d.h. die Zeit der „Ständekämpfe“ (510–287), in denen sich die Plebejer mehr Mitbestimmungsrechte im aristokratisch dominierten Staat erkämpften und zu den höheren Ämtern zugelassen wurden (367: leges Liciniae Sextiae), zweitens die klassische Republik (287–133), schließlich die Zeit der „römischen Revolution“ (133–30, s.u.), wobei man die Jahre 200 bis 30 auch unter „späte Republik“ zusammenfasst. Die erste Phase des Kaisertums nennt man Prinzipat (30 v. Chr. bis 284 n. Chr.), die zweite Dominat, 284–476, also bis zum Untergang des weströmischen Reiches. Cicero (106–43) lebt demnach in der Endphase der römischen Republik.
Hier muss zuallererst einem möglichen Missverständnis vorgebeugt werden: den Begriff „Republik“ konnotieren wir in der Tradition der Aufklärung wohl unwillkürlich mit der in der französischen Revolution propagierten Begriffstrias: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Diese Vorstellung ist im Falle der römischen Republik fernzuhalten: „Rom war damals keine Demokratie“ (KROLL).
Dagegen prägen Ungleichheit im Inneren und Unterdrückung in der Außenpolitik die Geschichte der römischen Republik. Auch der Philosoph Cicero stellt als traditionsbewusster patriotischer Römer das römische imperiale Sendungsbewusstsein nicht in Frage. Wie es für den römischen Nationaldichter VERGIL feststeht, dass der göttliche Auftrag, die Vorsehung Roms, darin besteht, regere imperio populos, so ist es auch nach Ciceros Überzeugung dem römischen Volk nicht bestimmt zu dienen, vielmehr hätten ihm die unsterblichen Götter die Herrschaft über alle Völker zugewiesen, die Römer seien ein Herrenvolk.
Da Ciceros Schriften unter historischem Aspekt in erster Linie die innenpolitische Problematik des Jahrhunderts der Bürgerkriege (133–30 v. Chr.), die „römische Revolution“ (SYME) spiegeln, Cicero offenbar auch persönlich darunter litt, dass er als homo novus („Emporkömmling“) gegenüber dem Adel die niedere Geburt nur durch den übersteigerten Einsatz seiner überragenden geistigen Gaben kompensieren konnte – mit Blick auf die durch Geburt bereits arrivierten Patrizier, homines arrogantes, spricht er abfällig von piscinarii (Fischteichbesitzer) –, soll hier nur die Ungleichheit im Inneren kurz angeschnitten werden.
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“: Zunächst müssen wir uns vor Augen halten, dass wir es im Falle des antiken Roms – nach marxistischer Terminologie – mit einer „antiken Sklavenhaltergesellschaft“ (s.u. Spartacus) zu tun haben. Diese Ungleichheit der Menschen ist im römischen Recht festgeschrieben: in den Digesten, einer wichtigen Gesetzessammlung im Rahmen des Corpus Iuris Civilis, der großen spätantiken Rechtskodifikation, heißt es (GAIUS):
Summa igitur de iure personarum divisio haec est, quod omnes homines aut liberi sunt, aut servi.
Legitimiert sei die Sklaverei durch das Völkerrecht (FLORENTINUS):
Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur. Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur. Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent; mancipia vero dicta, quod ab hostibus manu capiantur.
Die fehlende Rechtsgleichheit schlägt sich natürlich auch im Strafrecht wieder: Freiheitsstrafen kannte das Strafrecht der römischen Republik nicht; Sklaven und Menschen der Unterschicht wurden oft zum Tode verurteilt, freie Bürger wurden z.B. mit Verbannung bestraft (s.u. Verres und Cicero selbst); auch zwischen den römischen Bürgern herrscht in dieser Zeit alles andere als Gleichheit, ganz abgesehen davon, dass in der römischen Männergesellschaft Frauen vom politischen Leben ausgeschlossen blieben; die Digesten halten hierzu fest (ULPIANUS):
Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratus gerere nec […] nec […] nec […].
Es gab Bürger erster und zweiter Klasse; anders als die Vollbürger hatten z.B. die socii in Mittel- und Süditalien kein Stimmrecht, sie waren Halbbürger, cives sine suffragio (s.u. Bundesgenossenkrieg), aber auch unter den „Vollbürgern“ gab es keine politische Gleichberechtigung. Dem Namen nach ging zwar alle politische Macht vom populus aus, doch aufgrund eines auf den Vermögensverhältnissen basierenden Wahlrechts lag die politische Macht in den Händen der besitzenden Aristokratie, dem Großteil der Bürger blieb politische Mitbestimmung verwehrt. Anders als in unserer modernen repräsentativen Demokratie mit ihrem Majoritätsprinzip oder in der direkten Demokratie des antiken Athens hatten im republikanischen Rom die Individualstimmen kaum politische Bedeutung, hier herrschte das „extremste Klassenstimmrecht, das die Geschichte kannte“ (MEYER); denn bei der Stimmabgabe okkupierten die beiden obersten Klassen bereits die absolute Mehrheit. Schließlich: Angesichts der Massivität der Interessenkonflikte – von den „Ständekämpfen“ der frühen Republik bis zur blutigen „römischen Revolution“ – von Brüderlichkeit zu sprechen, verbietet sich von vorneherein.