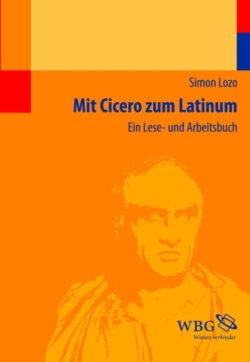Читать книгу Mit Cicero zum Latinum - Simon Lozo - Страница 19
3 Bildungsprogramm
ОглавлениеDas Thema Bildungsprogramm soll hier vorläufig abgeschlossen werden mit einer Passage aus der Gerichtsrede Pro Archia poeta (12f.), die Cicero als Verteidiger im Jahre 62, also ein Jahr nach seinem Konsulat gehalten hat. Angeklagt ist der Dichter Aulus Licinius Archias, gebürtiger Grieche; der Kläger ist ein gewisser Grattius, der dem weltläufigen Dichter, der zum Freundeskreis Ciceros gehörte, vorwirft, er habe sich das römische Bürgerrecht widerrechtlich angemaßt. Cicero verweist auf ein altes Gesetz, nach welchem dem Angeklagten das Bürgerrecht zustehe, welches der Dichter auch im Jahre 89 rechtmäßig erworben habe. Er geht nur kurz auf die juristische Problematik ein, überhaupt „wäre Archias in die Zahl der Bürger aufzunehmen, wenn er nicht schon Bürger wäre“. Den Hauptteil der Rede bildet ein Lob der Poesie und der schönen Künste. Der Text zeigt, welche Bedeutung die studia litterarum für Cicero hatten, welches Bild von humanitas als Geistes- und Herzensbildung er vermitteln will.
Ein zentraler Begriff im Werk Ciceros ist diese humanitas, ein Begriff, mit dem „der Römer vor allem der ciceronischen Zeit und besonders Cicero den verpflichtenden Wesenskern des Menschen zusammenfaßte“ (BÜCHNER). Instruktiv im Hinblick auf das Problem einer präzisen Ortung der Begriffsinhalte und auch im Hinblick auf die moderne Schwerpunktverlagerung des Begriffsinhalts von humanitas / „Humanität“ ist eine Bemerkung bei GELLIUS (2. Jh. n. Chr.), zu Ciceros Zeit habe das lateinische Wort humanitas lediglich dem griechischen paideía (vgl. Pädagogik), also etwa einer „umfassenden Bildung“ entsprochen; zu seiner (GELLIUS’) Zeit entspreche es eher dem griechischen philanthropía. Näheres zum humanitas-Begriff siehe weiter unten.
Wenn Cicero eine umfassende Allgemeinbildung des Redners fordert, rekurriert er damit auf ein von den Griechen entwickeltes Konzept einer „enzyklopädischen“ Bildung: enkýklios paideía (daher unser Wort „Enzyklopädie“) ist der griechische Begriff für das, was wir Allgemeinbildung, die Römer eine Bildung in den artes liberales nennen, ein Terminus, der zum ersten Mal in Ciceros Frühschrift De inventione anzutreffen ist, ein Bildungskonzept, das über das Mittelalter bis heute nachwirkt (magister artium, M.A.); wenn wir heute von Master-Studiengängen sprechen, handelt es sich hierbei terminologisch also um ganz alten Wein in neuen Schläuchen; engl. master stammt wie das deutsche „Meister“ von magister ab.
Dieses antike Bildungsprogramm, dessen exponierter Vertreter zur Zeit der römischen Klassik Cicero ist, ist also zusammengefasst in den „sieben freien Künsten“, wobei – wie SENECA es formuliert – liberalis so viel bedeutet wie „eines freien Mannes würdig“. Das griechische Konzept der o. g. enkýklios paideía ist als festes System greifbar, „wahrscheinlich schon bei Aristoteles, bestimmt aber um die Wende vom 4. zum 3. Jh. v. Chr.“ (KÜHNERT). Die sieben Fächer waren:
Trivium: Grammatik, Dialektik/Logik, Rhetorik
Quadrivium: Musik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie
Seit der Zeit Karls des Großen und der von ihm gegründeten Hofschule in Aachen kursierten als Memorierverse zwei daktylische Hexameter:
GRAM loquitur, DIA vera docet, RHE verba ministrat,
MUS canit, AR numerat, GEO ponderat, AS colit astra.
Das Ziel war eine formale Verstandesschulung, Ausbildung zur Urteilsfähigkeit und Vermittlung einer gewissen geistigen Kultur.
Das System der antiken artes liberales übermittelt dem Abendland die spätantike Bildungstradition.
Dem christlichen Mittelalter bedeutet es die zeitlos gültige Ordnung alles Wissens. Die Gesamtheit der artes liberales kann der Philosophie gleichgesetzt werden. (E. R. CURTIUS)
Cicero betont oft, dass diese artes humanae der Ausbildung der Jugend dienen, etwa in der hier thematisierten Rede: eae artes, quibus aetas puerilis ad humanitatem informari solet. Die Rhetorik hat bei Cicero freilich eine Sonderstellung; sie bildet das Fachstudium, das auf den artes aufbaut. Er bewertet die Rhetorik stets höher als die anderen artes; die Philosophie ist dabei sozusagen deren Urquell: omnium laudatarum artium procreatrix. Ein Satz aus De oratore fasst diesen Themenpunkt gut zusammen: sic sentio neminem esse in oratorum numero habendum, qui non sit omnibus eis artibus, quae sunt libero diqnae, perpolitus. Es folgt die Passage aus Pro Archia poeta:
1 1 Quaeres a nobis, Gratti, cur tanto opere hoc homine delectemur. Quia suppeditat
2 2 nobis, ubi et animus ex hoc forensi strepitu reficiatur et aures convicio defessae
3 3 conquiescant. An tu existimas aut suppetere nobis posse, quod cotidie dicamus in
4 4 tanta varietate rerum, nisi animos nostros doctrina excolamus, aut ferre animos
5 5 tantam posse contentionem, nisi eos doctrina eadem relaxemus? Ego vero fateor
6 6 me his studiis esse deditum. Ceteros pudeat, si qui ita se litteris abdiderunt, ut
7 7 nihil possint ex eis neque ad communem adferre fructum neque in aspectum
8 8 lucemque proferre; me autem quid pudeat, qui tot annos ita vivo, iudices, ut a
9 9 nullius umquam me tempore aut commodo aut otium meum abstraxerit aut
10 10 voluptas avocarit aut denique somnus retardarit?
11 11 Qua re quis tandem me reprehendat, aut quis mihi iure suscenseat, si, quantum
12 12 ceteris ad suas res obeundas, quantum ad festos dies ludorum celebrandos, quan-
13 13 tum ad alias voluptates et ad ipsam requiem animi et corporis conceditur tempo-
14 14 rum, quantum alii tribuunt tempestivis conviviis, quantum denique alveolo,
15 15 quantum pilae, tantum mihi egomet ad haec studia recolenda sumpsero? Atque
16 16 id eo mihi concedendum est magis, quod ex his studiis haec quoque crescit oratio
17 17 et facultas, quae, quantacumque est in me, numquam amicorum periculis defuit.
1 Z. 1 tanto opere – entspricht tantopere: so sehr
2 6–8 Typisch für Cicero ist die Forderung einer Verbindung von vita contemplativa und vita activa, von Theorie und Praxis. Intellektuelles Eigenbrötlertum, ohne das Wissen für den Staat und die Mitmenschen nutzbar zu machen, ist zu verurteilen. Ciceros philosophische Schriften wollen immer auch der res publica nützen (s.u.), ihre Abfassung versteht er als patriotische Tat.
3 9 tempore – hier etwa: schwere Zeit, Notlage
4 10 avocarit – Kurzform für avocaverit, Analoges gilt für das folgende retardarit 12 obeundas – Gerundivum zu obire, hier transitiv: besorgen, erledigen
5 11ff. quantum – stilistisch zu beachten sind hier besonders die Anaphern (quantum), die Parallelismen und Ellipsen (des Prädikats) und das mit dem vielfach wiederholten quantum korrespondierende tantum in Z. 15. Der Satz Z. 11 bis 15 ist ein gutes Beispiel für eine klassische „runde“ Satzperiode.
6 14 tempestivis – hier: früh beginnend, d.h. üppig
7 16 Zu beachten das Hyperbaton eo (abl. mensurae …) magis (um so mehr).
8 16 concedendum est – Gerundivum als Prädikatsnomen.
9 16f. oratio et facultas – das beliebte rhetorische Mittel Hendiadyoin: hierbei hat das et nicht additive Funktion, sondern dient gleichsam der Begriffsverschmelzung; hier erklärt ein Nomen das andere als Attribut näher: rednerische Fähigkeit; dieses Stilmittel wird uns noch häufiger begegnen. Ein Klassiker: via ac ratione – „auf methodischem Weg“, d.h. systematisch