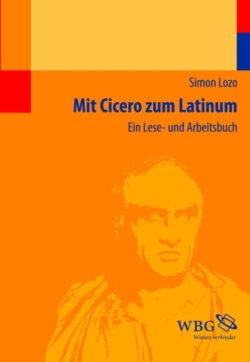Читать книгу Mit Cicero zum Latinum - Simon Lozo - Страница 24
VI Das Piratenproblem und das Problem Mithridates. Die erste Staatsrede
ОглавлениеDie Jahre 67/66 bereiten den Zenith der Karriere des Pompeius vor. Im selben Jahr wie Cicero geboren, konnte er schon im Jahre 79 wegen seiner militärischen Leistungen in Libyen seinen ersten Triumph verbuchen. Ende der 70er Jahre wurde ihm aufgrund seines Sieges über Sertorius in Spanien ein zweiter Triumph zuerkannt; seit dieser Zeit in Spanien nennt er sich in Briefen und Erlassen Magnus, was APPIAN als Anspielung an Alexander den Großen interpretiert. Jetzt, im Jahre 67/66, steht er vor einem weiteren Karrieresprung, der ihm einen dritten Triumph (61) einbringen wird, über Mithridates, König von Pontos in der heutigen Türkei. Daher spricht PLUTARCH von den drei „weltumspannenden“ Triumphen des Pompeius – die antike Geographie kennt ja nur drei Kontinente: Europa, Asien, Libyen (Afrika).
Schon etliche Jahre hatten Piraten den gesamten Mittelmeerraum unsicher gemacht, besonders Menschenraub war ein einträgliches Geschäft; das bekam sogar der junge Caesar im Jahre 75 zu spüren, als er nach Rhodos segelte, um sich bei dem oben erwähnten APOLLONIOS MOLON rhetorisch weiterzubilden; er kam erst nach Zahlung von Lösegeld frei. Caesar wäre natürlich nicht Caesar, wenn er sich nicht gleich danach an den Kidnappern gerächt hätte – er ließ sie kreuzigen; „das Kreuz war der Galgen der Antike“ (BIRT).
Schon 74 versuchte der Senat, durch Erteilung eines imperium extraordinarium das Piratenproblem zu lösen; dieser Versuch blieb jedoch erfolglos. Nach CASSIUS DIO „fuhren Piraten sogar in den Hafen von Rom ein, Ostia, steckten Schiffe in Brand und raubten allerlei Güter“. Jetzt, im Jahre 67, wurde Pompeius beauftragt, das Mittelmeer von den Piraten zu säubern. Pompeius erledigte diesen Auftrag extrem schnell; Cicero sagt in einer Rede des folgenden Jahres, des Jahres seiner Prätur, rückblickend:
Ita tantum bellum, tam diutumum, tam longe lateque dispersum, quo bello omnes gentes ac nationes premebantur, Cn. Pompeius extrema hieme apparavit, ineunte vere suscepit, media aestate confecit.
Die Vergabe jenes Auftrags an Pompeius war auf einen Antrag hin erfolgt, der von Gabinius eingebracht worden war; daher heißt die gebilligte Vergabe des Auftrags an Pompeius lex Gabinia. Begeistert redet Cicero weiter:
Est haec divina atque incredibilis virtus imperatoris.
In nicht zu überbietender Kürze heißt das Fazit zum Erfolg im Piratenkrieg:
Itaque una lex, unus vir, unus annus […] vos liberavit […].
Cicero nutzt hier die rhetorischen Mittel Trikolon, Polyptoton, Asyndeton, Parallelismus und Anapher.
Warum dieses übersteigerte Lob? Cicero dachte wie alle zunächst an sich selbst: er stand auf dem Sprungbrett zum Konsulat und brauchte, zumal als homo novus, einflussreiche Fürsprecher und Verbindungen, um die Bewerbung erfolgreich durchzuführen. Daher bemüht er sich darum, in seiner ersten politischen Rede De imperio Gnaei Pompei, in der es wiederum um die Vergabe eines Imperium extraordinarium geht, diesmal um die Vergabe des Oberbefehls im Kriegszug gegen Mithridates, Pompeius durch seine Fürsprache für sich zu gewinnen. Der Antrag, Pompeius mit der Kriegsführung zu betrauen, war von einem gewissen Manilius eingebracht worden – analog heißt diese Werberede Ciceros De lege Manilia. Dieses nicht uneigennützige Motiv kann man auch aus der nachdrücklichen Versicherung Ciceros lesen: me hoc neque rogatu facere cuiusquam, neque quo Cn. Pompei gratiam mihi per hanc causam conciliari putem, neque quo mihi ex cuiusquam amplitudine aut praesidia periculis aut adiumenta honoribus quaeram. Anlass der Diskussion ist also wieder einmal Mithridates, das noch ungelöste Problem im Osten, ein Mann, gegen den schon Sulla in den 80er Jahren Krieg geführt hatte. Treffend heißt es dazu im zitierten EUTROP-Text:
Dum Sulla Mithridaten vincit,
d.h. etwa: „mit dem Siegen beschäftigt war“. Cicero schreibt über die Kriege gegen Mithridates:
1 1 Triumphavit Lucius Sulla, triumphavit L. Murena de Mithridate, duo fortissimi viri
2 2 et summi imperatores, sed ita triumpharunt, ut ille pulsus superatusque regna-
3 3 ret. […]. Mithridates autem […] tempus non ad oblivionem veteris belli, sed ad
4 4 comparationem novi contulit.
1 Z. 2 triumpharunt – Kurzform/Nebenform für triumphaverunt
Ähnlich heißt es um 100 n. Chr., zur Zeit des Kaisers Trajan bei TACITUS in seiner Schrift Germania, nachdem er an den Einfall der Kimbern und Teutonen (s.o.) erinnert hat und dann auf seine Zeit zu sprechen kommt:
Ducenti ferme et decem anni colliguntur: tam diu Germania vincitur.
Wie die EUTROP-Stelle, ist auch dieser Satz des TACITUS ein schönes Beispiel für die „imperfektive“ Aktionsart des Präsens.
Mithridates war also zum Zeitpunkt der Rede Ciceros über Jahrzehnte hinweg unbesiegt und beeinträchtigte die Sicherheit und den Handel im Osten; das drängte zum Handeln. Es folgt der Auszug aus Ciceros erfolgreichem Plädoyer für Pompeius (54f.):
1 1 Quae civitas umquam fuit antea, non dico Atheniensium, quae satis late quon-
2 2 dam mare tenuisse dicitur, non Carthaginiensium, qui permultum classe ac mari-
3 3 timis rebus valuerunt, non Rhodiorum, quorum usque ad nostram memoriam
4 4 disciplina navalis et gloria permansit, quae civitas, inquam, antea tam tenuis aut
5 5 tam parvola fuit, quae non portus suos et agros et aliquam partem regionis atque
6 6 orae maritimae per se ipsa defenderet? At hercules aliquot annos continuos ante
7 7 legem Gabiniam ille populus Romanus, cuius ad nostram memoriam nomen in-
8 8 victum in navalibus pugnis permanserit, magna ac multo maxima parte non mo-
9 9 do utilitatis, sed etiam dignitatis atque imperii caruit. […].
10 10 Nos, qui antea non modo Italiam tutam habebamus, sed omnes socios in ultimis
11 11 oris auctoritate nostri imperii salvos praestare poteramus, tum, cum insula Delus
12 12 tam procul a nobis in Aegaeo mari posita, quo omnes undique cum mercibus
13 13 atque oneribus commeabant, referta divitiis, parva, sine muro nihil timebat, idem
14 14 non modo provinciis atque oris Italiae maritimis ac portibus nostris, sed etiam
15 15 Appia iam via carebamus. Et eis temporibus nonne pudebat magistratus populi
16 16 Romani in hunc ipsum locum escendere, cum eum nobis maiores nostri exuviis
17 17 nauticis et classium spoliis ornatum reliquissent?
Wie sogleich ersichtlich, ist auch dieser Text stark rhetorisiert: rhetorische Fragen am Anfang und am Ende des Textes, Anaphern ab Zeile 1 quae, quae …, Parallelismen, Antithesen, Klimax (Z. 8/9 und Z. 14/15), die Zeilen 10–15 sind ein gutes Beispiel für eine komplexe Satzperiode. Der erste Satz bietet ein schönes Beispiel für das stilistische „Gesetz der wachsenden Glieder“, d.h. die Tendenz, Wortgruppen, Satzelemente oder ganze Teilsätze so zu setzen, dass deren Umfang in einer Reihung progressiv zunimmt: Die Frage in Z. 1 umfasst 5 Wörter, ihre Wiederaufnahme in Z. 4f. dagegen 9 Wörter, der Relativsatz in Z. 1/2 umfasst 7 Wörter, der in Z. 2/3 auch noch 7, der in Z. 3/4 aber bereits 10 Wörter, der letzte Relativsatz in Z. 5/6 ist auf 17 Wörter angewachsen. Auch dieses sprachliche Phänomen ist eine Spielart der – hier geradezu buchstäblichen – rhetorischen amplificatio.
1 Z. 1 Atheniensium – Das 5. Jh. v. Chr. war die Blütezeit Athens, sowohl kulturell als auch bezüglich der Machtentfaltung; Der nach den Perserkriegen im Jahre 477 gegründete sog. attisch-delische Seebund war nominell ein Bündnis, tatsächlich aber war Athen die dominante Hegemonialmacht. Der Hafen Athens, Piräus, war, zumal seit der Entwicklung Athens zur Seemacht unter Themistokles, der größte Hafen Griechenlands. Geographisch erstreckte sich der Seebund vom heutigen griechischen Festland über die Inseln der Ägäis bis zu den Städten Kleinasiens, d.h. der Westküste der heutigen Türkei.
2 1f. quae … tenuisse dicitur – NCI im Relativsatz
3 2 Carthaginiensium – dass Karthago eine Seemacht war, legt schon die Herkunft der Stadtgründer nahe; Karthago war eine Koloniegründung der Phönizier, des berühmten alten Seefahrervolkes aus dem östlichen Mittelmeerraum (heute etwa Libanon); daher rührt auch der lateinische Name für die Karthager: Poeni, vgl. „Punische Kriege“
4 3 Rhodiorum – das Rhodos im Hellenismus eine Zeit lang eine Seemacht und bedeutende Handelsrepublik war, lässt schon eines der sieben Weltwunder vermuten: der sehr repräsentative Koloss von Rhodos, eine 34 m hohe Bronzestatue des Gottes Helios, die vielleicht an der Hafeneinfahrt stand, bis ein Erdbeben sie zum Einsturz brachte. Als Bildungszentrum ist uns die Insel bereits aus Ciceros jungen Jahren bekannt, s.o. APOLLONIOS MOLON.
5 5f. quae … defenderet – Relativsatz mit konjunktivischem Prädikat, hier mit konsekutivem „Nebensinn“
6 6 hercules – Beteuerungsformel wie unser „bei Gott!“; gehört eher zur „kraftstrotzenden“ Alltagssprache, ist also ein „vulgäres“ Wort
7 7 memoriam – bedeutet auch: Zeit
8 8 parte – abl. separativus, abhängig von caruit
9 10f. socios … salvos praestare – doppelter Akkusativ; praestare hier etwa: machen
10 11 Delus – Die Insel Delos war besonders für zwei Dinge bekannt: neben Delphi war sie der wohl wichtigste Verehrungsort des Gottes Apollon; die Insel galt schließlich als Geburtsinsel des Gottes. Zweitens war Delos ein sehr bedeutender Sklaven-Umschlagplatz.
11 15 via Appia – die sog. Königin der Landstraßen; sie führte von Rom über Capua bis nach Brundisium in Süditalien (s.u.).
12 15 pudebat magistratus – magistratus: Akk. Pl, abhängig vom unpersönlichen Ausdruck pudebat
13 16f. hunc ipsum locum – hier wird deutlich, dass Cicero diese Rede auf der großen Rednertribüne auf dem Forum Romanum gehalten hat. Diese hieß rostra, weil man die Front der Bühne mit „Schiffsschnäbeln“ (rostra), d.h. Rammspornen, geschmückt hatte, die man nach dem Seesieg über Antium, das heutige Anzio, eine Stadt am Tyrrhenischen Meer, etwas südlich von Rom, von den erbeuteten Kriegsschiffen der Feinde abmontiert hatte. Somit wurde rostra zur Bezeichnung für die Bühne selbst.
Von dieser etwa drei Meter hohen Bühne mit breiter Front und konkaver Krümmung auf der Rückseite herab sprachen die römischen Beamten zum Volk. Sie war das Zentrum der politischen Diskussion in Rom, eine Art Schnittstelle der öffentlichen Kommunikation zwischen dem aristokratischen Senat, der „nebenan“ in der curia tagte, und dem Volk von Rom. Daher nennt der griechische Autor DIONYSIOS VON HALIKARNASS in seinen Römischen Altertümern die rostra den „Hauptteil des Forums“.
Auf Geheiß des Orakels von Delphi, man solle auf der Bühne Standbilder des Weisesten und des Tapfersten der Griechen aufstellen, postierte man hier Statuen von Pythagoras und Alkibiades, hinzu kamen z.B. eine Statue des Satyrs Marsyas und eine des Camillus, des „zweiten Gründers von Rom“, der um 400 Rom von den Galliern unter Brennus befreit hatte. Die Rostra hatte eine gleichsam sakrale Aura, die Zugangsberechtigung war nach religiösen Gesetzen geregelt; daher sagt Cicero in der hier zitierten Rede, er habe es bislang wegen der auctoritas des Ortes nicht gewagt, sich der Rednertribüne zu nähern. Nach dieser Premiere wird Cicero im Laufe seines Lebens zahlreiche Reden von dieser Bühne herab sprechen, auch zwei seiner Reden gegen M. Antonius am Ende seines Lebens, Reden, die ihn buchstäblich den Kopf kosten werden. (Die Darlegungen zur Rostra basieren auf KISSELS Forum-Buch).
EUTROP fasst in seinem Breviarium den Piratenkrieg und den Krieg gegen Mithridates folgendermaßen zusammen:
Piratae omnia maria infestabant ita, ut Romanis toto orbe victoribus sola navigatio tuta non esset. Quare id bellum Cn. Pompeio decretum est. Quod intra paucos menses ingenti et felicitate et celeritate confecit. Mox ei delatum est etiam bellum contra Mithridaten. Quo suscepto Mithridaten in Armenia minore nocturno proelio vicit, castra diripuit, quadraginta milia eius occidit. […]. Mithridates cum uxore fugit et duobus comitibus. Neque multo post […] venenum hausit. Hunc finem habuit Mithridates. Periit autem apud Bosporum, vir ingentis industriae consiliique. Regnavit annis sexaginta, vixit septuaginta duobus, contra Romanos bellum habuit annis quadraginta.