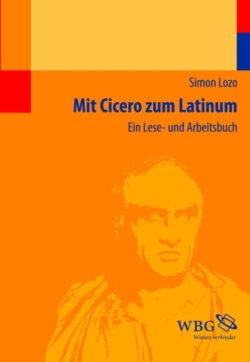Читать книгу Mit Cicero zum Latinum - Simon Lozo - Страница 22
3 Grundbegriffe der antiken Theorie der Rede
ОглавлениеZwei wissenschaftliche Disziplinen dominieren das Denken und Wirken Ciceros, die Rhetorik und die Philosophie; Rhetorik war seine Profession, die Philosophie seine intellektuelle Leidenschaft; bezüglich der Philosophie bekennt er in einem Brief an Cato aus dem Jahre 50: qua nec mihi carior ulla res in vita fuit, nec hominum generi maius a dis munus ullum est datum. Wie schon in Kapitel III (orator perfectus) andeutungsweise thematisiert, sah Cicero sozusagen eine Lebensaufgabe darin, diese beiden Disziplinen, die bei PLATON noch als Antipoden einander gegenüberstanden, bei dessen Zeitgenossen ISOKRATES sich einander annäherten, sozusagen zu einer Symbiose zusammenzuführen; das wird in Kapitel IX (De oratore) noch näher expliziert werden. Es wird sich zeigen, dass Ciceros Versöhnung von Rhetorik und Philosophie in der europäischen Geistesgeschichte richtungsweisend war, wodurch die Rhetorik fundamentale kulturelle Bedeutung erlangte. Hier ist – anlässlich der ersten großen Rede – der Ort, ein wenig auf die „technische“ Seite der Rhetorik, auf die grundlegenden Koordinaten der antiken Theorie der Rede einzugehen, um so einen begrifflichen Rahmen für die Einordnung der im weiteren Verlauf der Darstellung präsentierten Redepassagen zu eröffnen.
Wie die „Entdeckung des Geistes“ (SNELL) und damit die Philosophie verdanken wir auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit der „Rede“ den Griechen; bereits im ersten literarischen Dokument der europäischen Geistesgeschichte, der Ilias HOMERS, formuliert der alte Erzieher Achills, Phoinix, zwei Ziele seiner Erziehungs- und Bildungsarbeit: Beherrschung der Rede und Tatkraft; in Vers 443 des neunten Gesangs finden wir den Begriff, der eine lange und wirkungsmächtige Tradition initiieren sollte: rhetér – Redner, diesem homerischen Wort entspricht in der klassischen griechischen Sprache rhétor. Besonders im fünften Jahrhundert entwickelte sich die Redekunst im Zuge der geistigen Bewegung der „Sophistik“ (s. Kap. IX) zur „Kernkompetenz“, wurde zum Kernelement der höheren Bildung und blieb unerlässliche Voraussetzung für das Bekleiden höherer Ämter; Rhetorik galt damit als Synonym für Staatskunst (so z.B. in PLATONS Dialog Protagoras) oder Staatswissenschaft. In dieser Zeit wurde die Rhetorik auch systematisch als Wissenschaft ausgebaut, was Niederschlag in Lehrbüchern fand, die uns zwar nur in Fragmenten erhalten sind, aber ein Jahrhundert später im bedeutendsten Rhetorik-Lehrbuch aller Zeiten nachwirken, in der Rhetorik des ARISTOTELES; wie wir weiter unten auch bezüglich der Philosophie sehen werden, war ARISTOTELES ein enorm historisch ausgerichteter Wissenschaftler und in vielen Wissensbereichen, so auch in der Rhetorik, der große „Zusammenfasser“.
Heißt „Redner“ auf Griechisch rhetér (s.o. HOMER) oder rhétor (klassisch), so ist der Name für die Wissenschaft von der Rede seit PLATON „Rhetorik“. Die sprachliche Wurzel des Wortes rhétor, das indogermanische werdh, finden wir übrigens sowohl im lateinischen verbum als auch im Deutschen wieder: Wort. Die Erweiterung des Wortes rhetor zu Rhetorik steht im Zusammenhang mit einer Sprachentwicklungstendenz im Athen des 5. Jhs., als im Zuge des Wirkens der Sophisten durch die Erweiterung des Bildungsbegriffes und Vermittlung von Kenntnissen aus allen Lebens- und Seinsbereichen zum Zwecke der terminologischen Fixierung und Kategorisierung suffixale Neubildungen entstanden: aus „rhetorische Kunst/Wissenschaft“, griechisch rhetoriké téchne, wurde durch Ellipse des Substantivs téchne das ursprüngliche Adjektiv rhetoriké zum Substantiv. Analoges gilt für die unzähligen Disziplinen mit dem Suffix -ik: Physik (seit ARISTOTELES im wissenschaftlichen Sinne), Musik (seit PINDAR), Poetik (seit PLATON) oder auch Grammatik. Das griechische adjektivische Suffix -ikos entspricht etwa dem deutschen Suffix -isch (z.B. musisch).
In seinem berühmten Lehrbuch definiert ARISTOTELES die Rhetorik als „Fähigkeit, bezüglich jedes Gegenstandes das zu erkennen, was plausibel ist“, d.h. die Rhetorik befasst sich nicht mit bestimmten Gegenständen, sondern buchstäblich mit allem Möglichen, in erster Linie mit all dem, was in dem Bereich des menschlichen Miteinanders fällt, somit der Ethik und deren „Vollendung“, so ARISTOTELES, der Politik. Da die Gegenstände argumentativ schlüssig dargeboten werden müssen, betrachtet ARISTOTELES die Rhetorik als eine Art Mischung von Ethik/Politik und Dialektik/Logik. So erstaunt es nicht, wenn Cicero bei seinem orator perfectus nicht nur Sprachbeherrschung, sondern auch allseitige, besonders aber philosophische Bildung und profunde Menschenkenntnis voraussetzt. Angesichts der philosophischen Implikationen der Rhetorik bittet der römische Rhetorikprofessor QUINTILIAN im ersten Jh. n. Chr. um Verständnis dafür, wenn er auch Philosophisches in sein Lehrbuch der Rhetorik einbringe:
Quare, tametsi me fateor usurum quibusdam, quae philosophorum libris continentur, tamen ea iure vereque contenderim esse operis nostri proprieque ad artem oratoriam pertinere.
QUINTILIAN verweist darauf, die Rhetorik als civilis scientia sei ein Synonym für sapientia. Einige hätten sie mit Philosophie gleichgesetzt, darunter ISOKRATES, der damit ein Geistesverwandter Ciceros ist.
Die Konzeption der alle Gegenstandsbereiche umfassenden Rhetorik ist prototypisch greifbar beim Sophisten GORGIAS, der sich, so QUINTILIAN, seinen Zuhörern als Stegreif-Redner zu jedem gewünschten Thema anbot:
Gorgias quidem adeo rhetori de omnibus putavit esse dicendum, ut se in auditoriis interrogari pateretur, qua quisque de re vellet.
Das System der Rhetorik als Wissenschaft findet in dem genannten Lehrbuch des ARISTOTELES ihren vorläufigen mustergültigen Abschluss, von den Fach-Schriftstellern, darunter besonders Peripatetiker und Stoiker (s.u.), wird noch etwas daran gefeilt, im 2. Jh. v. Chr. kann das System als abgeschlossen gelten und wird in dieser Form von Cicero adaptiert und – etwa in seinem Frühwerk De inventione – ins Lateinische umgesetzt; wie in der Philosophie, so hat Cicero auch hier Grundlagenarbeit geleistet, indem er griechische Fachtermini ins Lateinische übersetzte.
Beginnen wir mit der grundsätzlichsten Differenzierung: Welche Redegattungen gibt es?
Die noch heute gültige Einteilung finden wir etwa im ersten Buch der Rhetorik des ARISTOTELES, eine Einteilung, die er selbst schon übernommen hat; ihre Klassifikationsparameter sind die Aspekte: Inhalt, Zeitbezug, Wertausrichtung; tabellarisch lässt sich die Klassifikation etwa folgendermaßen darstellen:
Damit deckt diese aristotelische Klassifikation alle möglichen Themen und Lebensbereiche ab; QUINTILIAN:
Aristoteles tres faciendo partes orationis, iudicialem, deliberativam, demonstrativam, paene et ipse oratori subiecit omnia; nihil enim non in haec cadit.
Ciceros soeben in Kap. IV, 2 thematisierte erste Rede in einem Kriminalprozess fällt also in die
Gruppe 1: genus iudiciale. Seine politische Werberede über den Oberbefehl des Pompeius in Kap. VI fällt unter Gruppe 2: genus deliberativum; wenn Cicero in seiner Rede Pro Marcello (Kap. XII, 4) Caesar über alle Maßen schmeichelt und ihn in den Himmel lobt (eum simillimum deo iudico), fällt diese Rede über weite Strecken unter Gruppe 3: genus demonstrativum.
Die in IV, 2 präsentierte Textpassage aus der Rede Pro Sexto Roscio gibt die ersten Sätze der Rede wieder; damit gehört sie dem ersten Redeteil an. Natürlich wurden und werden die Redeteile schulmäßig klassifiziert. Die Einteilung schwankt meist zwischen vier und fünf Teilen; ARISTOTELES bietet die schlichtere Version:
Diese Einteilung ist besonders auf die Gerichtsrede zugeschnitten, so ist z.B. die narratio in der politischen Rede, wie ARISTOTELES feststellt, am wenigsten vertreten, „weil niemand über die Zukunft erzählt“; wenn in der politischen Rede erzählt werde, dann nur, um Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
In dem zitierten Proömium der Rede Pro Sexto Roscio (IV, 2) verfährt Cicero natürlich schulmäßig; er selbst schreibt in seinem rhetorischen Lehrbuch De inventione über die Aufgaben des Proömiums:
Exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem, quod eveniet, si eum benivolum, attentum, docilem confecerit.
Das Unerhörte des Falles (novo scelere) erweckt Aufmerksamkeit und Interesse. Ein sehr wirksames psychologisches Mittel, den Hörer wohlwollend zu stimmen (captatio benevolentiae), ist der Bescheidenheitstopos, d.h. der Redner nimmt seine Person zurück, lobt Andere: dieses Mittel der persuasio ist hier massiv präsent; der Textabschnitt endet in diesem Sinne mit dem Verweis auf die Unerfahrenheit und Jugend des Redners. In der rhetorischen Fachterminologie heißt das: der Redner stellt sein éthos vor, vermittelt ein positives Bild von seiner Person und versucht, dadurch seine Glaubwürdigkeit zu steigern, denn, wie ARISTOTELES sagt, „anständigen Menschen glauben wir eher“, d.h. der geschickte Redner bemüht sich, den Hörer in einen erwünschten psychischen Zustand zu überführen, in diesem Fall der „Sympathie“. Diesen Lehrpunkt fassen die Theoretiker der Rhetorik unter páthos zusammen. Insgesamt stehen dem Redner drei Wege der persuasio zur Verfügung:
1 docere
2 delectare
3 movere
Das movere hat besonders in der peroratio seinen Platz, daneben auch – abgeschwächt – im exordium. Im spätantiken Handbuch des MARTIANUS CAPELLA heißt es dazu:
In epilogo generaliter observandum, ut brevis sit, si quidem commotus iudex statim dimittendus est ad sententiam proferendam, dum aut adversariis irascitur aut tuis miseretur lacrimis aut reorum afflictatione commovetur.
Cicero verfährt nach Lehrbuch, wenn er im Kontext des unter XI zitierten Textabschnittes aus der peroratio der Rede Pro Milone schreibt: Nec vero haec, iudices, ut ego nunc, flens, sed …; doch müssen aus psychologischen Gründen hemmungslose Affektausbrüche kurz sein, denn, wie QUINTILIAN lehrt:
Numquam tamen debet esse longa miseratio, nec sine causa dictum est nihil facilius quam lacrimas inarescere.
In der Antike war man in den Schlussappellen bei der Wahl der Mittel der Pathoserzeugung nicht zimperlich, wir würden sicherlich Einiges als zu drastisch und als Zumutung empfinden; denn neben den verbalen Mitteln der pathetischen amplificatio standen da auch die res zur Verfügung.
QUINTILIAN:
1 1 Non solum autem dicendo, sed etiam faciendo quaedam lacrimas movemus, unde
2 2 et producere ipsos, qui periclitantur, squalidos atque deformes, et liberos eorum
3 3 ac parentes institutum, et ab accusatoribus cruentum gladium ostendi et lecta e
4 4 funeribus ossa et vestes sanguine perfusas videmus et vulnera resolvi, verberata
5 5 corpora nudari.
1 Z. 3 institutum – ergänze est, im Sinne von: es entwickelte sich der Brauch
Auch die Arbeitsschritte vom Konzept bis zur Durchführung sind in den Lehrbüchern festgeschrieben:
Die aus jedem Sprachunterricht bekannten Begriffe der literarischen Rhetorik, der Stilmittel, fallen somit nach antiker Klassifikation unter Punkt 3.
Die Punkte 1–3 wirken in ihrer Selbstverständlichkeit nahezu banal; die Punkte 4 und 5 dagegen verdienen besondere Beachtung: Reden mussten in der Antike auswendig vorgetragen werden, was eine enorme Gedächtnisleistung beinhaltet; daher ist die Mnemotechnik Teil des Lehrstoffs in der Ausbildung zum Redner. Punkt 5 lautet auf Griechisch hypókrisis und trifft die Sache besser als das lateinische Gegenstück: Schauspielkunst. Im Vordergrund stehen hier Mimik und Gestik, aber auch für die Kleidung werden Regeln vorgegeben. Besonders sei auf die Länge der Tunika (eine Art langes Hemd) zu achten. QUINTILIAN:
1 1 Ita cingantur, ut tunicae prioribus oris infra genua paulum, posterioribus ad me-
2 2 dios poplites usque perveniant: nam infra mulierum est, supra centurionum.
1 Z. 1 oris – von ora, hier im Sinne von: Saum
2 2 mulierum/centurionum – d.h.: Frauen trugen längere Kleider, Zenturionen kürzere.
Auch empfiehlt QUINTILIAN für das Einüben des Vortrags das Proben mit dem Spiegel; dabei sei besonders auf die Kopfhaltung zu achten.
(caput)… ut sit primo rectum et secundum naturam: nam et deiecto humilitas et supino adrogantia et in latus inclinato languor et praeduro ac rigente barbaria quaedam mentis ostenditur.