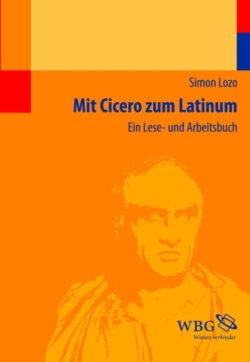Читать книгу Mit Cicero zum Latinum - Simon Lozo - Страница 23
V Beginn der senatorischen Laufbahn. Der Verres-Prozess
ОглавлениеDie Rede Pro Sexto Roscio war ein furioser Karrierestart; doch zunächst folgte die oben erwähnte Bildungsreise nach Griechenland – aus Angst vor Sulla, wie manche in der Antike behaupteten? Jedenfalls hatte Cicero sich einen Namen gemacht.
Nach der Rückkehr nach Rom nahm er seine senatorische Laufbahn in Angriff (s.o.: cursus honorum).
Die erste Stufe war das Amt eines Quästors; es gab städtische Quästoren, die in der Verwaltung der Stadtkasse u.ä. eingesetzt wurden, und Provinz-Quästoren, die als persönliche Helfer des Statthalters in der Provinz fungierten. Cicero wurde im Jahre 75 Provinz-Quästor, und zwar auf Sizilien.
Hier erwarb er sich wegen seiner Unbestechlichkeit großes Ansehen bei den Siziliern, einer Tugend, die bei römischen Provinzial-Beamten alles andere als selbstverständlich war.
Dieser Aufenthalt auf Sizilien spielte 5 Jahre später eine bedeutende Rolle beim nächsten großen Popularitätssprung, seinem Auftritt als Anwalt der Sizilier gegen Gaius Verres, der von 73 bis 71 v. Chr. im Rang eines Proprätors Sizilien als Statthalter „verwaltet“ hatte. Er hatte dort in einer Art Terror-Regime, das ein Extrembeispiel für die unbeschränkte Ausbeutung einer Provinz durch einen römischen Statthalter ist, sein Amt u.a. zur Befriedigung seiner maßlosen Sammelleidenschaft missbraucht. Kunstschätze aller Art waren das Objekt seiner Begierde. Verres war ein notorischer Kunsträuber, nicht nur auf Sizilien; nichts und niemand war vor ihm sicher. „Im Zeitalter der Revolutionen wuchs die Sammelleidenschaft der römischen Aristokraten. Es wurde geradezu Mode, dem Besucher ein kleines Museum erlesener Gegenstände vorzuführen.“ (FUHRMANN)
Nach der „Amtszeit“ des Verres suchten die leidgeprüften Sizilier einen Anwalt, der die Anklage gegen Verres übernehmen würde. Sie erinnerten sich an den vorbildlichen Quästor des Jahres 75, Cicero, und baten ihn, den Fall zu übernehmen. Cicero sagte zu und trat ausnahmsweise als Ankläger auf.
Es handelte sich um einen sog. Repetunden-Prozess, d.h. ein römischer Provinzverwalter wurde für sein Fehlverhalten in der Provinz (Selbstbereicherung) regresspflichtig gemacht. Nach modernem Rechtsverständnis ist es problematisch, dass nach Sullas Gerichtsreform bei solchen Prozessen korrupte Senatoren über die eigenen Standesgenossen richteten; daher ist es nicht verwunderlich, dass solche Regressforderungen oft abgewiesen wurden; in der actio prima klagt Cicero: Nulla denique existimantur esse iudicia.
In diesem Fall aber war die Beweislage so erdrückend, dass Verres sich gleich nach dem ersten Prozesstermin in die freiwillige Verbannung begab: zur zweiten, gesetzlich vorgeschriebenen Prozessphase kam es nicht mehr. Die Rede der actio secunda, aus der unten ein Auszug (IV, 1f.) geboten wird, wurde also erst gar nicht gehalten, Cicero wollte mit dieser Rede nur seine Leistung und seinen Sieg über den bis zu diesem Zeitpunkt angesehensten Anwalt in Rom, Hortensius, dokumentieren. Nach dem erfolgreichen Verres-Prozess avancierte Cicero zum ersten Anwalt Roms. Eine „Verbannung“ übrigens, wie sie Verres auf sich nahm, darf man sich nicht als allzu hart vorstellen. Er zog sich in eine Villa in der Provence, der provincia Narbonensis, zurück, von der PLINIUS, D.Ä. schreibt, sie sei wegen ihrer Schönheit Italia verius quam provincia, seine Kunstschätze nahm Verres natürlich mit; seine sensationelle Sammlung geraubter Kunstschätze wurde ihm allerdings später zum Verhängnis, sie weckte nämlich Begehrlichkeiten bei Marcus Antonius.
1 1 Venio nunc ad istius, quem ad modum ipse appellat, Studium, ut amici eius,
2 2 morbum et insaniam, ut Siculi, latrocinium; ego, quo nomine appellem, nescio;
3 3 rem vobis proponam, vos autem suo, non nominis pondere penditote.
4 4 Genus ipsum prius cognoscite, iudices; deinde fortasse non magno opere quaere-
5 5 tis, quo id nomine appellandum putetis. Nego in Sicilia tota, tam locupleti, tam
6 6 vetere provincia, tot oppidis, tot familiis tam copiosis, ullum argenteum vas, ul-
7 7 lum Corinthium aut Deliacum fuisse, ullam gemmam aut margaritam, quicquam
8 8 ex auro aut ebore factum, signum ullum aeneum, marmoreum, eburneum, nego
9 9 ullam picturam neque in tabula neque in textili, quin conquisierit, inspexerit,
10 10 quod placitum sit, abstulerit. Magnum videor dicere: attendite etiam, quem ad
11 11 modum dicam. Non enim verbi neque criminis augendi causa complector omnia:
12 12 cum dico nihil istum eius modi rerum in tota provincia reliquisse, Latine me
13 13 scitote, non accusatorie loqui! Etiam planius: nihil in aedibus cuiusquam, ne in
14 14 hospitis quidem, nihil in locis communibus, ne in fanis quidem, nihil apud Sicu-
15 15 lum, nihil apud civem Romanum, denique nihil istum, quod ad oculos animumque
16 16 acciderit, neque privati neque publici neque profani neque sacri tota in Sicilia
17 17 reliquisse.
Wie bereits auf den ersten Blick ersichtlich, ist dieser Redeabschnitt extrem rhetorisiert. Gleich zu Beginn springt der dreigliedrige (Trikolon) elliptische (appellat) Parallelismus ins Auge; dieser Dreischritt enthält eine inhaltliche Steigerung: Studium, insania, latrocinium (Klimax); diese dreischrittige Steigerung wird im Folgesatz noch überboten und erreicht ihren höchsten Punkt dadurch, dass der Redner feststellt, dass es für die Tat keine angemessene Bezeichnung gebe: „mir fehlen die Worte“; auch hierfür hatte die antike Theorie der Rede einen Terminus parat: incrementum.
Zeile 3 wartet mit einer Antithese in asyndetischer Form in Verbindung mit einer Ellipse auf: suo (pondere) vs. nominis pondere. Auffällig sind z.B. auch die Anaphern in Z. 5 (tam) und 6ff. (tot und ullum).
1 Z. 1 istius – Das Demonstrativpronomen iste hat hier, wie oft, eine negative Färbung, etwa: „dieser Kerl“.
2 2 appellem – Konj. wegen indirekter Frage, hier mit deliberativ-dubitativer Färbung
3 3 penditote – sog. Imp. II
4 5 appellandum – Gerundivum als Prädikatsnomen, etwa: „zu bezeichnen ist“
5 8 signum – Die etymologisch nächstliegende Übersetzung von signum ist „Schnitt“, denn es leitet sich von secare ab; als „Geschnitztes“ bedeutet signum – wie hier – daher auch Götterbild, Bildchen, Figur, metaphorisch dann eben auch „Zeichen“ usw.; der antike Grammatiker SEXTUS POMPEIUS FESTUS überliefert uns folgende Information zur Semantik von signa: […] ita quoque res ipsae dicuntur, aut lapides aut fictile […] et signa dicuntur quae sculpantur, pocula etiam, in quibus sunt simulacra.
6 9 quin – diese Textstelle verdeutlicht gut die Ableitung von quin aus einem Relativpronomen + Negation
7 9 conquisierit – Konj. Perfekt, anstelle von conquisiverit, eine sog. Nebenform
8 11 criminis augendi causa – sog. Gerundiv-Konstruktion; causa als „Postposition“: wegen, um Willen, vgl. honoris causa
9 13 cuiusquam – Gen. Sg. von quisquam, substantivisches Indefinitpronomen im negativen Satz (nihil)
10 13f. ne … quidem – die beiden Wörter sind zusammen zu sehen (nicht einmal) und nehmen den hervorgehobenen Begriff „in die Zange“
11 16 privati … – genitivus partitivus – abhängig von nihil (Z. 15)
Im Jahre 70, dem Jahr des erfolgreich geführten Verres-Prozesses, wird Cicero für das folgende Jahr zum Ädil gewählt, er erklimmt damit die zweite Stufe des cursus honorum, die dritte (Prätur) und damit das Sprungbrett zum höchsten Amt im Staat im Jahre 66.
Dass Cicero übrigens eine Neigung zum Witz und Spott hatte, zeigt eine Szene während dieser Amtszeit als Prätor, d.h. als Richter, wobei er sich – wieder einmal – als unbestechlich und vorbildlich erwies; in einem Prozess wandte sich ein gewisser Vatinius, dessen Hals mit kropfartigen Geschwülsten übersät war, mit einem Antrag an den Prätor Cicero, worauf dieser sich beriet. Auf den Einwurf des Vatinius, er wäre als Prätor nicht so unentschlossen, wandte Cicero sich zu ihm hin und konterte: „ich habe ja auch nicht einen so dicken Hals“. Ganz ähnlich hatte sich Cicero im Verres-Prozess auch nicht die Gelegenheit entgehen lassen, den Namen des Angeklagten mit dessen Verhalten auf Sizilien in Korrelation zu bringen: Verres bedeutet nämlich „Eber, Schwein“. Eher für harmlosen Wortwitz und Esprit, was man in der römischen Antike urbanitas nannte, steht seine witzige Bemerkung gegenüber seinem Schwiegersohn, der, wie viele Römer – Caesar spricht von der brevitas nostra, d.h. der Römer – nicht sehr groß gewachsen war, als dieser sich ein langes Schwert umgehängt hatte: Quis generum meum ad gladium alligavit?