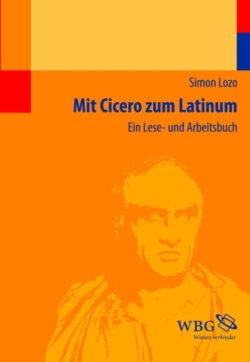Читать книгу Mit Cicero zum Latinum - Simon Lozo - Страница 11
4 Drei Stände. Optimates und populares
ОглавлениеDiese „Dreischichtigkeit in den Staatsorganen“ (Christ), Konsuln (überhaupt höhere Ämter) – Senat – Volksversammlung, spiegelt somit zu einem gewissen Teil die Gliederung des römischen Volkes, des populus als des politischen Ganzen, in drei Stände: Patrizier (Adel, patres), Ritter (equites), plebs als der niedere Bürgerstand, daher tribunus plebis – Volkstribun. Seit den ältesten Zeiten bilden in Rom die Patrizier und Plebejer die Antipoden im Sozialgefüge, in der frühen Republik hatten ausschließlich Angehörige der patrizischen Familien Zugang zu den höheren Ämtern (magistratus – „mehr als der Bürger“); die Karrierestufen waren: Quästor, (Finanzen), Ädil („Polizei“, öffentliche Ordnung), Prätor (Rechtsprechung), Konsul (Kriegswesen, Finanzen, Gerichtsbarkeit). Hatte man eines dieser höheren Ämter innegehabt, die nach den Prinzipien der Kollegialität (nie einer allein) und Annuität (zeitlich beschränkt, meist auf ein Jahr) vergeben wurden, wechselte man nach dem Ende der Amtszeit meist in den Senat, der im Laufe der Geschichte der Republik immer mehr zu einem Gremium gewesener Magistrate geworden war, und blieb Senator auf Lebenszeit; daher also senatus: „Ältestenrat“, vgl. „Senior“.
In den sog. Ständekämpfen (im Laufe des 4. Jhs.) setzte die Plebs, die man auch Terrae filii, Söhne der Erde, also in Abgrenzung zu den Patriziern „Vaterlose“ nannte, für ihre Standesangehörigen den Zugang zu diesen Ämtern durch; waren die Patrizier zunächst die alleinigen Mitglieder des Senats (patres), nannte man die jetzt Hinzugekommenen die „Dazugeschriebenen“, conscripti; daher rührt die offizielle Anrede an den Senat: patres conscripti – Väter und Zugeschriebene. Dieser erweiterte inner circle der Macht hieß seitdem nobilitas. Das Regierungssystem war, wie gesagt, ausgesprochen aristokratisch – oligarchisch, die „herrschende Schicht war der Senatorenstand, sozial betrachtet ein Kreis von Großgrundbesitzern“ (GELZER), dagegen stellten die Ritter nur den „Geldadel“ dar, sie waren die Vertreter des Großkapitals. Auch in der „politischen Parteienlandschaft“ ist die aristokratische Führungsschicht federführend. Hierbei handelt es sich weniger um politische Parteien im modernen Sinn als um politische Klassen, um Cliquen; immer geht es um den Machtkampf einzelner Personen. Einen „basisdemokratischen“ Parteienkampf hat es in Rom nie gegeben. Die Optimaten, die „Guten“ und „Wenigen“, treten für die Bewahrung der alten Ordnung ein, ein popularis ist, „wer gegen die Interessen des Senats dem Volk nach dem Mund redet“ (KROLL) und dabei zumeist im eigenen Machtinteresse agiert; ein Musterbeispiel ist der „Popular“ Caesar, der dem römischen Uradel entstammt.
Über die optimates und populares sagt Cicero in seiner Rede Pro Sestio (96):
1 1 Duo genera semper in hac civitate fuerunt eorum, qui versari in re publica atque in
2 2 ea se excellentius gerere studuerunt; quibus ex generibus alteri se popularis, alteri
3 3 optimates et haberi et esse voluerunt. Qui ea, quae faciebant quaeque dicebant,
4 4 multitudini iucunda volebant esse, populares, qui autem ita se gerebant, ut sua
5 5 consilia optimo cuique probarent, optimates habebantur.
1 Z. 1 versari in re publica – „sich mit dem Staat beschäftigen“, d.h. politisch tätig sein
2 2 se excellentius gerere – eine hervorragende Stellung einnehmen
3 2 quibus – relativischer Satzanschluss
4 2 popularis – ältere Form des Nom./Akk. Pl = popularesSyntax: popularis und optimates sind Prädikatsnomina zu haberi (gehalten werden für) und esse.Hier sind gleichsam untergründig zwei Konstruktionen zu einem ACI verschmolzen: alteri populares (Nom.), alteri optimates (Nom.) esse voluerunt, denn velle steht gewöhnlich bei Subjektsgleichheit mit erweitertem Infinitiv; ist der Infinitiv jedoch passivisch oder durch Prädikatsnomen erweitert, erscheint auch der ACI: alteri se popularis (Akk.), alteri optimates (Akk.) haberi voluerunt.
5 3f. ea … volebant … esse – ACI
6 4f. populares/optimates – sind Prädikatsnomina zu habebantur (s.o.). Syntaktisch handelt es sich strukturell um doppelte Nominative, in denen der 1. Nominativ, also das Subjekt, jeweils zu einem Nebensatzgebilde expandiert ist: qui … volebant esse/qui … se gerebant, ut …
7 5 optimo cuique – gerade den Besten (quisque nach einem Superlativ!)
8 5 probarent – probare hier: jemandem etwas beifallswert erscheinen lassen, einreden