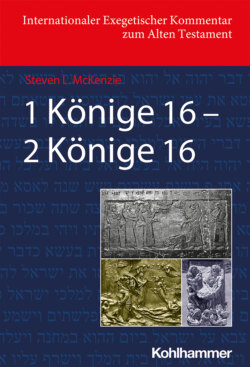Читать книгу 1 Könige 16 - 2 Könige 16 - Steve McKenzie - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anmerkungen zu Text und Übersetzung
Оглавление1 Elija: Bedeutet „mein Gott ist Jhwh“; dieser Name passt hervorragend zur Darstellung der Figur Elijas in den folgenden Geschichten, insbesondere in Kap. 18, wo er der Verteidiger Jhwhs gegen das Eindringen der Baals-Verehrung ist. GB + der Prophet.
der Tischbiter: MT und GBL + מתשבי גלעד, eine Glosse, durch die Elijas Heimatstadt vom Tischbe in Obergaliläa (Tob 1,2) unterschieden wird. Die Vokalisierung des MT, מִתֹּשָׁבֵי („von den Besuchern [Gileads]“), ist schwierig: Der Vokal O wird defektiv geschrieben statt – wie zu erwarten gewesen wäre und wie es bei allen anderen Erwähnungen des Wortes in der Hebräischen Bibel der Fall ist – mit der Mater lectionis. Der Vokal A unter שׁ wird nicht vermindert;1 auch leuchtet nicht ein, dass der Jhwh-Prophet Elija ein in Israel lebender Ausländer sein soll. Folglich ist die Vokalisierung von GBL vorzuziehen: ἐκ Θεσβων = מִתִּשְׁבֵי, „aus Tischbe [in Gilead]“.2 Wo Elijas Tischbe gelegen hat, ist unklar. Die Identifikation mit El-Istib am Dschebel Ajlun im heutigen Jordanien, 13 km nördlich des Jabbok gelegen, stammt aus byzantinischer Zeit, als die Kirche Elijas („Sankt Elija“) erbaut wurde.3
Beim Leben Jhwhs: So GL und VL. MT und GB + der Gott Israels. GB stellt ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων (= אלהי צבאות) voran, was noch eine Erweiterung darstellt. Das Substantiv חי wird in Schwurformeln verwendet, um etwas beim Leben einer Gottheit zu schwören, wie es im Alten Orient gängig war.4
in dessen Dienst ich stehe: Wörtlich: „vor dem ich stehe“, was eine idiomatische Wendung dafür ist, in jemandes Dienst zu stehen oder jemandem zu dienen wie in 1 Kön 10,8. Es kommt auch in 18,15; 2 Kön 3,14; 5,16 vor.
kein Tau oder Regen: Die Konjunktion wird in der Weise benutzt, wie sie sonst meist durch או zum Ausdruck gebracht wird, um Alternativen vorzuschlagen (Joüon §175a). Im Hebräischen gibt es mehrere Worte für Regen. Das hier verwendete (מטר) bezeichnet ganz allgemein Niederschlag, im Unterschied zu spezifischeren Begriffen wie יורה für den Früh(Herbst-)regen, גשם für den heftigen Winterregen sowie מלקוש für den Spät(Frühlings-)regen. Tau (טל) tritt während des gesamten Jahres auf, auch wenn man sich besonders in der Trockenzeit von Mai bis September über ihn freut.5
in diesen Jahren: Ein „Akkusativ der zeitlichen Bestimmung“; siehe Joüon §126i.
3 Wadi Kerit: Der Name ist vermutlich von כרה, „ein Festmahl geben“, abgeleitet, das in der HB nur in der Elischa-Geschichte vorkommt (2 Kön 6,23).6
in der Nähe des Jordans: על־פני bedeutet hier nicht „östlich von“, sondern „nahe, in der Umgebung von“.7
4 Du kannst aus dem Wadi trinken: So MT. GBL + Wasser nach dem Verb.
Raben: Gelegentlich wird die Lesung עֲרָבִים „Araber“ befürwortet8 oder als עֹרְבִים Raben als Spitzname eines in der Region lebenden Araberstammes gedeutet9 oder aber im Sinne von „Kaufleute“.10 Siehe die diachrone Analyse.
angewiesen: Wörtlich: „befahl“. Das gleiche Verb wird in V. 9 verwendet, wo sich kein Hinweis darauf findet, dass die Witwe einen direkten Befehl von Jhwh erhalten hätte. Besser lässt es sich in indirekt kausativem Sinn verstehen.
5 Er ging gemäß Jhwhs Wort und blieb: Der Satz וילך ויעש כדבר יהוה ist als Wiederaufnahme interpoliert worden.11 Der textkritische Befund stützt diese Erklärung: Die Lesarten von GB (καὶ ἐποίησεν Ηλιου) und GL (καὶ ἐπορεύθη Ηλιας) deuten beide darauf hin, dass וילך und ויעש Varianten waren, die im MT verschmolzen wurden. Die Lesart hinter der OG und dem vermutlich ursprünglichsten Text lautete anscheinend וילך כדבר יהוה.12 Motiviert wurde die Hinzufügung wohl durch Interesse am Motiv des Wortes Jhwhs, das in 1 Könige 17–18 durchgängig zu finden ist.
in der Nähe des Jordans: Siehe die Anmerkung zu V. 3; vorangestellt ist in MT und GL das ist.
6 brachten: Zur Verwendung des Partizips zum Ausdruck habitueller Handlungen in der Vergangenheit („würden bringen“), die durch den Kontext bestimmt sind, siehe Joüon §121f.
morgens Brot und abends Fleisch: So GBL. MT und Syr lesen morgens Brot und Fleisch und abends Brot und Fleisch. Turkanik stimmt MT zu und führt an, dass der Übersetzer der OG von Ex 16,8.12 oder von orientalischen Gewohnheiten beeinflusst wurde.13 Die gleichen Überlegungen werden genannt, um genau andersherum für die Lesart der OG zu plädieren.14 Ich übernehme die kürzere Lesart.15
er trank: So MT; GBL + Wasser (vgl. V. 4).
7 Nach einiger Zeit: ימים bezieht sich hier auf einen unbestimmten Zeitraum (vgl. Gen 4,3; 2 Sam 14,26).
Regen: Hebräisch גשם. Siehe zu V. 1. Dieses Wort bezieht sich auf die starken Winterregen, aus denen sich die Niederschläge überwiegend speisten. Deshalb kann es auch für Regen allgemein verwendet werden, was vermutlich hier der Fall ist.
9 Steh auf, geh: So MT. GBL verbindet die beiden Verben durch und. Der Imperativ קוּם ist eine Interjektion wie das deutsche „Vorwärts!“. Ich habe es hier übersetzt, weil dadurch das Motiv von Auftrag und Ausführung in diesem und dem nächsten Vers betont wird.
Sarepta: Der Schlusskonsonant des hebräischen Namens צרפתה ist die Lokativ-Endung ה. Es ist paragogisch und verändert in der Regel nicht die Vokalisierung des Namens, an den es angehängt wird. Das deutet darauf hin, dass der Name dieses Ortes dem MT zufolge „Ṣarphath“ lautete (GesK §90i; Joüon §93c). Auf Griechisch wird es hier sowie in Lukas 4,26 als Sarepta (Σαρεπτα) und im Akkadischen als Ṣariptu bezeichnet. Es ist von einer Wurzel (צרף) abgeleitet, die „schmelzen, läutern“ bedeutet oder vermutlich eher „rot färben“ (nur Ersteres kommt im Hebräischen vor, während es im Assyrischen beides gibt – CAD 16,102–105). Der Ort befand sich an der phönizischen Küste etwa 22,5 km nördlich von Tyrus und 13 km südlich von Sidon an der Stelle des heutigen Ras Sarafand, worin sich der antike Name erhalten hat. Es wird im Papyrus Anastasi I aus dem 13. Jahrhundert als Hafenstadt bezeichnet (ANET 477a; COS 3,2 [S. 12]) und in den Annalen Sanheribs als eine der Städte genannt, die sich ihm 701 v. Chr. unterwarfen (ANET 287b; COS 2,119B). Ausgrabungen am Tell in der Nähe des heutigen Dorfes Sarafand haben Hinweise darauf zutage gefördert, dass sich hier in der Eisenzeit ein Geschäftszentrum befand, in dem vor allem Keramik und rot-violetter Farbstoff hergestellt wurden.16
in Sidon: MT + und bleib dort, vielleicht beeinflusst durch die Elischa-Geschichte in 2 Könige 4.17 Für Turkaniks Behauptung, dass der Übersetzer der OG nicht sagen wollte, dass Elija auf dem Gebiet Sidons lebte, um nicht dessen Berufung und Aufgabe als Prophet aufs Spiel zu setzen, gibt es keine Belege.18 Nicht nur finden sich Gegenbeispiele bei Ezechiel, Jeremia und Jona, wie Turkanik auch einräumt. Die vorliegende Geschichte lässt keinen Zweifel daran, dass Elija längere Zeit bei der Witwe geblieben ist.
angewiesen: Siehe zu V. 4.
eine Witwe: Wörtlich: „eine Frau, eine Witwe“, eine Nebeneinanderstellung von Genus und Spezies (Joüon §131b).
10 Sarepta: So MT und GB. GL + in Sidon.
zum Eingang der Stadt: MT stellt ויבא voran, und als er kam.
eine Witwe: Siehe zu V. 9.
die Holz sammelte: Ein denominatives Verb (Partizip Polel) vom Substantiv קש, „Stoppeln, Spreu“. Dessen Objekt עצים („Holz“) sollte grob als „Zweige, Stroh“ verstanden werden, also im Grunde genommen als Bezeichnung für alles Brennbare.
Er rief sie und sagte: So MT. GBL: Elija rief hinter ihr her und [L: Elija] sagte zu ihr. Die Konstruktion hinterherrufen ist relativ selten (1 Sam 20,37–38; 24,9), weshalb es ungewöhnlich ist, dass sie hier sowie in V. 11 steht. Die vorliegende Stelle ist vermutlich von V. 11 beeinflusst, wo sie sinnvoller erscheint.
Bring mir bitte: So MT, GL, Syr usw. In GB fehlt mir. Die Partikel נא macht deutlich, dass Elijas Worte eher eine Bitte sind als eine Forderung, als die sie in manchen deutschen Übersetzungen erscheint.
in einem Becher: Wörtlich: in dem Becher. Warum hier der bestimmte Artikel steht, ist unklar.
11 rief er ihr nach und sagte: Siehe zu V. 10. Hier ergibt die griechische Lesart ihr nach Sinn, weil die Frau weggegangen ist, um Wasser für ihn zu holen.
Bring mir bitte ein Stück Brot in deiner Hand: So MT. Die Imperativform לקחי ist ungewöhnlich. Sie könnte eine Alternative zu קחי sein, analog zu לקח als Imperativ maskulinum Singular (Ex 29,1; Ez 37,16; Spr 20,16) neben קח. Sie könnte auch eine fehlerhafte Lesung von קחי לה sein.19 Am Versende erweitern GL und die meisten griechischen Textzeugen durch damit ich essen kann (φάγομαι), was eine Harmonisierung mit V. 10 darstellt.
12 Beim Leben Jhwhs, deines Gottes: Siehe zu V. 1.
nichts: Gelesen wird אם יש לי מאומה ausgehend von Syr und Targum. Die Lesart des MT, מעוג, ist zweifelhaft; sie kommt nur an einer weiteren Stelle in der Hebräischen Bibel vor (Ps 35,16), wo sie mit ziemlicher Sicherheit irrtümlich steht. Vermutlich bezieht sich das Wort auf eine Art runden Brotlaib, der auf Stein oder in der Asche gebacken wurde und nicht in einem Ofen. Zumindest ist das die Bedeutung von עגה (< עוג) (von einer semitischen Wurzel, die eine runde oder gebogene Form bezeichnet), das in 17,13 (vgl. auch 19,6) zu finden ist. Die Alternative „etwas“ (מאומה) passt besser zur darauffolgenden Näherbestimmung – außer einer Handvoll Mehl. Nach dem Schwur beim Leben Jhwhs hat אם („falls“) wie das englische „I’ll be damned if“ negative Bedeutung und stellt eine starke Ablehnung dar. Die übrige Rede der Witwe zeigt, dass sie auf Elijas Bitte nicht antwortet, dass sie nichts vorbereitet hätte, sondern dass sie praktisch nichts erübrigen kann, weil sie selbst in Not ist.
im Topf: Der כד war ein mittelgroßes Vorratsgefäß, das vielseitig eingesetzt wurde. In Genesis 24 trägt Rebekka es als Wasserbehältnis auf ihrer Schulter, und in Ri 7,16–20 dienen sie den Männern Gideons dazu, Fackeln darin zu verstecken. Die letztgenannte Geschichte deutet darauf hin, dass diese Gefäße überall vorhanden und erschwinglich waren. Beiden Geschichten zufolge müssen sie eine große Öffnung gehabt haben, aus der man eine Handvoll Mehl entnehmen konnte, die man aber auch zu Lagerungszwecken mit einem Deckel abdecken konnte.20
im Krug: Der צפחת war ein kleiner Krug mit zwei Griffen, die sogenannte „Pilgerflasche“, die für gewöhnlich als Feldflasche diente (1 Sam 26,11–12). Dass sie hier für Öl verwendet wird, mag mit der verzweifelten Lage der Witwe zu tun haben21 oder darauf hindeuten, dass sie von etwas anderer Art war.22
ein bisschen Holz: Zur Verwendung von zwei im Sinne des deutschen ein paar oder einige siehe Joüon §142c (z. B. 2 Kön 9,32).
meinen Kindern: Gelesen wird mit den griechischen Textzeugen der Plural; MT hat mein Sohn. Die Deutung von בני als Singular wurde von der folgenden Geschichte beeinflusst, die wiederum durch die Geschichte von der Frau von Schunem und ihrem einzigen Sohn in 2 Kön 4,8–37 beeinflusst wurde. Die Frau in der Geschichte in 2 Kön 4,1–7, der diese Frau in 1 Kön 17,1–7 nachempfunden ist (siehe unten), hat ebenfalls Söhne oder Kinder.
essen: Wörtl.: wir werden essen. MT hat das Suffix maskulinum Singular: „wir werden es essen“. In GBL weggefallen.
13 Fürchte dich nicht: Den Ausdruck gibt es in der HB in verschiedenen Zusammenhängen, wobei die bekanntesten Vorkommen die bei Deuterojesaja sind (Jes 40,9; 41,10.13–14; 43,1.5; 44,2; 54,4).
kleinen Laib: Siehe die Anmerkung zu nichts in V. 12.
deine Kinder: Siehe zu V. 12.
14 Jhwh (1): So GBL. MT und Syr + der Gott Israels.
das Mehl im Topf wird nicht zur Neige gehen, und das Öl im Krug wird nicht versiegen: Beim Imperfekt Qal eines III-ה-Verbs ist die Vokalisierung jikleh zu erwarten; תִכְלָה folgt aber dem Vokalschema eines III-א-Verbs (GesK §75rr), vielleicht um ähnlich zu klingen wie das nächste Verb (תֶחְסָר).23
schickt: Gelesen wird der Infinitiv constructus תת (von נתן „geben“) mit dem Qere statt mit dem Ketib תתן.
15 Also ging sie und gab ihn ihm: Gelesen wird ותלך ותתן לו auf der Grundlage von Pablo Torijanos Rekonstruktion der OG (καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνὴ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ) (im persönlichen Gespräch). Sie tat gemäß dem Wort Elijas ist ein vom Motiv des Wortes Jhwhs ausgehender Zusatz, der der ursprünglichen Legende an mehreren Stellen angefügt wurde.24 Ein Hinweis auf die Witwe, die Elija zu essen gibt, scheint notwendig zu sein, und καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ist bei den griechischen Textzeugen gut bezeugt, auch wenn es in GBL fehlt.
und ihre Kinder: So GBL wie bereits zweimal zuvor (Vv. 12–13). Hugo überlegt, ob der MT den Plural „Kinder“ in dieser Textpassage um des dramatischen Effekts willen und in Übereinstimmung mit der Geschichte in Vv. 17–24 unterdrückt hat.25 Doch dies kann nicht erklären, warum der MT hier Haus anstelle des Singulars Sohn hat wie sonst in Vv. 9–16. Haus belegt die Beeinflussung durch 2 Kön 4,1–7, woher die Geschichte ursprünglich stammt. Viele Tage lang (ימים) im MT ist eine Glosse, worauf das Fehlen in GBL hindeutet.
16 das Mehl im Topf ging nicht zur Neige, und das Öl im Krug versiegte nicht: Siehe zu V. 14. Das Verb versiegen (חסר) ist maskulin, obwohl angesichts des nomen regens der Konstruktus-Verbindung, צפחת, das Femininum zu erwarten gewesen wäre. Auch wenn es Beispiele dafür gibt, dass ein Verb mit dem nomen rectum oder Genitiv in einer Konstruktus-Verbindung übereinstimmt (GesK §146a; Joüon 150n), ist es gerade an dieser Stelle merkwürdig, weil das gleiche Verb nur zwei Verse zuvor (V. 14) in Übereinstimmung mit dem nomen regens feminin war.
17 der Herrin des Hauses: Klostermann liest בעלית הבית im oberen Raum des Hauses statt בעלת הבית und betrachtet es als eine falsch platzierte Glosse zu שם in V. 19.26 Dieser Vorschlag wird nicht durch textkritische Indizien gestützt. Vielmehr bildet בעלת הבית einen von mehreren Belegen dafür, dass die Geschichte ihre Entstehung 2 Kön 4,8–37 verdankt.
wurde krank: So MT (חלה). In GBL spiegelt sich das Imperfekt consecutivum ויחל. Die beiden Konstruktionen (also Perfekt und Imperfekt consecutivum mit folgendem ויהי + Temporalsatz) bilden Varianten, die keine erkennbaren Bedeutungsunterschiede aufweisen.27
dass er zu atmen aufhörte: Wörtlich: es war in ihm kein Atem mehr (לא־נותרה־בו נשמה). GB gibt dies als οὐχ ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ πνεῦμα wieder. GL stimmt damit überein, außer dass sich statt πνεῦμα hier πνοὴ ζωῆς findet, Atem des Lebens, worin sich eine Erweiterung, vielleicht beeinflusst durch Gen 2,7, spiegelt: נשמת חיים.
18 Was hast du gegen mich?: Wörtl.: Was ist mit mir und mit dir? also Was haben wir gemeinsam? Hier und an anderen Stellen (Ri 11,12; 2 Sam 16,10; 19,23; 2 Chr 35,21) hat dieser Ausdruck die Bedeutung Was [für ein Problem] gibt es zwischen uns [dass du mir schaden willst]?28 Die Frau sagt damit, dass Elijas Anwesenheit Gott auf sie und ihre Sünde aufmerksam gemacht hat, was wiederum den Tod ihres Sohnes als Strafe zur Folge hatte.
dass du kommst: Zu erwarten wäre entweder die Partikel כי oder die Fragepartikel ה vor dem Verb באת: Was hast du gegen mich … dass du gekommen bist …? bzw. Was hast du gegen mich …? Bist du gekommen …? Es gibt für keine der beiden Möglichkeiten zwingende textliche Belege (auch wenn einige hebräische Handschriften und der Targum כי haben) und keine grammatische Regel, die den Ausfall eines der beiden erklären könnte. Der Text ist schlicht elliptisch.
hinweist auf: Zu dieser Übersetzung des Hifil von זכר siehe Cogan.29
meine Missetat: So MT (את־עוני). GBL: meine Missetaten (τὰς ἀδικίας μου). Beides ist möglich.
19 Er antwortete: Wörtl.: Er sagte zu ihr (so MT). GBL: Elija sagte zu der Frau.
sein Bett: So MT und GB. GL: das Bett. Beides ist möglich.
20 Elija rief: So GBL = ויקרא אליהו. MT: ויקרא אל־יהוה, er rief zu Jhwh. Beide entsprechen sich bis auf das Schluss-He beim Gottesnamen. Beides ist möglich. Trotzdem kann MT durch den Wortlaut von V. 21 beeinflusst sein.
Ach, Jhwh: So GBL: οἴμμοι κύριε = יהוה אהה.30 MT: Oh Jhwh mein Gott (יהוה אלהי).
sogar über diese Witwe: So MT (הגם על־האלמנה). Die griechische Lesart das Zeugnis der Witwe (ὁ μάρτυς τῆς χήρας) kann auf die Verderbnis einer Variante hindeuten (העוד על־האלמנה).31
21 Er hauchte den Jungen an: So GBL: καὶ ἐνεφύσησεν = ויפח. MT: er streckte sich hin = ויתמדד, was auf Elijas Handeln in 2 Kön 4,34 zurückgeht.32
zu ihm zurück: Gelesen wird אל־קרבו statt MT על־קרבו, wie es sich bei GBL εἰς αὐτόν nahelegt.
22 Jhwh hörte auf Elija, so dass das Leben des Jungen zu ihm zurückkehrte und er lebte: So MT. GB (so geschah es, und der Junge schrie auf) ist entstanden durch eine Haplographie, die durch die Wiederholung von על־קרבו vom Ende von V. 21 hervorgerufen wird. Durch die Auslassung steht ויחי nun allein, woraus ויהי כן (καὶ ἐγένετο οὕτως = so geschah es) geworden ist. Die Lesart schrie auf ist eine Textverderbnis innerhalb der griechischen Überlieferung oder aber eine Änderung von ἀνεβίωσεν, was als Korrektur eingeführt worden sein könnte.33 GL verschmilzt die beiden Lesarten und bezeugt καὶ ἐγένετο οὕτως in Übereinstimmung mit der OG sowie ἐπιστράφη ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου εἰς αὐτόν in Entsprechung zum MT.
23 Elija nahm den Jungen: So MT. Fehlt in GBL aufgrund von Haplographie (הילד … הילד).
24 Nun weiß ich: So MT (ידעתי עתה זה). GBL: Siehe, ich weiß (ἰδοὺ ἔγνωκα = הנה ידעתי). Zwar sind beide Lesarten möglich, doch der MT ist idiomatischer und passt mit seiner Verwendung von עתה besser in den Kontext. Also ist jetzt – mit der Erweckung ihres Sohnes – der Zeitpunkt, an dem sich die Frau noch stärker bewusst wird, welchen Rang und welche Macht Elija hat. Vergleiche 2 Kön 5,22.