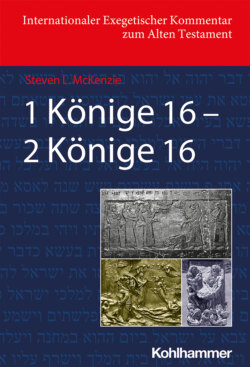Читать книгу 1 Könige 16 - 2 Könige 16 - Steve McKenzie - Страница 60
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Diachrone Analyse
ОглавлениеDie Rolle von 19,1–3 als Überleitung Das vorliegende Kapitel setzt die vorangegangenen voraus, doch zugleich steht es in Spannung zu ihnen. Ahabs Bericht an Isebel (V. 1) setzt ganz offensichtlich die Geschichte von Kap. 18 als gegeben voraus, und zwar vor allem Elijas Massaker an den Baals-Propheten (18,40). Isebels Schwur, ihn töten zu lassen (V. 2), hat zur Voraussetzung, dass sie zu diesen Propheten in einer Beziehung steht (18,19), und es passt dazu, dass sie die Propheten Jhwhs hat verfolgen lassen (18,4.13). Es gewährt auch einen Einblick in ihren Charakter, der gut zu ihrer auch sonst belegten (z. B. 1 Kön 21,1–16; 2 Kön 9,30–36) konfrontativen Art passt; darin zeigt sich, dass der Erzähler mit diesen späteren Geschichten vertraut ist.44 Isebels Nachricht an Elija ergibt keinen Sinn, wenn sie ihn wirklich töten möchte, doch durch sie wird ein erzählerischer Übergang zu Elijas Weg in Vv. 4–18 geschaffen. Elijas Furcht (in V. 3 wird וַיִּרָא gelesen) gehört zu dieser Überleitung; sie steht im Widerspruch zum Bild des kühnen Propheten von Kap. 18, der das Feuer vom Himmel herbeiruft, doch sie ist eine Einleitung für Elijas Wanderung, die ihn später zu der Begegnung am Horeb führt.45 Die Überleitung (Vv. 1–3) ist nicht sekundär zu Vv. 4–18 hinzugesetzt worden, weil ohne Vv. 1–3 die Erklärung für Elijas Gang fehlt. Aus der Überleitungsfunktion von Vv. 1–3 geht hervor, dass uns hier der gleiche PE begegnet, der die Kap. 17–18 abgefasst hat. Durch die Notiz in V. 3a, wonach Beerscheba zu Juda gehört, wird deutlich, dass Elija sich nun sehr weit von Isebels unmittelbarem Zuständigkeitsbereich entfernt hat. Deshalb muss es sich bei der Notiz nicht um eine Glosse handeln.46 Ebenso wenig ist sie ein zeitlicher Ankerpunkt, durch den die Geschichte vor den Untergang des Nordreichs 721 v. Chr. datiert werden könnte. Ihre Erwähnung könnte aus der Hagar-Geschichte stammen, die den Handlungsrahmen für Vv. 4–18 liefert (vgl. Gen 21,14). Der Diener, den Elija in Beerscheba verlässt (V. 3), stammt aus 18,42–43. Dass er zurückgelassen wird, passt zu Elijas Gefühl der Verlassenheit in der Wüste.47
19,4–14: Themen und erzählerische Kontinuität Die erzählerische Kontinuität bleibt trotz der Spannung zwischen Elijas Mutlosigkeit und seinem Sieg am Karmel auch in den Versen 4–14 gewahrt. An zentraler Stelle geht es in Kap. 18 um Elijas Enttäuschung darüber, dass die Israeliten sich von Jhwh abgekehrt, seine Altäre niedergerissen und seine Propheten ermordet haben (19,10.14).48 Zu Kap. 17–18 gibt es auch motivische Kontinuitäten. So wird beispielsweise das Muster von Auftrag und Ausführung in Kap. 19 im doppelt ergehenden Auftrag des Engels fortgeführt, aufzustehen und zu essen (Vv. 5–6.7–8), sowie auch im Auftrag der Stimme, vor die Höhle zu gehen und sich dort hinzustellen (Vv. 11.13). Noch bedeutsamer ist, dass das Motiv des Wortes Jhwhs in 19,9.13 auf sehr eindrucksvolle Art eingesetzt wird, wenn das Wort mit der ruhigen Stimme in eins gesetzt wird, welche die Theophanie als bevorzugte Offenbarungsweise Jhwhs ablöst. Wenn das Thema, das bereits in den beiden vorangegangenen Kapiteln eine große Rolle spielte, in 19,9.13 seinen Höhepunkt erreicht, so deutet das erneut darauf hin, dass 19,4–14 in der vorliegenden Form auf PE zurückgehen. Diese Verse weisen in ihren Grundzügen eine auffällige Ähnlichkeit mit der Hagar-Geschichte in Gen 21,14–19 auf, die hier eventuell als Vorlage gedient haben könnte.49
19,4b–5a.6bβ–8a: Mögliche Interpolationen Elijas erste Bitte um den Tod sowie sein Schlafen in Vv. 4b–5a werden im MT durch die Wiederholung der Wendung unter einem Ginsterstrauch (תחת רתם אחד) zusammengehalten, was auf die Überarbeitung einer älteren Erzählung durch PE hindeuten könnte. Doch die griechischen Textzeugen gehen von einem anderen Wort in V. 5 aus (שיח), was ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Wiederholung nicht das Ergebnis einer Interpolation, sondern eine Glosse ist (siehe die Anmerkung). Eine zweite mutmaßliche Interpolation wird für Vv. 6bβ–8a MT vorgeschlagen.50 In diesen Versen werden das Erscheinen des Engels und das Motiv von Auftrag und Ausführung zweimal erwähnt und nicht nur einmal. Auch wird hier eine lange Wanderung durch die Wüste vorgestellt, und in V. 8b wird mit dem Bezug auf die vierzig Tage und Nächte sowie auf den Horeb gearbeitet, um Elija als Abbild Moses darzustellen. Ohne diese Verse würde allerdings die Bezeichnung der „Mannes“ in V. 5 als Engel wegfallen, was für die Textpassage von entscheidender Bedeutung ist.51 Deshalb ist das Fehlen der Verse in GL auf eine Haplographie zurückzuführen (er aß und trank) und stellt keinen Hinweis auf eine Interpolation dar.52
Elijas VerzagtheitElijas Rast unter dem Ginsterstrauch nach einer Tagesreise (Vv. 4b–5a) unterstreicht, wie verzagt er ist, und nimmt die Bitte vorweg, die er am Horeb vorbringen wird. Er sieht sich selbst als Versager wie die Propheten vor ihm und bittet darum, sich zu ihnen gesellen zu dürfen. Durch Jhwhs Antwort auf dem Berg wird nicht nur sein Wirken gerechtfertigt, sondern das aller Gerichtspropheten.53 Der Mann in V. 5b, der Elija weckt, damit er etwas zu sich nimmt, ist ein Engel (Vv. 6bβ–8a). עגת in V. 6a ist wie מעוג in 17,12 eine Art Brot oder Gebäck, das über glühenden Kohlen gebacken wurde und nicht in einem Ofen (Ez 4,12).54 Seine Verwendung an dieser Stelle zusammen mit צפחת für den Wasserkrug erinnert an die wundersame Versorgung Elijas in 17,1–7.8–16. Auch liegt hier eine Anspielung auf das Manna in der Wüste bei Mose (Ex 16,31–35; Num 11,6–9; Dtn 8,3.16) vor, insbesondere angesichts der Erwähnung der vierzig Tage und Nächte dauernden Wanderung zum Horeb in V. 8 (z. B. Dtn 8,2; 9,9.25). Wo genau der Horeb/Sinai liegt, weiß man nicht; es gibt mindestens ein Dutzend Vorschläge, von denen die beiden wahrscheinlichsten im Westen Saudi-Arabiens (dem antiken Midian) und auf der Sinai-Halbinsel liegen, wobei auf beide der Name „Wüste, Einöde“ passt. Früher wurde allgemein angenommen, dass Elijas Reise eine Wallfahrt zu den Ursprüngen des israelitischen Bundes war, durch die er seine Verpflichtung zum prophetischen Wirken bekräftigt hat. Diese Sichtweise ist allerdings in der Forschung mit dem Hinweis darauf angefragt worden, dass Elija zum Horeb geht, um sich von seiner Berufung als Prophet loszusagen.55 Der Horeb wurde ausgewählt, weil er mit Mose verbunden ist, als dessen Abbild Elija erscheint. Der bestimmte Artikel bei Höhle und die Wiederholung des Wortes dort56 in V. 9 betonen die Mose-Metaphorik noch stärker und identifizieren diesen Ort mit der „Felsspalte“ (נקרת הצור), an der Mose stand, als Gott vorüberzog (Ex 33,22).
19,9–10: Elijas leidenschaftliches Eintreten Jhwhs Frage in V. 9, Was tust du hier?, ist weder rhetorisch noch als Zurechtweisung zu verstehen,57 sondern versucht zu erkunden, welcher Art ein Problem oder eine Verstimmung zwischen den Parteien besteht (siehe zu 17,18). Ihr Sinn lautet ungefähr „Welche Frage oder welches Problem führt dich hierher?“ Elijas Erklärung für sein leidenschaftlichen Eintreten (קנא ל) für Jhwh (V. 10) bringt unbedingte Ergebenheit zum Ausdruck58 sowie die Lust, sich mit den Gegnern Jhwhs zu streiten (Num 25,13). Elijas Handeln am Karmel und sein Massaker an den Baals-Propheten (18,40) veranschaulicht, wie leidenschaftlich Elija sich einsetzt; dadurch wird auf Jehu vorgegriffen, der mit seinem leidenschaftlichen Einsatz für Jhwh prahlt (2 Kön 10,16). Elijas Beschwerde bezieht sich auf andere Einzelheiten des Wettstreits am Karmel – die niedergerissenen Altäre (18,30), die getöteten Propheten (18,4.13) sowie Elijas Verlassensein (18,22). Die Erwähnung der Altäre (im Plural) Jhwhs steht dem Prinzip der Kultzentralisation diametral entgegen und weist darauf hin, dass die Abfassung dieser Textpassage nicht durch DtrH erfolgt ist.
19,11–14: Die Theophanie Auf Elijas Beschwerde wird in der Theophanie in Vv. 11–14 eingegangen. Diese ist durch die Wiederholung von Elijas Bekundung seines leidenschaftlichen Einsatzes für Jhwh als Reaktion auf Jhwhs Frage, warum er dort sei (Vv. 9b–10.13bβ–14), in den Kontext eingebunden. Doch da Elijas Beschwerde in Vv. 10.14 die drei Hauptanliegen voraussetzt, um die es der PE-Redaktion von Kap. 18 geht, stellt die Theophanie-Szene keine Interpolation durch PE in einen älteren Text dar. Vielmehr deutet dies auf seinen Einsatz der Wiederaufnahme als schriftstellerisches Mittel der Rahmung hin. In der Schilderung der Theophanie wird eine Art Prozession dargestellt, bei der Jhwh der Wind, das Erdbeben und das Feuer vorausgehen, die als seine Vorhut dienen.59 Dass Jhwh in einem dieser Elemente gegenwärtig ist, wird explizit verneint, woraufhin die קול דממה דקה auftritt. Auch wenn das im Text – zumindest im MT – so nicht direkt gesagt wird, ist diese קוֹל mit Jhwh in eins zu setzen. Das ergibt sich auch aus dem Kontrast, der zwischen der Gewalt von Wind, Erdbeben und Feuer – in denen Jhwh ausdrücklich nicht ist – und der Ruhe der Stimme besteht.60 Ein weiterer Hinweis darauf ist dadurch gegeben, dass die Gegenwart Jhwhs in der קוֹל nicht mehr bestritten wird, nachdem dies dreimal zuvor geschehen ist. Darüber hinaus hüllt Elija nach dem Hören der קול דממה דקה sein Gesicht in seinen Umhang, was ein Akt der Ehrerbietung angesichts der Gegenwart Gottes ist. Die Frage Was tust du hier, Elija? wird wiederholt (V. 13), wobei sie diesmal von einer Stimme (קול) gestellt wird und nicht von dem Wort Jhwhs (V. 9). Dadurch wird die Stimme mit dem Wort Jhwhs in eins gesetzt und zusätzlich bestätigt, dass die קול דממה die Jhwhs ist.
Prophetische Offenbarung Das zarte Flüstern stellt den machtvollen Elementen der Gewittertheophanie eine stille prophetische Offenbarung gegenüber. Dieser Gegensatz ist besonders nach Elijas Sieg am Karmel von Bedeutung. Die Polemik gegen Baal ist nicht zu übersehen. Mehr noch – hier wird bestritten, dass die Theophanie des Sturmgottes eine Form der Offenbarung ist.61 Die Religion Isebels, die Baals-Verehrung, ist tot. Sogar die mit ihr verbundene Offenbarungsweise ist hinfällig. Zugleich wird hier die Prophetie als Jhwhs bevorzugter Weg der Offenbarung an die Menschen bestätigt: Sie ist der Tora ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen; dazu siehe die synchrone Analyse.
19,15–18: Auftrag zur Salbung Jhwhs Anweisungen in Vv. 15–18 setzen das Material über Elischa, Hasael und Jehu in 2 Könige voraus und sind deshalb eindeutig redaktionellen Ursprungs.62 Die Nennung der drei Figuren nimmt die Bestrafung Israels wegen des Abfalls von Jhwh unter Ahab und Isebel vorweg, die von Hasael und Jehu vollzogen und in gewisser Weise durch Elischa gesteuert wird. Das Interesse an der Gerichtsprophetie, die vor allem auf Ahab und die Ahabiten zielt, ist ein Kennzeichen PEs, und der Auftrag in diesen Versen zeigt, wie umfangreich seine redaktionelle Tätigkeit bis hin zu den Elischa-Geschichten gewesen ist. Doch es gibt hier auch Probleme. Weder salbt Elija eine dieser drei Figuren, noch tötet er jemanden mit dem Schwert (V. 15). Alt hat postuliert, dass ein Redaktor das Ende der Elija-Geschichten abgeschnitten hat, um sie besser an die Elischa-Geschichten anzupassen, wodurch der Bericht über Elijas Erfüllung seines Auftrags quasi auf dem Boden des Schneideraums liegen geblieben ist.63 Doch das setzt voraus, dass einst unabhängige Traditionen existiert haben, nach denen Elija eigenhändig Elischa, Jehu und Hasael gesalbt hat. In Anbetracht der starken Traditionen, die Hasael und Jehu mit Elischa verbinden, ist dies aber sehr unwahrscheinlich. Vielmehr wird hier das „Salben“ metaphorisch verwendet.64 Der Auftrag in Vv. 15–16 setzt die Geschichten von Elischa als Nachfolger Elijas voraus wie auch die Straatsstreiche durch Hasael und Jehu, nachdem Elija schon lange nicht mehr da ist. Elischa salbt weder Hasael noch Jehu, doch er sagt die Thronbesteigung Hasaels voraus (2 Kön 8,13) (und veranlasst sie?) und schickt den Propheten, der Jehu persönlich salbt (2 Kön 9,1–10). Dass bei allen drei Figuren das Wort salben verwendet wird, schafft eine Symmetrie zwischen ihnen und unterstellt die drei der Obhut Elijas. Elijas Auftrag an Elischa entspricht Moses Auftrag an Josua, was wiederum eine Parallele zwischen Mose und Elija darstellt.65 Diese metaphorische Deutung wird zudem durch die Aussage über das Töten durch Elischa in V. 17 gestützt. Ebenso wenig wie er salbt, richtet er selbst Menschen hin. Auch hier besteht eine Ähnlichkeit zu Hasael und Jehu. Es ist Elischa, durch den das Schwert Hasaels und das Schwert Jehus mit Macht ausgestattet und in Gang gesetzt werden.66 Danach wäre V. 18 keine Zurechtweisung oder Korrektur der durch seine Verlassenheit geprägten Perspektive Elijas, wie häufig behauptet wird, und es spiegelte sich in ihm auch keine (nach-)exilische Hoffnung auf einen gerechten Rest.67 Vielmehr liegt hier ein Ex-eventu-Prophetenwort über diejenigen vor, die Jehus Säuberungsaktion überlebt haben. Die Zahl 7.000 steht symbolisch für eine große Gruppe von Israeliten, die nach Jehus Ermordung des abtrünnigen Königshauses und seiner Anhänger übrig bleiben werden. Diese Gläubigen werden sich nicht vor Baal verneigen oder ihn küssen. Der Ausdruck das Knie beugen bedient sich einer Synekdoche, um die Unterordnung eines Menschen zu bezeichnen; zur üblichen altorientalischen Haltung gehört der Kniefall auf beide Knie und/oder die Prostration.68 Auch das Küssen der Statue eines Gottes ist ein Akt der Anbetung; darauf wird in Hos 13,2 angespielt.
19,19–21: Elija erhebt Anspruch auf Elischa als Diener Seit Alt ist allgemein anerkannt, dass Vv. 19–21 ursprünglich zum Elischa-Material gehört hat und den Geschichten über Elija erst sekundär durch die ersten beiden Worte von V. 19 (וילך משם) angefügt wurden.69 In שם (dort), das GL nach dem Verb fand setzt, was aber so bald nach משם keinen Sinn ergibt, liegt ein zusätzlicher textkritischer Hinweis auf die Nahtstelle vor. In der Elischa-Geschichte wurde offenbar der Ort genannt, an dem Elija zum erstenmal auf Elischa traf (Abel-Mehola?), doch diese Angabe wurde abgetrennt, als die Anekdote in die Elija-Geschichten eingefügt wurde. Elija trifft Elischa zuhause beim Pflügen an (Vv. 19–21). Entweder hat dieser zwölf Ochsengespanne vor sich (die von anderen Arbeitern geführt wurden, vielleicht von „den Leuten“ aus V. 21), oder er hat zwölf Parzellen Land zu bearbeiten. In beiden Fällen stammt er aus einer wohlhabenden Familie. Indem Elija Elischa seinen Umhang überwirft, macht er seinen Anspruch auf Elischa als seinen Diener geltend (Ez 16,8; Rut 3,9).
Die symbolische Bedeutung des Umhangs Elija übergibt hier seinen Umhang (אדרת) noch nicht auf Dauer an Elischa, weshalb diese Anekdote keine Dublette von 2 Könige 2 ist, sondern mit dem Text nur das Motiv des Umhangs gemeinsam hat. Der Umhang als Symbol für Elijas Identität und Macht (2 Kön 1,8; 2,8.13.15) spielt darauf an, dass Elischa die Nachfolge Elijas antritt, was in 2 Könige 2 geschieht. PE nutzt die Anspielung im Auftrag von Vv. 15–18 dazu, Elischa als Elijas Nachfolger zu benennen (V. 16) und an die Parallele zu Mose und Josua (Ex 24,13; Num 11,28; Jos 1,1) anzuknüpfen. Dass das Verb שׁלך (Hifil) in den Plagen-Erzählungen (Ex 4,3; 7,9–10; 15,25) und in den Elischa-Geschichten (2 Kön 2,21; 4,41; 6,6) für magische Handlungen verwendet wird, deutet darauf hin, dass Elischa eine Art Macht- oder Status-Übertragung zuteil wird.70 PE fügt am Ende des Verses וישרתהו hinzu, was die Kontinuität zu Mose noch einmal verstärkt (Ex 24,13; Num 11,28; Jos 1,1) und sich gut mit dem Mose-Thema in Vv. 4–14 verbindet. Wie bei Josua wird Elischa hier als Vorspiel zu seiner Übernahme des Amtes seines Mentors zum Diener Elijas.
Elischa ist bereit zur Übernahme des Amtes, in das Elija ihn einsetzt. Er bittet lediglich darum, seinen Vater küssen, d. h. ihm auf Wiedersehen sagen zu dürfen (V. 20).71 Elijas Antwort ist kryptisch und auf vielerlei Weise gedeutet worden:
– als Verzichtserklärung: „Tu, was dir gefällt, weil ich dir nichts getan habe;“72 oder „Wenn du mir nicht folgen willst, dann zwinge ich dich nicht“;73 oder „Geh, kehre um, um ihn zu küssen; was habe ich dir getan, dass du das nicht tun darfst?“;74
– als Vorwurf: „Du möchtest zurückkehren, doch denkst du, dass ich nichts für dich getan habe?“;75
– als Bestätigung dafür, dass der Sinn von Elijas Handeln Elischa dazu veranlassen soll, sich von seiner Familie zu verabschieden;76
– als Erlaubnis mit einer Aufforderung, darüber nachzudenken, was Elija wohl tut, wenn er Elischa zu seinem Diener macht;77
– als wörtlich gemeinte Frage: „Was bedeutet eine Amtseinsetzung?“, denn Elischa denkt, dass Elija ihn zu seinem Nachfolger beruft, wenn er in Wirklichkeit ein Diener sein soll.78
Da Elischa nach Hause geht, um sich zu verabschieden, lässt sich die Frage Elijas am ehesten als Bestätigung oder Erlaubnis deuten. Der Befehl geh zurück (שוב) ist mehrdeutig; er könnte Elischa erlauben, nach Hause zu gehen, oder ihm befehlen, nach dem Gang nach Hause wieder zu Elija zurückzukehren. Das Schlachten der Ochsen und das Verteilen des Fleisches (V. 21) deuten auf ein Fest hin. Eine Verzichtserklärung, ein Vorwurf und eine wörtlich gemeinte Frage zur Amtseinsetzung passen nicht in eine solche Szenerie. Demnach erlaubt Elija es Elischa, sich von seinem Vater zu verabschieden, weil dieser ein neues Leben als Assistent und eines Tages auch als sein Nachfolger beginnen wird. Die Textpassage markiert den Beginn der Elischa-Geschichten und den Anfang vom Ende Elijas.