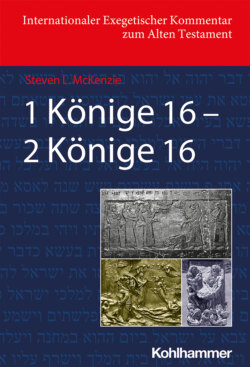Читать книгу 1 Könige 16 - 2 Könige 16 - Steve McKenzie - Страница 55
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Diachrone Analyse
ОглавлениеDie Spannungen zwischen den drei Teilen dieses Kapitels (Vv. 1–16, 17–40, 41–46) geben Hinweise auf deren unterschiedliche Ursprünge. Doch es gibt auch Belege für deutliche Verknüpfungen, die dafür sprechen, dass das Kapitel in seiner jetzigen Form auf einen einzigen Verfasser bzw. Redaktor zurückgeht.
18,1–16: Die Prophetenlegende Die Episode von Vv. 1–16* ist in den Kapiteln 17–18 die einzige, zu der die Dürre von Anfang an dazugehört. Die Dürre ist das Subjekt des Nominalsatzes in V. 2b, das den Anfang der zugrundeliegenden Geschichte markiert. In dieser Geschichte stand auch schon, dass Ahab Obadja herbeordert (V. 3a) und beide einen Streifzug durch das Land unternehmen, auf dem Obadja Elija begegnet (Vv. 5–8). Die Vorstellung, dass der König höchstpersönlich das Land nach brauchbaren Weidegründen absucht (Vv. 5–6), stellt bereits eine Herabsetzung dar. Elijas plötzliches Auftreten (V. 7) erinnert an 2 Kön 2,16–18, wo auch dessen Ursprung liegen könnte (vgl. 17,1). Seiner Eigenart entsprechend sagt Elija nichts darüber, wo er gewesen ist, doch er weist Obadja an, Ahab von seiner Anwesenheit in Kenntnis zu setzen (V. 8). In der Eingangserzählung hat Obadja genau das getan (V. 16), was dazu führte, dass Ahab auszog, um Elija zu treffen (V. 16). Diese Geschichte setzt sich dann mit Elijas Ankündigung fort, dass Ahab sein Fasten beenden könne, weil das Ende der Dürre unmittelbar bevorstehe (Vv. 41–42a). Die Quelle dieser Geschichte lässt sich nicht ausmachen. Sie könnte im Material der Elischa-Geschichte liegen, wo sich mehrere Bezüge auf Hungersnöte finden (2 Kön 4,38; 6,25; 7,4; 8,1),93 wobei hier Ahab nicht der König gewesen sein kann.
Die Überarbeitung durch PE Die ältere Geschichte wurde von PE überarbeitet und erweitert. Die Verse 1 und 2a gehen auf PE zurück; in ihnen wird die Wortereignisformel (in invertierter Form) verwendet, mit denen die Geschichten in 17,2 und 8 begannen. Dadurch entstehen sowohl Bezüge zum Wort Jhwhs als auch zum Verborgensein Elijas – beide Motive stammen aus Kap. 17. Daneben wird in den Versen in der Anweisung Jhwhs an Elija, sich Ahab zu zeigen, das Motiv von Auftrag und Ausführung verwendet. Von den beiden Zeitangaben in V. 1 – „nach einiger Zeit“ sowie „im dritten Jahr“ – ist Letztere eine Glosse, denn ein Abschreiber hätte wohl eher eine genauere Zeitangabe hinzugesetzt als eine allgemeinere; zumal drei Jahre an anderen Stellen in 1 Könige (2,39; 10,22; 22,1) eine Zahl ist, die für eine mittellange Zeitspanne steht.94 Dass Elija der Anordnung Jhwhs (לך הראה, V. 1) nachkommt (וילך אליהו להראות, V. 2), deutet auf die Autorschaft PEs hin, was auch für Kap. 17 gilt. Der Bericht in Vv. 3b–4 darüber, dass Obadja die 100 Propheten Jhwhs beschützt, ist durch PE hinzugesetzt worden. Diese Verse bilden einen Einschub und stören die Textkontinuität zwischen V. 3a und V. 5. In den Versen wird Isebel als Ursache für Ahabs und Israels Abfall und als Gegnerin der Propheten Jhwhs – insbesondere Elijas – benannt, was zu ihrer Verunglimpfung in 16,31–33, passt und dazu, dass sie das böse Gegenstück zur Witwe von Sarepta darstellt. Auch wird Obadja hier als rechtschaffenes Gegenstück zu Ahab gezeichnet. Isebels Umgang mit den Jhwh-Propheten rechtfertigt Elijas Massaker an den Propheten Baals in V. 40.
18,9–15: Die Begegnung zwischen Elija und Obadja als Werk PEs Das Gespräch zwischen Elija und Obadja in Vv. 9–15 ist eine weitere Hinzufügung durch PE. Es erinnert an den Aufenthalt Elijas bei der Witwe (17,8–16).95 Vers 9 lässt an die Frage der Witwe über ihre Sünden in der Vergangenheit in 17,18 denken. In den Versen 10–12a werden die Motive von Elijas Verborgensein sowie plötzlichem Verschwinden und Wiederauftauchen aus Kap. 17 behandelt. In Vers 12a wird Elijas Hang zum Verschwinden betont (V. 12a), was in Obadja Furcht vor einer Vergeltung durch Ahab aufkommen lässt.96 Obadjas Behauptung, Ahab habe von allen Völkern und Königreichen verlangt, dass sie ihm einen Eid schwören, ist übertreibend. Nichtsdestoweniger finden sich in Vasallenverträgen häufig Bestimmungen, in denen die Auslieferung von Flüchtigen gefordert wird,97 so dass die Behauptung auf Ahabs internationale Stellung hindeutet. Die Vorstellung, dass der Geist Gottes eher eine Kraft ist, die einen Menschen an einen anderen Ort versetzen kann, als dass es sich um einen inspirierenden Geist handeln würde, geht auf Ezechiel zurück (siehe die synchrone Analyse) und legt für PE eine exilische (oder spätere) Datierung nahe. Die Verse 12b–14 stellen eine Wiederholung der Verse 3b–4 dar und bezeichnen erneut Isebel als die wahre Gegnerin.
Würthwein (1. Könige 17 – 2. Könige 25, 207.221–222) ist der Ansicht, dass die ursprüngliche Geschichte von V. 8 bis V. 16 reicht, wobei er die Verse 9–11+15 sowie 12b–14 und 12a als eine Reihe separater Zusätze betrachtet. Trebolle (Centena, 139–140) korrigiert Würthweins Rekonstruktion und führt ins Feld, dass die Verse12b–14a zunächst durch eine Wiederaufnahme („Nun sagst du: ‚Geh, sag deinem Gebieter, „Elija ist da“‘, doch er wird mich töten“) eingeführt wurden, bevor dann eine zweite Interpolation in V. 12a והרגני („doch er wird mich töten“) von seinem ursprünglichen Platz am Ende von V. 11 trennte, so dass auf V. 11 nun direkt V. 14b folgt. (ולא מצאך in V. 12a ist im MT eine erklärende Glosse, die in OG fehlt.) Das Hauptproblem bei der Rekonstruktion liegt in V. 15. Elijas Zusicherung, dass er sich Ahab heute zeigen wird, reagiert auf Obadjas Befürchtung in V. 12a, dass er in der Zwischenzeit verschwinden könnte. Trebolles Ansicht, wonach V. 12a eine Interpolation darstellt, geht auf Obadjas Befürchtung nicht weiter ein. Würthwein hat das Problem erkannt und V. 15 der gleichen Hand zugeschrieben wie die Verse 9–11. Doch V. 15 zählt nicht mehr zur Wiederaufnahme (הנה אליהו), die in der Sicht Würthweins dazu benutzt wurde, die Verse 9–11 anzuhängen. In diesen Fällen belegen die Wiederholungen von PE dessen Gebrauch der Wiederaufnahme als literarisches Mittel.
Obadja sorgt für (כלכל) die Propheten Jhwhs, wie die Witwe (17,9) und die Raben (17,4) für Elija gesorgt haben. Elijas Schwur in V. 15, mit dem er Obadja zusichert, dass er sich Ahab noch an jenem Tage zeigen wird, ähnelt dem Schwur, den er in 17,1 abgelegt hat („beim Leben Jhwhs, in dessen Dienst ich stehe“) und den die Witwe in 17,12 ablegt. Elija schwört bei Jhwh der Heerscharen, einem kämpferischen Titel, mit dem Jhwh als göttlicher Krieger bezeichnet wird.98 Das himmlische Heer spielt in den Elischa-Geschichten eine wichtige Rolle (2 Kön 2,12; 6,17; 13,14). In der Bearbeitung durch PE wird Obadja durch den Schwur davon überzeugt, Ahab die Nachricht zu überbringen. Der Widerspruch zwischen Jhwhs Gebot an Elija, sich Ahab zu zeigen (Vv. 1–2a), und Ahabs Hinlaufen zu Elija (V. 16 G) ist eine Folge der Hinzufügung von V. 1 durch PE.99 Dass Ahab zu Elija läuft, passt dazu, dass Elija als höherstehend dargestellt wird. PE ersetzt das Verb „gehen“ wie bei Jhwhs Aufforderung in V. 1 durch „laufen“, womit auf V. 46 vorgegriffen wird, wo Elija nach Jesreel läuft. Dass Ahab so erpicht darauf ist, Elija zu finden, deutet darauf hin, dass er sich dessen bewusst ist, dass die Dürre das Werk Elijas und Jhwhs ist, was den Wettstreit in gewisser Weise überflüssig macht.
18,17–40: Die PE-Geschichte um den Wettstreit Durch diese Verse, zu denen auch die Geschichte um den Wettstreit gehört, trennt PE die Auffindung Elijas durch Ahab von Elijas Mitteilung an Ahab, dass Regen im Anmarsch ist (Vv. 41–42a). Die Verse 17–40 lassen sich in zwei Abschnitte unterteilen: in das „Scharnier“ in Vv. 17–20 und in den eigentlichen Wettstreit in Vv. 21–40. Der erste Abschnitt wurde – mit Ausnahme von V. 18bβ (ותלך אחרי הבעלים) und den Bezug auf die Propheten der Aschera in V. 19, die Glossen sind – von PE verfasst.100 PE wurde bei der Komposition des Scharniers von der Jehu-Erzählung beeinflusst.101 Ahabs Frage an Elija (1 Kön 18,17) und Elijas Anschuldigung (1 Kön 18,18) passen zu Jehus anklagender Antwort auf Joram (2 Kön 9,22). In beiden Textpassagen wird erwähnt, dass der König nach ganz Israel Boten ausschickt und die Propheten Baals (1 Kön 18,19–20; 2 Kön 10,18–19.21) versammelt (קבץ). Der von PE eingeschobene Wettstreit auf dem Karmel (1 Kön 18,21–40) passt zur Zerschlagung des Baals-Kultes durch Jehu (2 Kön 10,18–28). Das Vorbild der Jehu-Geschichte erklärt auch den Schluss in 1 Kön 18,40, wo Elija alle 450 Propheten Baals niedermetzelt.
Die Akteure der Geschichte Im Hintergrund der Diskussion zwischen Elija und Ahab in Vv. 17–18, wer Israel Kummer bereitet, steht die Dürre, die dann aber – ebenso wie Ahab und Obadja – aus der Erzählung um den Wettstreit verschwindet. Ahab spielt in den Versen 17–20 nur übergangsweise eine Rolle, als er den Wettstreit mit vorbereitet. Die Spannung zwischen der gegenseitigen Abneigung zwischen Elija und Ahab in Vv. 17–18 und ihrer Kooperation in Vv. 19–20 gehört ebenfalls zur Überleitung.102 Ahabs Beschimpfungen und Elijas Konter (V. 18) spiegeln die Abneigung PEs gegenüber Ahab und seinem Haus. Dessen Abfall (Jhwh verlassen) ist das wichtigste Vergehen und der Grund für den Wettstreit, durch den der wahre Gott ermittelt werden soll. Durch das Zusammenrufen von ganz Israel wird die Geschichte um den Wettstreit zu einer öffentlichen Zurschaustellung. Höchstwahrscheinlich ist dies übertreibend zu verstehen, auch wenn es möglich wäre, dass an irgendeine Art von Volksvertretung gedacht ist. Ebenso werden die Propheten Baals herbeordert. Sie gehören zu Isebel. Wie in früheren PE-Texten ist sie diejenige, die Schuld hat am Abfall Israels. Die Irritation in V. 20 – Ahab lässt seine Boten ins ganze Land Israel aussenden, nur um die Propheten zu versammeln – wird textkritisch aufgelöst (siehe die Anmerkung). Die Existenz solcher Propheten wird durch die Zakkur-Inschrift belegt, in der von Sehern (ḥzyn) und Wahrsagern (‛ddn) des Baal-Schamem (COS 2,35; KAI 2,202) die Rede ist. Allerdings sind es normalerweile Priester, die kultische Handlungen ausführen, und nicht Propheten, und in 2 Kön 10,19; 11,18 ist von den Priestern Baals die Rede, woraus sich schließen lässt, dass sie unterschiedliche Aufgaben hatten. In 1 Könige 18 werden die aus 2 Könige 10 entlehnten Priester und Propheten von PE zu einer einzigen Gruppe zusammengefasst, damit Elijas Konkurrenten sich auf der gleichen Stufe befinden wie er und damit gezeigt werden kann, dass die Reaktion Gottes nicht an den Beruf der Bittsteller geknüpft ist.
Der Baal der Erzählung Wer genau der Baal ist, der hier erwähnt wird, ist Gegenstand eingehender Diskussionen gewesen. Zu den Vorschlägen zählen Lokalgottheiten wie der Baal vom Karmel,103 Baal-Schamem,104 der aramäische Baal-Hadad oder Hadad Rimmon105 oder aber Melqart von Tyrus.106 Die Frage ist in gewisser Weise obsolet, weil der Titel „Baal“, also „Herr, Gebieter“, und der Name Baal jede dieser Gottheiten bezeichnen kann und der Verfasser sie vermutlich in einen Topf geworfen hat, weil sie ausländisch und Gegner Jhwhs sind (vergleiche die „Baale“ in der Hinzufügung in V. 18bβ). Auch könnte es während des Überarbeitungsprozesses der ursprünglichen Tradition Veränderungen bezüglich der Identität Baals gegeben haben.107 Welchem Land Baal zuzuordnen ist, wird in der Erzählung nicht gesagt, doch es wird angedeutet, dass er phönizisch war, vor allem in Anbetracht von 16,31–33. Zumindest bis zum ersten Jahrtausend waren Baal und Hadad unterschiedliche phönizische/kanaanäische beziehungsweise aramäische Gottheiten,108 weshalb hier nicht an Hadad gedacht sein kann. Auch die Ineinssetzung mit Melqart ist unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass (1) Baal bis ins zweite Jahrhundert v. Chr. kein Epitheton Melqarts war, (2) die Wettergott-Attribute Baals nicht zu Melqart passen, und (3) Melqart später eher mit Herakles als mit Zeus gleichgesetzt wurde.109 Der Baal von 1 Könige 18 ist deshalb höchstwahrscheinlich der Wettergott der ugaritischen und phönizischen mythologischen Texte,110 wenn er auch in gewisser Weise für alle ausländischen Gottheiten steht, die der Verfasser für machtlos hält oder deren Existenz er gar bestreitet.
18,21–24: Der Anfang der ursprünglichen Geschichte um den Wettstreit Ursprünglich war die Geschichte um den Wettstreit unabhängig; in ihr ging es um ein Kräftemessen zwischen Elija und dem Volk darüber, welcher Gott – Jhwh oder Baal – der wahre sei.111 Die Geschichte beginnt damit, dass Elija das Problem der Unschlüssigkeit des Volkes mit einem Aphorismus aufwirft (V. 21). Unter „nachlaufen“ ist hier die kultische Verehrung zu verstehen. Es findet sich häufig – aber nicht nur – in deuteronomistischen Texten und stammt ursprünglich aus vorexilischer Zeit.112 Zwar ist die genaue Bedeutung unklar, doch der Sinn ist deutlich: Das Volk ist zwischen Jhwh und Baal hin- und hergerissen, doch es ist an der Zeit, sich zwischen ihnen zu entscheiden. In der zugrunde liegenden Geschichte waren manche Menschen glühende Anhänger Baals, während andere zuschauten und sich vielleicht eher zu Jhwh hielten, darin aber bestärkt werden mussten. In der älteren Geschichte kamen weder Ahab noch die Dürre vor, noch fand sie auf dem Karmel statt,113 und die Propheten Baals kamen darin auch nicht vor. Elija hat zum Volk gesprochen (V. 22aα). Seine Behauptung im restlichen V. 22, der einzige Prophet Jhwhs zu sein, ist eine Hinzufügung von PE, die mit Vv. 3b–4.12b–14 übereinstimmt, wonach die anderen Propheten Jhwhs entweder tot sind oder sich versteckt halten. In Vers 23aβb wird das von PE überarbeitete Szenario vorausgesetzt, in dem sich Elija und die Propheten Baals gegenüberstehen und dem Volk die Rolle des Publikums zukommt.114 Die Anrufung des Namens einer Gottheit (V. 24) besitzt eine zweifache Bedeutung: Sie ist sowohl eine kultische Handlung als auch ein Ausdruck religiöser Zugehörigkeit.115 Bei dieser Zurschaustellung haben die Opfer für sich genommen keine Bedeutung; sie dienen lediglich dazu, die Reaktion der Gottheit (wie z. B. Feuer) anzuzeigen, die den Beweis liefert, dass es sich um einen wahren Gott (האלהים) handelt.116
18,25–26: Baals Machtlosigkeit In Vers 25 ist davon die Rede, dass die Propheten Baals ihr Opfer als erste vorbereiten. Dieser Vers stammt von PE, doch das Scheitern der Baals-Anhänger in Vv. 26–29abα* geht auf die ältere Geschichte zurück. Die Darstellung der um den Altar herumhüpfenden117 Baals-Propheten (V. 26b) stellt eine Hinzufügung des MT dar (siehe die Anmerkung). Am wichtigsten ist in V. 26 die Aussage, dass da keine Stimme war und niemand antwortete (ואין קול ואין ענה), was an die Passage im bereits genannten Aqhat-Epos erinnert: bl ṭbn.ql.b‛l, „keine angenehme Stimme Baals“.118 Das Verschwinden Baals in die Unterwelt und dessen verheerende Folgen für die Natur und die Menschen werden im ugaritischen Baal-Zyklus geschildert. Die ältere Geschichte könnte auf diese Tradition angespielt haben und sie dem Glauben an Jhwhs Beständigkeit und Zugänglichkeit gegenübergestellt haben. In der von PE bearbeiteten Version wird Ball allerdings als machtlos und sogar nicht existierend vorgestellt; dies ähnelt der Sichtweise Deuterojesajas (40,19–20; 41,6–7; 44,9–20; 46,5–8) auf die Götzen.119
18,27: Die Verspottung durch Elija Im Gegensatz zu MT (V. 27) wartet Elija nicht bis zum Nachmittag, um seine Gegner zu verspotten, sondern beginnt damit, sobald ihr Schreien keine Reaktion hervorzurufen vermag. Die Verspottung durch Elija gehörte zur ursprünglichen Geschichte. Bei der hier vorgeschlagenen Deutung der Worte Elijas gehe ich davon aus, dass (1) התל, ein Hapaxlegomenon, die Konnotation von Täuschung und auch Spott trägt, und zwar weil Elija Szenarien vorschlägt, die auf den Mythen kanaanäischer Götter beruhen und Baals fehlende Aufmerksamkeit und Antwort erklären könnten, und dass (2) textkritisch nur zwei Handlungen Baals feststehen, während es im MT vier sind. Diese vier sind שיח:, was meist als Nachsinnen verstanden wird, שיג, was häufig für Rückzug oder Verhinderung steht, דרך, eine Reise, sowie ישׁן, Schlaf. Die Erwähnung einer Reise, die sich nur im MT findet, ist sekundär. שיח ist eine Glosse zu שיג (siehe die Anmerkung), das sich nicht auf Rückzug oder Verhinderung bezieht, sondern auf die Körperfunktionen von Stuhlgang bzw. Wasserlassen. Derlei Aktivitäten werden auch den Göttern Ugarits zugeschrieben,120 und in der HB wird von Jhwhs Schlafen berichtet (Jes 51,9; Ps 44,24; 59,5; 78,65). Dass der Schlaf eine Metapher für den Tod sein kann (Dan 12,2), stellt eine weitere Bedeutungsnuance von Elijas Vorschlag dar. Elijas Doppelzüngigkeit wurzelt in der Verbindung mythischer und höchst menschlicher Tätigkeiten; in spöttischer Weise schlägt er vor, was die Baals-Priester für tatsächliche Aktivität der Götter halten könnten.
18,28–29: Das Handeln der Baals-Propheten Das selbstverletzende Ritzen (V. 28) als kultische Praxis wird in einem akkadischen Text aus Ugarit als typisches Verhalten ekstatischer Propheten genannt: „Meine Brüder sind von ihrem eigenen Blut durchtränkt wie Ekstatiker“.121 Auch in Kontexten der rituellen Klage ist es inner- und außerhalb der Bibel anzutreffen. Dazu zählt auch die Klage über Baals Verschwinden in die Unterwelt im Baal-Epos, worauf es hier wohl rekurriert.122 Die Baals-Verehrer sind kein Kultpersonal, das ein Ritual inszenieren würde, sondern sie betrauern Baals Verschwinden und hoffen vermutlich, seine Rückkehr zu bewirken.123 In ähnlicher Weise ist in V. 29 das ekstatische Verhalten, die „Raserei“ (Hitpael von נבא), auch wenn sie an anderen Stellen in der Bibel bei Propheten belegt ist (Num 11,25–27; 1 Sam 10,5–13; 18,10; Jer 29,26), nicht auf diese beschränkt (1 Sam 19,20–24), und sie kann sogar zur Bezeichnung von irrationalem Verhalten verwendet werden (1 Sam 18,10).124
18,29: Zeit und Art des Abendopfers Das Abendopfer (עלות המנחה) fand „zwischen den Abenden“ statt (Ex 29,39; Num 28,4), also zwischen Dämmerung und völliger Dunkelheit.125 Die späte Stunde ließe keine Zeit für die in den folgenden Versen geschilderten Ereignisse, doch die Verse 40–46 gehörten nicht zur älteren Geschichte um den Wettstreit. Elija ist an der Reihe, als die Sonne zu sinken beginnt. In der Königszeit war es üblich, dass morgens ein Tier als Brandopfer (עלה) und am Abend ein Speiseopfer (מנחה) gebracht wurde (vgl. 2 Kön 16,15), während zwei tägliche Brandopfer am Morgen und am Abend eine späte und priesterliche Tradition sind (Ex 29,38–42; Num 28,2–8).126 Der Wechsel hat sich in der Exils- oder frühen Nachexilszeit vollzogen.127 Allerdings kann der Begriff מנחה auch ganz allgemein „Opfer“ bedeuten, ohne dass er dezidiert auf ein Speiseopfer abheben würde.128 In 2 Kön 3,20 wird מנחה zur Bezeichnung des Morgenopfers verwendet. Es wäre also möglich, dass מנחה auch das Brandopfer umfasst. Dann wäre es besonders angemessen, dass Elija zu dieser Zeit einen Stier als Opfer bringt. Doch es ist ebenso möglich, dass die Verweise auf die Opfer sowohl in 1 Kön 18,29 als auch in 2 Kön 3,20 nur Zeitangaben sind und die Opfermaterie dabei nicht bezeichnet ist.129 Kurz gesagt liefert die Erwähnung des Abendopfers in V. 29 keinen schlüssigen Hinweis darauf, wann die Abfassung von 1 Könige 18 anzusetzen ist.
18,30: Der Altar Jhwhs Mit Vers 30 wird die dritte und letzte Szene der Geschichte um den Wettstreit eingeleitet. Elija ruft das Volk zu sich heran. Die Baals-Verehrer sind gescheitert; nun ist Elija an der Reihe. In der Version von PE werden die Propheten Baals, die zuvor am Wettstreit teilgenommen haben, nun zu Zuschauern. Vers 30b, in dem Elija einen älteren Altar für Jhwh wiederaufbaut, steht im Widerspruch zu Vv. 31–32a, wo er einen neuen errichtet. Gelegentlich ist davon die Rede, dass die Version mit dem „Wiederaufbau“ eine mit dem deuteronomischen Prinzip der Kultzentralisation in Einklang stehende Korrektur sei. Dadurch ergäbe sich eine Geschichte, in der Elija keinen neuen Altar baute, sondern einen älteren zur vorübergehenden Benutzung wiederaufgebaut habe.130 In anderer Sicht erscheint die „Wiederaufbau“-Version als das Original, was nahelegen würde, dass Vv. 31–32a eine Korrektur der Vorstellung wäre, dass ein Altar jenseits Jerusalems existiert habe, insofern Elija einen neuen Altar baut, der fast sogleich wieder zerstört wird (V. 38).131 Die textkritischen Hinweise zeigen, dass die Verse 31–32a eine Interpolation darstellen (siehe Anmerkung), wodurch die letztgenannte Position bestätigt wird. Dem älteren Text und der älteren Geschichte zufolge hat Elija eher einen Altar Jhwhs wiederaufgebaut, als dass er einen neuen erbaut hätte.132 Dass dort ein Altar stand, stützt nicht die These vom Wiederaufbau eines älteren hieros logos, da in der Geschichte nicht der Standort des Altars hervorgehoben wird. Vielmehr wird dadurch veranschaulicht, wie beklagenswert die Lage der Jhwh-Verehrung war. Weil der ältere Altar zuvor nirgends erwähnt wurde und davon ausgegangen werden kann, dass es einen dauerhaften Altar für Baal gab (V. 26), ist es unwahrscheinlich, dass der Altar während der Rituale der Baals-Propheten zerstört wurde;133 dies war bereits vorher geschehen.134 Dass hier ein Altar für Jhwh jenseits von Jerusalem als legitim angesehen wird, bietet einen deutlichen Hinweis auf einen Ursprung der älteren Geschichte vor DtrH. Zudem setzt PE keine weiteren Details hinzu. Wenn die Rekonstruktion von V. 38 zutreffend ist, wird der wiederaufgebaute Altar nicht durch das Feuer vom Himmel zerstört. Selbst in der überarbeiteten Version ist die Geschichte also nicht an der Kultzentralisation oder an priesterlichen Bestimmungen darüber interessiert, was kultisch angemessen sein könnte. Darin zeigt sich eine prophetische Ausrichtung. Das Interesse und der Fokus der Geschichte liegen auf dem Gottesmann und seiner Demonstration der Überlegenheit Jhwhs über andere Gottheiten, wenn nicht sogar der Ausschließlichkeit Jhwhs.
Die Hinzufügungen in 18,31–32a.35b Die zwölf Steine in der Interpolation von Vv. 31–32a – welche die zwölf Stämme repräsentieren – erinnern an die von Mose (Ex 24,4) und Josua (Jos 4,20) erbauten Altäre und stehen für die Einheit Israels als Jhwhs Volk, doch sie passen kaum zu einer Geschichte, die im Norden des (geteilten) Reiches angesiedelt ist. Mit dem Hinweis darauf, dass Jhwh den Namen Jakob in Israel änderte (V. 31b), wird Gen 35,10 (P) aufgegriffen.135 Diese diversen Parallelen lassen ein priesterliches Interesse an der Heiligkeit eines wiederaufgebauten Altars erkennen (vgl. 1 Makk 4,44–47), der durch das Feuer vom Himmel seine Bestätigung erfährt (Lev 9,24; 1 Chr 21,26; 2 Chr 7,3). Auch der Graben in V. 32b deutet auf priesterliche Anliegen hin. Er hat ein Fassungsvermögen von zwei Sea Saat (V. 32b). Wenn es sich dabei um die Aufnahmefähigkeit des Grabens an sich handeln sollte, dann konnte er nur zwischen 10 und 30 Liter Wasser fassen.136 Wahrscheinlicher ist deshalb, dass diese Angabe sich auf das Gebiet bezieht, das mit zwei Sea Saat als heiliger Bezirk um den Altar herum bepflanzt werden konnte.137 Dem Talmud zufolge (Eruvin 23b) war dies die Größe des Bezirks um die Stiftshütte, nämlich 100 x 50 Ellen. Auch in der Sorge um die Begrenzung des heiligen Bezirks spiegelt sich ein priesterliches Interesse, was darauf hindeutet, dass in V. 32b eine Hinzufügung vorliegt. Wegen des Beginns mit וגם wird auch an der Ursprünglichkeit von Vers 35b gezweifelt; der Versteil scheint eine noch spätere Deutung des Grabens zu bieten, der zufolge dieser vor allem das Abfließen des Wassers verhindert.138
Sinn und Zweck des Wassers Diskutiert wird daneben auch der Zweck des Wassers. Es werden mindestens fünf verschiedene Vorschläge präsentiert: (1) Es gewährleistet, dass Elija nicht betrügt;139 (2) das Wunder erscheint noch spektakulärer;140 (3) es dient zur rituellen Reinigung des Opfers (Lev 1,9.13);141 (4) es geht um eine Libation;142 und (5) es handelt sich um rituelle Magie zum Heraufbeschwören des Regens.143 Die dritte Möglichkeit kann ausgeschlossen werden: Elijas Anordnung, Wasser zu „gießen“ (יצק), deckt sich nicht mit der Anweisung in Levitikus, zu „waschen“ (רחץ). Daneben wird in Levitikus nicht das gesamte Opfer gewaschen, und das geschieht auch nicht auf dem Altar, sondern nur die Eingeweide und die Beine, die nicht auf den Altar gelegt werden. Darüber hinaus wäre es nicht nötig, es dreimal zu tun. Insgesamt entspricht die Anzahl der mit Wasser gefüllten Krüge (4 x 3 = 12) der Anzahl der zum Bau des Altars verwendeten Steine, was für die Deutung als Libation sprechen könnte,144 doch hierdurch lässt sich nicht erklären, warum sich der Text mit dem Wasser befasst oder warum es auf das Opfer gegossen wird. Interessant ist die fünfte Option, weil der Fokus in den Prophetengeschichten auf Handlungen ritueller Magie liegt, was dafür spricht, dass die ältere Wettstreit-Geschichte der Gattung der Prophetenlegende zuzuordnen ist. PE hat vielleicht den tieferen Sinn des Wasserrituals nicht verstanden; immerhin aber hat PE die Verse 41–46* hinzugefügt, in denen Elija noch einmal eigens den Regen heraufbeschwört. In PE wird Elijas Übergießen des Opfers im Rahmen der ersten beiden Möglichkeiten gedeutet, die sich miteinander verknüpfen lassen: Durch das Wasser wird vor Augen geführt, dass Elija „kein Ass aus dem Ärmel zieht“, dass das Opfer nicht zufällig entzündet wird und dass das Feuer, das herabkommt und sogar das Wasser aufleckt, nicht menschlichen Ursprungs ist. In Elijas fast verschwenderischem Umgang mit dem reichlich vorhandenen Wasser zeigt sich, dass die ältere Geschichte keine Dürre vorausgesetzt hat; das Herbeirufen von Regen würde auch Blitz und Donner mit sich bringen.
18,36–37: Die PE-Version von Elijas Ansuchen In der ursprünglichen Geschichte wird durch Elijas Anrufung (Jhwh, antworte mir heute mit Feuer, dass du, Jhwh, Gott bist in Israel) betont, dass Jhwh das Land Israel unter seiner Obhut hat, worum es im Kern auch beim Wettstreit geht.145 In der Überarbeitung von PE wirkt das Gebet (Vv. 36–37) im Gegensatz zu den aufwendigen Handlungen der Anhänger Baals recht schlicht. Der Verweis auf Abraham, Isaak und Israel in V. 36 gehört zu einer Interpolation durch Wiederaufnahme (des Gottesnamens). Das Epitheton Gott Abrahams, Isaaks und Israels ist, im Unterschied zum gängigeren „Abrahams, Isaaks und Jakobs“, eine späte Formulierung (1 Chr 29,18; 2 Chr 30,6; vgl. Ex 32,13). Die Erkenntnisformel kommt in DtrH vor, aber auch bei Ezechiel, Deuterojesaja und P; sie wurde von PE hinzugesetzt.146 Die passive Version in V. 36 MT (יִוָּדַע, „lass verlauten“, vgl. Dtn 4,39) ist jünger als das aktive „damit dieses Volk erkennen kann, dass du Gott bist“ in OG und in V. 37 MT.147 Der Bezug auf Elija als Diener Jhwhs in der ersten Person, der all dies durch Jhwhs Wort getan hat, unterbricht die Reihe von Formen in der zweiten Person (du bist Gott und du hast umgewendet) und ist eine Hinzufügung, durch die Elijas Worte und Handlungen mit denen Jhwhs gleichgesetzt werden.148 Der kryptische Kommentar am Ende von Elijas Bitte – das Volk möge erkennen, dass es Jhwh gewesen ist, der „ihre Herzen umgewendet hat“ –, scheint zu bedeuten, dass Jhwh selbst Israel hat rückfällig werden lassen, wodurch er die Möglichkeit bekam, seine Macht zu erweisen und Baal die entscheidende Niederlage zuzufügen (siehe in der synchronen Analyse).
18,38–40: Feuer vom Himmel Auf Elijas Gebet folgt eine sofortige Reaktion. Feuer (Blitz) fällt vom Himmel (V. 38). Während das Motiv sonst signalisiert, dass ein Altar von einer Gottheit akzeptiert und geheiligt wird (Lev 9,24; 1 Chr 21,26; 2 Chr 7,1), erfährt damit an dieser Stelle Elijas Behauptung eine Bestätigung, dass Jhwh der wahre Gott ist. Indem sich Jhwh hier des Blitzes bedient, der Waffe des Wettergottes, wird deutlich, dass er und nicht Baal die Herrschaft über Gewitter und Fruchtbarkeit besitzt. Der Blitz geht meist dem Regen voraus149 und bietet die perfekte Gelegenheit, die Dürre zu beenden, auch wenn dieses Ende erst kommt, nachdem Elija sein Ritual auf dem Karmel durchgeführt hat (Vv. 41–46). Zwischen den beiden Vorgängen ist der Himmel wolkenlos; das liegt daran, dass die ältere Geschichte keine Dürre voraussetzt, und dass Elija bei PE ein besonderes Ritual vollziehen muss, damit der Regen kommt. Durch das Feuer werden zuerst das Holz und das Opfer verbrannt, und dann wird auch das Wasser um sie herum und auf ihnen aufgeleckt. Als Reaktion darauf wirft sich das Volk vor Jhwh und Elija nieder und bekennt, dass Jhwh Gott (האלהים) ist. Die Wiederholung entspricht Elijas wiederholtem Ruf nach einer Antwort in der Bearbeitung von PE. In der ursprünglichen Geschichte wird Baal ausgeklammert, doch PE gibt der Geschichte eine monotheistische Deutung. Der siegreiche Elija fordert das Volk auf, alle Baals-Propheten zu ergreifen (V. 40). Er bringt sie ins Wadi Kischon und bringt sie alle um. Dies ist eine Hinzufügung durch PE. Deren Ausgangspunkt ist die Behandlung der Jhwh-Propheten durch Isebel in Vv. 3b–4.12b–14. Zugleich wird hier Jehus Massaker an den Baals-Verehrern in 2 Kön 10,18–28 vorweggenommen, auf dem die Hinzufügung beruht. Elijas Aufforderung ähnelt der Jehus (2 Kön 10,24).
18,41–46: Elija bringt Regen Der letzte Teil des Kapitels basiert auf einer Prophetenlegende, die sich von den Vorlagen der beiden vorherigen Abschnitte unterscheidet. Sie ist in Vv. 42b–44a.45a erhalten. In ihr wird ein Akt symbolischer Magie geschildert, bei dem ein heiliger Mann sich mit dem Kopf zwischen den Knien niederkauert, was eine Wolke darstellen soll, um den Regen herbeizurufen. Sein Diener hält wiederholt Ausschau nach Anzeichen für ein Gewitter, und bei seinem siebten Gang entdeckt er eine kleine Wolke, die sehr bald zu sintflutartigem Gewitterregen führt. Wie es für die Ausgangsversion der Prophetenlegende typisch ist, findet sich kein Hinweis auf ein Gebet oder ein Handeln Jhwhs. Dabei besteht eine gewisse Nähe zu verschiedenen Stoffen hinter der Figur Elischas, zu denen sie auch gehört haben könnte: Meist wird Elischa von einem Diener begleitet, während Elija nur hier und in 19,3 nicht allein ist; die Vorahnung, die Elija hier hat, ist eigentlich ein Charakteristikum Elischas (2 Kön 5,26; 6,12.32); das Verb גהר kommt sonst in der HB nur in der Elischa-Legende in 2 Kön 4,34–35 vor; das siebenmalige Hinaufgehen des Dieners, um nach Wolken Ausschau zu halten, entsprechen dem siebenfachen Niesen des Jungen, den Elischa wieder zum Leben erweckt hat, und auch Naamans siebenmaligem Untertauchen im Jordan (2 Kön 5,10.14); der Karmel ist einer der Orte, an denen Elischa zuhause ist (2 Kön 2,25; 4,25).
Die Legende und die Überarbeitung durch PE PE hat dieser Legende mit Vv. 41–42a eine Vorbemerkung über das Ende der Dürre-Episode vorangestellt, die bei ihm als Erfüllung der Ankündigung des Regens durch Elija in 17,1 fungiert. Dadurch lässt sich erklären, dass in beiden Texten unterschiedliche Worte für Regen verwendet werden, nämlich מטר in 17,1 und גשם in 18,41. Elijas Rat an Ahab, hinaufzugehen (V. 41), erweckt den Eindruck, dass dieser sich im Wadi Kischon aufgehalten und dem Massaker an den Propheten Baals beigewohnt hat, ohne einzugreifen. Aus der Anweisung zu essen und zu trinken lässt sich schließen, dass er während der Dürre gefastet hat.150 In Elijas Warnung vor dem aufziehenden Regen zeigt sich, dass er Dinge vorausahnen kann, doch hierdurch entsteht eine Spannung zur Legende in Vv. 42b–44a.45a: Elija hört das Geräusch des Regens (V. 41), bevor das Ritual ausgeführt ist, das ihn bringen soll (Vv. 42b–44a); Ahab geht hinauf, um zu essen und zu trinken und so sein Fasten zu brechen (V. 42a), bevor es irgendein Hinweis auf den Regen gäbe (Vv. 43–44); und Elija kündigt den kommenden Regen zweimal an (V. 41 und V. 44b). Weitere Spannungen zur Geschichte um den Wettstreit sind etwa die Rückkehr Ahabs; dass Elija freundlich zu ihm ist; und dass ein bisher unbekannter Diener zugegen ist. Daneben verschiebt sich auch der Zeitpunkt: In der Geschichte um den Wettstreit herrscht bereits Dämmerung, hier jedoch ist helllichter Tag.
18,44–46: Der Abschluss von PE PE hat die Verse 44b.45b–46 hinzugefügt, damit Elija sich nach Jesreel bewegen kann, wo sich Isebel aufhält (21,1–16.23; 2 Kön 9,30–37); dies stellt ein Bindeglied zu 19,1–3 dar.151 In einem abschließenden Wunder kann Elija den Streitwagen Ahabs auf der etwa fünfunddreißig Kilometer langen Strecke vom Karmel nach Jesreel einholen, weil die Hand Jhwhs auf ihm ist. Dieser Ausdruck kommt in den Elija-Geschichten nur an dieser Stelle vor. In 2 Kön 3,15 findet er sich mit Bezug darauf, dass prophetische Ekstase über Elischa kommt. Doch in der hier betrachteten Textpassage ähnelt die Verwendung eher der Vorstellung und dem Ausdruck bei Ezechiel (1,3; 3,22; 33,22; 37,1; 40,1), mit dem „ungewöhnliche Sinneseindrücke“ bezeichnet werden.152 Die Aufforderung an Ahab, seinen Streitwagen anzuspannen und hinunterzufahren, ist in V. 44b unnötig, nachdem Ahab bereits in V. 42a gewarnt worden war. Auch wird hierdurch der Zusammenhang der Erzählung über die Wolke in V. 44a und der über den Regen in V. 45a gestört.