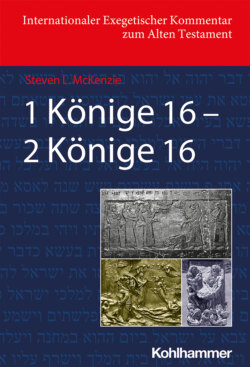Читать книгу 1 Könige 16 - 2 Könige 16 - Steve McKenzie - Страница 53
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Synchrone Analyse
ОглавлениеDie anhaltende Dürre Die Wortereignisformel in 18,1 markiert den Beginn einer neuen Episode, die gleichwohl eine literarische Fortsetzung von Kap. 17 ist. Das wird durch nach einiger Zeit (ויהי ימים רבים) verstärkt, das zur invertierten Form der Wortereignisformel (mit voranstehendem Subjekt) hinführt. Die von Elija in 17,1 angekündigte Dürre hat „viele Tage“ angehalten, was sich auf „drei Jahre“ beläuft. Der doppelte Zeitbezug vermittelt den Eindruck, dass sie sich in die Länge gezogen und die Geduld der unter ihr Leidenden sehr strapaziert hat. In der Erzählung werden nur die Ereignisse zu Beginn (Kap. 17) und am Ende (Kap. 18) der Dürre geschildert, die dadurch das Oberthema bildet, das beide Kapitel verbindet. In zentraler Position befindet sich 18,1; Jhwhs Ankündigung, Regen zu schicken, bedeutet ein Ende der Dürre. Das Wort für Regen – מטר – ist das gleiche wie in 17,1. Wie in 17,2–7 hat Jhwh die Kontrolle über die Schöpfung. Er übt sie zur Unterweisung und Disziplinierung Israels aus, das sein Vertrauen unter der Ägide Ahabs und Isebels in einen machtlosen Gott gesetzt hat, nämlich Baal. Das wird durch die Dürre vor Augen geführt. Ihr dramatischer Abschluss macht dies mehr als deutlich. Die Ankündigung in 18,1 ergeht durch das Wort Jhwhs, das als Thema aus Kap. 17 fortgeführt wird. Ihr Inhalt – dass also nun die Zeit gekommen ist, dass Jhwh es wieder regnen lassen wird – unterstreicht die Botschaft des letzten Kapitels, dass das Wort Elijas (17,1) das Wort Jhwhs ist. Ebenso wird das Motiv von Auftrag und Ausführung weitergeführt, wenn Jhwh Elija anweist, sich Ahab zu zeigen und der Prophet sich sofort anschickt, das zu tun (V. 2). Elijas Untertauchen von 17,3 endet damit, dass er nach Israel zurückkehrt, um Ahab zu suchen, der nach ihm gesucht hat.
18,1–2: Elija verlässt sein Versteck Die drei Episoden von Kap. 18 – das Auffinden Ahabs (Vv. 1–18), die entscheidende Niederlage Baals (Vv. 17–40) sowie das Ende der Dürre (Vv. 41–46) – sind nicht so klar durch Markierungen wie die Wortereignisformel voneinander abgegrenzt wie die Episoden in Kap. 17. Vielmehr gehen sie im Text ineinander über. In 18,1 wird in die erste Episode eingeführt, wenn Elija aufbricht, um von Ahab „gesehen zu werden“ (להראות). Durch die Begegnung mit Obadja (Vv. 2b–16) erfahren die Lesenden, wie verzweifelt Ahab nach Elija sucht, und sie dient zu Vorbereitung des Wiedersehens der beiden. Durch die Notiz über die Schwere der Hungersnot in Samaria (V. 2b) wird Ahabs Furcht erklärt. Die Folgen der Dürre haben die Hauptstadt erreicht. Doch Elija erscheint vor Ahab nicht als dessen Untertan; ihre Rollen sind nun vertauscht. Ahab ersucht um eine Audienz bei Elija, und Jhwh legt den Zeitplan fest. Als Jhwhs Stellvertreter ist Elija höheren Ranges als Ahab. Elija gestattet dem König, ihn zu treffen, weil Jhwh es befiehlt.
18,3–4: Obadja Als Vorsteher „über das Haus“ ist Obadja unter anderem für die Verwaltung der königlichen Güter zuständig, so dass plausibel ist, warum er gerade jetzt auftritt (V. 3). Der Eindruck, den er hinterlässt, ist zwiespältig. Bei seinem Namen schwingt mit, dass er ein „Diener Jhwhs“ ist, obwohl er seine Anweisungen von Ahab empfängt. Wie kann er beiden dienen? Die Figur lässt damit das Hin- und Hergerissensein Israels zwischen zwei Religionen erahnen (V. 21). Im weiteren Fortgang der Erzählung wird den Lesenden versichert, dass Obadja ein großer Verehrer Jhwhs ist. Er hat sich um die Propheten Jhwhs gekümmert, die Isebel zu töten versucht hat (V. 4). Damit hat Obadja seine Stellung und sein Leben aufs Spiel gesetzt. Deshalb ist Obadja ein mutiger Mann. Die unbemerkte Versorgung von hundert Propheten erfordert große Vorsicht, und diese Vorsicht lässt Obadja davor zurückscheuen, Ahab die Nachricht von der Rückkehr Elijas zu überbringen (Vv. 9–15). Obadjas Versorgung der Propheten kann sich an den Geschichten von Kap. 17 messen lassen – an der Versorgung Elijas durch die Raben (17,4) und die Witwe von Sarepta, die Gleiches tut (17,9) –, wobei in allen drei Geschichten das gleiche Verb (כול Pilpel) verwendet wird. „Die Höhle“, in der Obadja die Propheten versteckt hat, nimmt Elijas Zuflucht in „der Höhle“ in 19,9 vorweg.
18,5–6: Suche nach Weideland Wenn die Nahrung für die Menschen knapp ist, ist sie es auch für die Tiere, und diese würden der Dürre als erste zum Opfer fallen, wenn sich für sie kein Futter finden ließe (V. 5). Die Tiere, um die es hier geht, sind Pferde und Maultiere. Das waren die Reittiere des Königs, aber wohl auch Tiere, die für militärische Zwecke ausgebildet worden waren. Ihr Verlust wäre gleichbedeutend mit einer Schwächung der Verteidigung. Dass der König und sein Verwalter selbst nach brauchbaren Weidegründen Ausschau halten (V. 6), zeigt den Ernst der Lage. Nur selten ist in der HB die Rede davon, dass zwei Charaktere in entgegengesetzte Richtung ausziehen (vgl. Gen 13,9–11). In räumlicher Weise wird hier zum Ausdruck gebracht, dass Ahab und Obadja auf verschiedenen Seiten stehen und in verschiedene theologische Richtungen gehen.51
Drei Begegnungen Die Begegnung von Ahab und Obadja schafft die Voraussetzungen für die folgenden Begegnungen zwischen Obadja und Elija (Vv. 7–15) sowie Elija und Ahab (Vv. 17–18). Dass sich hier drei Begegnungen zwischen unterschiedlichen Paarungen dreier Erzählfiguren finden, könnte auf die literarische Konvention der Antike zurückgehen, immer nur zwei Figuren gleichzeitig in einer Szene auftreten zu lassen.52 So wird die Erzählung durch Dialoge vorangetrieben, was zugleich das Interesse der Lesenden an ihnen als Individuen steigert. Die wichtigste Begegnung ist die letzte zwischen Ahab und Elija, die zur nächsten Episode in Vv. 19–40 überleitet.
18,7–8: „Bist du es wirklich, Elija?“ Obadjas Szene mit Elija (Vv. 7–15) bildet die längste der drei Begegnungen. Die Worte, mit denen Elijas Erscheinen vor Obadja beschrieben wird (והנה אליהו), deuten darauf hin, dass Elija quasi „aus dem Nichts“ auftaucht – so, wie er schon in den Königebüchern aufgetaucht ist (17,1). Obadja wirft sich nieder und erweist dem Propheten den gebührenden Respekt. Offen bleibt, ob er Elija persönlich kennt oder ihn anhand von Beschreibungen oder seiner Kleidung erkennt (2 Kön 1,8).53 Für einen hohen Beamten legt er ein ungewöhnlich bescheidenes und ehrerbietiges Verhalten an den Tag (vgl. 2 Kön 1,13), was wiederum für ihn spricht. Auch das Volk wird sich in 18,39 vor Jhwh niederwerfen, wodurch die beiden Vorkommen des Verbs die Geschichten von Elijas erneutem Auftreten und dem Wettstreit am Karmel rahmen. Dass sich Obadja niederwirft, deutet darauf hin, dass seine Frage (האתה זה) rhetorischer Natur ist. Andererseits schwingt in der Frage auch gehöriger Zweifel mit, weil Elija lange nicht da war und nun plötzlich wieder da ist. Man könnte es mit „Bist du es wirklich, Elija?“ wiedergeben. Ahab wird die gleiche Frage stellen, als er Elija sieht (V. 17). Elijas Antwort besteht aus einem einzigen Wort: אני, „Ich bin es“ (V. 8). Die knappe Antwort lässt vermuten, dass er niemandem traut, der Ahab in solchem Maße verbunden ist. Vielleicht liegt darin der Grund dafür, dass er nicht weiter ausführt, wo er gewesen ist. Seine Antwort klingt wie eine Rüge, die Obadjas höfliche Frage ins rechte Licht rückt: „Geh, sag deinem wahren Gebieter, dass Elija da ist“. Die beiden letzten Worte finden sich ebenfalls in V. 7 (הנה אליהו) und bilden so eine inclusio um Elijas Erscheinen. Er spricht von sich selbst in der dritten Person, um Distanz zu Obadja zu wahren. Die Wendung bedeutet sowohl „Elija ist da“ als auch „Siehe, Jhwh ist mein Gott“. Er lässt keinen Zweifel daran, auf wessen Seite er steht. Erneut scheint er Obadjas Loyalität infrage zu stellen.
18,9: Erste Eindrücke Obadjas Frage, inwiefern er gesündigt habe (V. 9), erinnert an die Frage der Witwe in 17,18. Beide fragen danach, was sie getan haben, um das Unglück auf sich zu ziehen, das Elija über sie bringen wird oder schon gebracht hat. Es ist nicht unmittelbar einsichtig, inwiefern Elijas Anordnung, Ahab von seiner Rückkehr in Kenntnis zu setzen, eine Gefahr für Obadja bedeutet. Zunächst erscheint er für Elija als jemand, der Ahab mehr fürchtet als Jhwh. Die Lesenden wissen, dass dieser Eindruck täuscht, weil Obadja sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um die Propheten Jhwhs zu retten (V. 4). Obadjas Schwur bei Jhwh, deinem Gott, lässt an die phönizische Witwe in 17,12 denken. Obadja betont Elijas Nähe zu Jhwh, doch Elija könnte es auch so verstehen, dass Obadja ein Verehrer Baals ist.
18,10–15: Obadjas Zurückhaltung Obadja beginnt mit einer längeren Erklärung, indem er anmerkt, dass Ahab Elija in allen Ländern in der Umgebung gesucht habe. Er habe die Menschen sogar Eide schwören lassen, dass sie nicht imstande waren, Elija zu finden (V. 10), was darauf hinweist, wie verzweifelt Ahab nach Elija gesucht hat. Obadja befürchtet, dass Jhwhs Geist ihm Elija wegschnappen könnte und es dann unmöglich wäre, dass Ahab Elija trifft. Dies würde Ahab erzürnen, der die Schuld dafür bei Obadja suchen und ihn töten lassen würde (Vv. 11–12). Diese Erklärung belegt, dass Elija im Ruf steht, ohne Vorwarnung zu erscheinen und zu verschwinden (17,1). In Obadjas Verständnis ist dies kein Charakterzug, für den Elija verantwortlich wäre, sondern eine Folge von dessen Verbundenheit mit Jhwh. Jhwhs entrückender Geist. Hier zeigt sich ein Verständnis des Geistes Jhwhs, das sich von dem im Richterbuch unterscheidet (6,34; 11,29; 14,6.19; vgl. 1 Sam 10,6), wo der Geist sich des Inneren eines Menschen bemächtigt und diesen Menschen zum Handeln motiviert. Im hier betrachteten Text ist der Geist eine Kraft außerhalb Elijas, die ihn entrückt.54 Diese Vorstellung findet sich sonst in den Königebüchern nur in 2 Kön 2,16 und außerhalb der Königebücher nur bei Ezechiel (2,2; 3,12.24; 8,3; 11,1; 43,5). Obadja bekräftigt seinen Protest, indem er für Elija wiederholt, was der Erzähler den Lesenden bereits mitgeteilt hat: dass er Jhwh verehrt und Propheten gerettet hat, die Isebel zu töten versucht hat (Vv. 12b–13). Er fügt hinzu, dass er Jhwh von Jugend an verehrt hat, was nahelegt, dass dies – ähnlich wie sein Name – zum Kern seiner Identität gehört. Angesichts seiner Rechtschaffenheit ist es nicht richtig von Elija, ihn in eine Situation zu bringen, in der er mit einiger Wahrscheinlichkeit sein Leben verliert (V. 14). Elija versichert ihm mit einem bei Jhwh geleisteten Schwur, dass er sich noch an eben jenem Tag Ahab zeigen wird (V. 15). Dabei verwendet er die gleiche Form des Schwures wie in 17,1, und auch die Witwe hat diese Form in 17,12 benutzt. Elija verknüpft den Schwur mit der Wendung „vor dem ich stehe“, was auf 17,1 zurück- und auf 2 Kön 3,14; 5,16 vorgreift. Der Prophet schwört bei dem Gott, in dessen Dienst er sein Leben stellt. Dieser Schwur ist es, der Obadja schließlich davon überzeugt, zu Ahab zu gehen. Sein Inhalt – dass Elija von Ahab „gesehen“ wird (ראה, Nifal) – erinnert an Jhwhs Anordnung vom Beginn der Geschichte (18,1–2) und lässt die Lesenden wissen, dass die erwartete Begegnung von Ahab und Elija unmittelbar bevorsteht.
18,17–18: Elija und Ahab Den Höhepunkt in dieser Reihe von Begegnungen bildet die letzte in Vv. 17–18. Obadja verschwindet aus der Erzählung, ohne dass man noch von ihm hören würde. Auch wenn seine Figur in Vv. 2b–4 teilweise ausgearbeitet ist, ist er am Ende doch nur eine Figur, die in einer bestimmten Rolle auftritt. Er hat das Treffen zwischen Elija und Ahab ermöglicht und verdeutlicht, wie geheimnis- und machtvoll die Figur Elijas ist. Darüber hinaus lässt er Israels Hin- und Hergerissensein zwischen Jhwh und Baal erahnen. Die Begegnung zwischen Ahab und Elija ist alles andere als herzlich (V. 17), sondern vielmehr eine Konfrontation, in der die Konfrontation zwischen Jhwh und Baal im nächsten Abschnitt des Kapitels vorweggenommen wird.55 Ahab bezeichnet Elija als den, der Israel Kummer bereitet. Damit wird jemand bezeichnet, dessen Verhalten anderen Ungemach bereitet, und zwar vor allem in Form von übernatürlicher Vergeltung (vgl. Jos 6,18; Jos 7,25; Ri 11,35; 1 Sam 14,29). Ahab gibt Elija die Schuld an der Dürre. Mit diesem Vorwurf gesteht er stillschweigend ein, dass Jhwh die Fruchtbarkeit Israels unter Kontrolle hat. Elija gibt die Anschuldigung direkt an Ahab zurück (V. 18), was der im Alten Orient geläufigen Vorstellung entspricht, dass Könige für das Wohlergehen ihrer Untertanen und ihres Herrschaftsgebietes verantwortlich sind. Elija behauptet, dass die wahre Ursache für die Katastrophe bei Ahab und seiner Familie liegt, die Kummer bereitet hat, indem sie Jhwhs Gebote für die Baale über Bord geworfen hat. Israels wirklicher Kummer besteht also nicht in der Dürre, sondern in der Verehrung anderer Gottheiten, zu der Ahab und die Omriden sie verleitet haben.56 Diese Bemerkung löst den Wettstreit darüber aus, wer der wahre Gott ist. Insofern stellen die Vv. 17–18 sowohl die Klimax der Begegnung zwischen Elija und Ahab in Vv. 1–18 dar als auch den Übergang zur Geschichte des Wettstreits auf dem Karmel. Sie bilden ein Scharnier – beziehungsweise den Teil eines Scharniers – zwischen den Episoden der Suche nach Elija und dem Wettstreit auf dem Karmel.57 Der Wettstreit wird erweisen, dass Ahab wie Elija jeweils in gewisser Weise im Recht sind: Die Dürre ist auf Veranlassung Elijas über Israel gekommen, weil es Jhwh ist, der über das Wetter gebietet. Doch sie kam nicht wegen Elija; sie wurde von Jhwh geschickt, um Ahab und Israel zu maßregeln und ihnen Jhwhs Überlegenheit über die von ihnen übernommenen Götter zu demonstrieren.
18,19–20: Scharnier zur Geschichte über den Wettstreit Den zweiten größeren Abschnitt des Kapitels bildet der Wettstreit auf dem Karmel. Elija beschließt, ein für allemal zu beweisen, dass der Gott, den Ahab verworfen hat, mächtiger ist als der, den er sich ausgesucht hat. Wenn die Vv. 17–18 als eine Seite des Scharniers fungieren, bilden die Vv. 19–20 die andere Seite. Die Verse 17–18 beschließen die erste Episode, und die Verse 19–20 sind die Eröffnung der zweiten. Elija befiehlt Ahab, ganz Israel sowie die Propheten Baals und der Aschera am Karmel (V. 19) zu versammeln, und Ahab kommt dem nach (V. 20). Die Prophetie gibt dem Königtum Anweisungen. Dass neben dem Volk Israel auch die Propheten Baals und Ascheras genannt werden, zeigt, dass dies keine israelitischen, sondern Isebels phönizische Propheten sind. Sie sorgt für sie, und die nicht unbeträchtlichen Kosten dafür werden aus israelitischen Steuereinnahmen bestritten. Diese Propheten stehen den Propheten Jhwhs gegenüber, die sich gezwungenermaßen von Wasser und Brot ernähren (Vv. 4.13), wenn sie nicht ohnehin getötet werden. Auch wenn hier nicht das Verb כול verwendet wird, schwingt doch der Gegensatz zu den Raben und der Witwe von Sarepta mit, die für Elija gesorgt haben. An der Tafel des Königs zu sitzen, ist ein große Ehre (1 Sam 20,29; 2 Sam 9,7–13; 19,29; 1 Kön 2,7; vgl. 2 Kön 25,29). Isebel hat sich dieses Ehrenplatzes bemächtigt. Sie hat in der königlichen Familie die Hosen an. Ahab ist nur derjenige, der die zu Isebel gehörigen Propheten zusammenruft. Sie stellt die wirkliche Bedrohung dar und verfügt im Grunde über die Macht des Königs; sie ist letztlich verantwortlich für Ahabs Abfall und Israels Wankelmütigkeit. Insofern ist es kein Zufall, dass Ahab an dieser Stelle aus der Erzählung verschwindet. Er hat seinen Zweck erfüllt, die Propheten Baals auf Geheiß Elijas zusammenzurufen. In der Erzählung über den Wettstreit wird er nicht mehr erwähnt, sondern er tritt erst wieder auf, als Elija ihn vor dem heraufziehenden Regen warnt (V. 41). Ob er beim Wettstreit zugegen ist, bleibt offen. Es ist auch unerheblich. Ahab ist eine Schachfigur in den Händen seiner Frau. Eigentlich nimmt sie am Wettstreit teil. Es sind ihre Propheten Baals, und sie ist diejenige, auf deren Konto die Ermordung der Jhwh-Propheten geht. Sie ist Elijas eigentliche Gegnerin.
Das Setting am Karmel Zunächst erscheint es seltsam, dass der Wettstreit gerade am Karmel stattfinden soll, weil der Berg kein Ort in zentraler Lage Israels ist und nicht gerade günstig gelegen ist für Elijas didaktisches Schaustück für das ganze Volk. Dieser Nachteil wird aber durch die relative Nähe des Karmel zu Tyrus, durch seine Fruchtbarkeit und seine Geschichte als heiliger Ort wettgemacht. Jhwhs Sieg ist ebenso mit dem Anspruch auf den Höhenzug wie auf Israel verknüpft. Die vielen Höhlen des Karmels passen gut zu 18,4.13 sowie als Leitmotiv zu 19,9.13. Dass die Geschichte gerade an diesem Ort spielt, bereitet den Erzählungen über Elischa den Weg, dessen Zuhause gelegentlich auch der Karmel ist.
18,21–40: Zeit der Entscheidung Wie Vv. 3–16 besteht auch die Erzählung vom Wettstreit in Vv. 21–40 aus drei Szenen, in denen jeweils drei Zusammenstellungen von Erzählfiguren zu finden sind: Elija und das Volk (Vv. 21–24), Elija und die Propheten Baals (Vv. 25–29) sowie wiederum Elija und das Volk (Vv. 30–40).58 Elija wendet sich (נגש) an das Volk (V. 21), das sich später ihm zuwendet (V. 30), bevor er sich anrufend an Jhwh wendet (V. 36). In seiner Eingangsfrage: „Wie lange?“ bringt er eine Beschwerde gegen das Volk vor, die den Wettstreit eröffnet.59 Die Frage bedient sich anscheinend eines Volkssprichwortes oder eines Aphorismus, dessen genaue Bedeutung nicht überliefert ist (siehe Anmerkung). Wenn die Übersetzung „an zwei Krücken hinken“ zutrifft, ist der Ausspruch eine Metapher für Unbeständigkeit. Ungeachtet der genauen Herkunft des Spruches ist deutlich, dass Elija dem Volk dessen Unschlüssigkeit vorwirft. Zwar versucht es, sowohl Baal als auch Jhwh zu verehren, doch beides zugleich geht nicht. Es muss sich entscheiden. Diese Entscheidung ist zugleich eine zwischen dem Propheten und dem König. Wie ein Sinnbild seiner Unschlüssigkeit wirkt es, wenn es heißt: Das Volk gab keinerlei Antwort. Damit wird das Thema des Antwortens hervorgehoben, das im Wettstreit eine zunehmend wichtigere Rolle spielt und seinen Gipfelpunkt in Elijas Aufforderung zum Antworten erreicht.
18,22–24: Elija schlägt einen Wettstreit vor Elija schlägt vor, einen Wettstreit abzuhalten (Vv. 22–24), um das Volk zu einer Entscheidung zu bewegen. Er hat das Sagen; seine Autorität wird weder vom Volk noch von den Propheten Baals oder von Ahab infrage gestellt. Sein Vorschlag beginnt mit der Feststellung, dass er als Prophet Jhwhs (V. 22) ganz allein den 450 Propheten Baals gegenübersteht. Diese Aussage entspricht V. 4 und 13, weil die anderen Propheten Jhwhs entweder von Isebel getötet wurden oder sich verstecken mussten. Elija weiß von den 100 Propheten, die Obadja versteckt hat (Vv. 4.13), doch diese können sich hier nicht zeigen. Indem er behauptet, allein zu sein, schützt er sie vor Isebel.60 Daneben gehört es zu seiner rhetorischen Strategie im Hinblick auf die Herausforderung, der er sich nun stellen wird. Den Titel „Prophet“ trägt Elija nur selten (18,36; 19,16); dadurch wird er den 450 Propheten Baals gegenübergestellt, ganz abgesehen von den 400 Propheten der Aschera. Die Chancen stehen nicht gut für ihn. Die Propheten Baals können die Teilnahme kaum verweigern, zumal das ganze Volk Israel zusieht. Dass Elija sich so eindeutig in der schwächeren Position befindet, lässt seinen Sieg am Ende umso spektakulärer erscheinen.61 Letztlich ist dieses Zahlenspiel aber nur ein Kunstgriff, denn im Wettstreit kämpfen eigentlich zwei Götter miteinander.
18,23–24: Die Bedingungen für den Wettstreit Elijas Bedingungen sehen vor, dass jede Seite einen Stier für das Opfer präpariert und alles so weit vorbereitet, außer dass das Opfer entzündet wird (V. 23). Jede Seite soll dann ihren Gott anrufen, und der Gott, der mit Feuer antwortet, wird sich als wahr (האלהים, „der Gott“) erweisen. Vordergründig gewährt Elija seinen Gegnern jeden Vorteil und gestattet es ihnen, zu beginnen. Wenn das Verb ויתנו („man soll ihnen geben“) mit Bezug auf die Propheten Baals verstanden wird, gestattet ihnen Elija sogar, die beiden Stiere auszusuchen.62 Elijas eigener Plan sieht vor, dass er sich in der Position des Außenseiters befindet. Diesem Plan ist eine gewisse Praktikabilität eigen, denn weil Elija die Vorbereitungen alleine trifft, braucht er dafür auch länger.63 Es zeigt auch, wie sicher er sich ist, dass die Baals-Anhänger scheitern werden.64 Aus erzählerischer Sicht erhöht der Beginn durch die Propheten Baals die Spannung und zögert den Höhepunkt der Geschichte hinaus. Die Enttäuschung über die Baals-Propheten wird größer, und der Gegensatz zwischen ihrem Versagen und Elijas Sieg wird stärker betont. In V. 24 wechselt Elija erneut vom Jussiv in die zweite Person Plural (וקראתם). Bis zu V. 21 hat er zum Volk gesprochen, und ab jetzt ist das wieder der Fall. Mit den Jussiven in V. 23 wird festgelegt, was die Propheten Baals ihrerseits im Wettbewerb tun müssen. Dadurch bezieht Elija das Volk in V. 24 insofern in das Geschehen mit ein, als es Baal anrufen soll, zusammen mit dessen Propheten. Dass das Volk Elijas Gegnern zugeordnet wird, lässt Elijas Chancen noch schlechter erscheinen. Als sein Adressat bestätigt das Volk in V. 24b die „Regeln“ des Wettstreits. An keiner Stelle erwähnt Elija den Namen Baal, sondern bezeichnet ihn schlicht als euren Gott. Seine Verwendung des Namens Jhwhs macht demgegenüber deutlich, dass Baal nicht real ist.
18,25: Die Propheten Baals bereiten ihr Opfer vor Der eigentliche Wettstreit beginnt in V. 25, als Elija die Propheten Baals anweist, ihren Stier auszuwählen und ihn zum Opfern vorzubereiten. Sie folgen seinen Anweisungen (V. 26). Das Subjekt des Verbs נתן in V. 26 ist nicht Elija, da in V. 23 angedeutet wird, dass die Stiere von jemand anderem zur Verfügung gestellt werden. In diesem Vers bleibt offen, ob die Propheten Baals die Stiere bereitgestellt haben. Das ist hier allerdings nicht möglich, weil sie die Empfänger sind. Deshalb sollten die Verben in beiden Versen unpersönlich verstanden werden. In V. 26 werden die Bemühungen der Propheten Baals zum Heraufbeschwören einer Antwort genauer geschildert. Die Propheten bereiten ihren Stier nach den Anweisungen Elijas vor und beginnen mit der Anrufung Baals. Den ganzen Vormittag lang fahren sie damit fort. Trotz ihres Flehens – Oh Baal, antworte uns – ist dort keine Stimme und niemand, der antwortete. Die letztgenannte Aussage bedient sich nicht des Namens Baals, sondern ist abstrakt oder unpersönlich gehalten und deutet damit an, dass es niemanden gibt, der antworten könnte. Die „Stimme“ ist der spezielle Klang des Sturmgottes, also der Donner (z. B. Ex 19,19; Dtn 4,36; 2 Sam 22,14//Ps 18,14; Ijob 37,1–5; 38,34; 40,9; Ps 29,3–9; 68,34; Jes 30,30–31; Jer 10,13; 51,16), der mit dem Blitz, dem „Feuer“, einhergeht (z. B. Ex 9,23–24; Dtn 4,36; 5,22–26; Ps 29,7; 97,3–4), das eine Antwort der Gottheit darstellt.65 Das völlige Ausbleiben von „Stimme“ und „Feuer“ stellt das Wesen der Baals-Religion infrage und schlicht die Existenz des Gottes. Es wird keine Antwort gegeben, weil Baal nicht real ist, nicht existiert, ein Nichts ist.
18,26: Kultischer Tanz Die Propheten Baals beginnen, in rituellem Tanz um ihren Altar herum zu „hüpfen“ oder zu „hinken“. Hier wird auf das Verb in V. 21 angespielt. An dieser Stelle in V. 26 könnte es sich um eine Persiflage handeln. Selbstverständlich ist der Tanz im kultischen Rahmen im Alten Israel (2 Sam 6,14; Ps 149,3; 150,4; Jer 31,13) und in anderen Kulturen belegt.66 Er kann als Zeichen prophetischer Ekstase oder als Mittel zu deren Herbeiführung verstanden werden, doch er dient nicht zwangsläufig der Beschwörung und muss auch nicht unbedingt Regen herbeirufen.67 Seine primäre Funktion an dieser Stelle ist erzählerischer Art. Nach der Feststellung, dass es keine Stimme gibt und niemanden, der antwortet, stellt das Hüpfen oder Hinken eine Verzweiflungstat dar, ähnlich dem Ritzen in V. 28.68 Das Verb פסח weist auf die Unbeholfenheit oder Plumpheit dieser Tätigkeit hin, was zur Polemik gegen Baal passt.69 Die Verspottung durch Elija im nächsten Vers (V. 27) macht es wahrscheinlicher, dass die Erzählung es ihrem Helden in der Verspottung der Gegner gleichtut. Die Unbeholfenheit des Tanzes und die Kuriosität des Schauspiels steigern das Interesse der Lesenden und die Sympathien für Elija, wodurch die Lesenden dazu aufgefordert werden, sich am Spott zu beteiligen.
18,27: Die Verspottung durch Elija Bereits in den Anmerkungen wurde darauf hingewiesen, dass die Wurzel התל eine Konnotation der Täuschung besitzt. Elijas vermeintlich hilfreiche Andeutungen zu dem, was Baal womöglich abgelenkt haben könnte, sind purer Sarkasmus. Die von ihm angedeuteten Szenarien deuten darauf hin, dass es hier um einen Gott geht, der nach dem Bild von Menschen erschaffen ist. Die verwendeten Bilder lassen sich in Mythen finden; in ihnen werden banale menschliche Tätigkeiten beschrieben.70 Elija fordert seine Gegner dazu auf, Baal lauter anzurufen, denn er ist ein Gott. Elija ist nicht der Ansicht, dass Baal ein Gott ist, und er weidet sich an ihrer Enttäuschung. Er macht sich lächerlich über die Vorstellung, dass ein Gott ähnlich leben würde wie die Menschen,71 und dabei macht er auch nicht Halt vor dem Vorschlag, dass Baal womöglich seine Notdurft verrichten muss. In Wirklichkeit ist Baal kein Gott. Dass er nicht antwortet, liegt nicht daran, dass er anderweitig beschäftigt wäre, sondern daran, dass es ihn nicht gibt.
Wenn denn die Baals-Propheten Elijas Sarkasmus bemerken, so ignorieren sie ihn. Trotzdem hören sie auf seinen Rat, lauter nach Baal zu rufen (V. 28), womit sie konzedieren, dass Baal abgelenkt sein könnte. Sie fügen sich selbst Verletzungen zu und fallen in dem Versuch, Baals Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, in prophetische Trance (ויתנבאו, V. 29). Keine Antwort Doch die Antwort bleibt die gleiche: keine Stimme, niemand, der antwortet. Sie setzen ihren ekstatischen Rausch bis zur Zeit des Abendopfers fort, also nach 15 Uhr.72 Jhwhs liturgisches Programm bildet damit den zeitlichen Rahmen für den Wettstreit.73 Die Propheten Baals hatten wirklich eine reelle Chance. Der Tag ist fast vorbei. Wenn Elija noch an die Reihe kommen will, dann muss er nun die Gelegenheit dazu ergreifen. 18,30: Elija ist an der Reihe Er schickt die Propheten Baals weg. Sie haben versagt. Er fordert das Volk auf, näher an ihn heranzutreten.74 Ihre Nähe zu ihm gewährt ihnen einen unverstellten Blick auf all sein Tun, und so können mögliche Betrugsvorwürfe gar nicht erst aufkommen.75 Die Schilderung seiner Vorbereitungen in Vv. 30b–35 sowie sein anschließendes Gebet in Vv. 36–37 nehmen das Tempo aus der Erzählung und bauen Spannung auf, bevor in V. 38 die Klimax folgt.
18,31–33: Der Bau und die Vorbereitung des Altars Elija beginnt damit, dass er einen Altar für Jhwh wieder herrichtet, der niedergerissen worden war (V. 32b). Wann genau dieser frühere Altar zerstört wurde, ist nicht klar, doch seine Lage deutet darauf hin, dass der Karmel einst Jhwh und den Israeliten gehörte; die phönizischen Baals-Verehrer haben sich seiner bemächtigt. Zum Herrichten des Altars durch Elija gehört zunächst der Wiederaufbau des Altars. Elija verwendet zwölf Steine in Entsprechung zu den Söhnen Jakobs und den Stämmen Israels (V. 31), was an ähnliche Altäre erinnert, die Mose (Ex 24,4) und Josua erbaut haben (Jos 4,20). Dadurch wird die Einheit Israels als Volk Jhwhs symbolisiert. Die Wendung Israel wird dein Name sein, mit der Gen 35,10 zitiert wird, zeigt, dass es Jhwh war, der Jakob/Israel als sein Volk erwählt hat. Dessen Überlaufen zu Baal ist töricht.
18,33b–45: Überall Wasser Die Bedeutung des Wassers wird dadurch unterstrichen, wie die gesamte Episode um es herum angeordnet ist (Vv. 32b–35). Jeder einzelne Schritt wird mit einem erneuten Motiv von Auftrag und Ausführung beschrieben: Elija sagte, ‚Macht das noch einmal‘, und so machten sie es noch einmal. Er sagte: ‚Macht es ein drittes Mal‘, und so machten sie es ein drittes Mal. Dann wird erzählt, wie das Wasser um den Altar herumfloss und den ihn umschließenden Graben füllte (V. 35). Dass dieses Wässern mitten in einer Dürre und an einem abgelegenen Berghang geschieht, unterstreicht seine Bedeutung zusätzlich. Durch die ausgedehnte Schilderung wird die Spannung in die Länge gezogen, weil die Erzählung ihren Höhepunkt fast erreicht hat. Das Wunder wird durch die Beschäftigung mit dem Wasser noch verstärkt. Das Feuer wird das vollkommen durchnässte Opfer verzehren wie auch das Wasser im Graben (ganz zu schweigen vom Holz und den Steinen). Es ist ein Feuer, das von Gott kommt und nicht von Menschen.76
18,36–37: Elijas Gebet Die Lesenden werden in der Erzählung daran erinnert, dass die Zeit für das Abendopfer gekommen ist (V. 36). Elijas Bitte an Jhwh wird schlichter sein und weniger Zeit in Anspruch nehmen als das theatralische Auftreten der Propheten Baals. Zugleich wird sie Wirkung zeigen. Elija bittet Jhwh darum, aus seiner göttlichen Herrlichkeit heraus zu handeln. Die Grundlage für diese Bitte besteht in der langjährigen Beziehung, die Jhwh zu seinem Volk hat und die bis zu dessen Ahnen zurückreicht. Dass Jhwh hier als Gott Abrahams, Isaaks und Israels vorgestellt wird, erinnert an Mose (Ex 3,6.13.15–16; 4,5) und unterstreicht, dass Elija zusammen mit ihnen in der Tradition der Diener Jhwhs steht. Elija beansprucht keine Anerkennung für seine großen Taten, sondern gesteht zu, dass sie alle durch Jhwh vollbracht wurden. Seine Bitte schließt in V. 37 mit dem Ausdruck der Hoffnung, dass Jhwhs „Antwort“ dazu führen möge, dass Israel Jhwh „erkennen“, also seine Beziehung zu ihm erneuern wird.
Elijas abschließende Worte in V. 37, und dass du ihre Herzen zurückgewendet hast, lassen sich auf zwei höchst unterschiedliche Weisen verstehen. Sagt Elija damit, dass Jhwh Israel zu sich selbst zurückgeführt hat, oder dass Jhwh dafür verantwortlich war, dass Israel sich überhaupt erst von ihm abgewandt hat? Überraschenderweise scheint Letzteres der Fall zu sein.77 Die Wendung סבב (Hifil) + לב kommt sonst in der Bibel nur in Esra 6,22 vor. Es bedeutet „jemandes Gunst neigen zu“. Das Adverb אחרנית „zurück“ bezeichnet eine Bewegung in die falsche oder ungewohnte Richtung. Wenn es um ein Wiederherstellen gehen soll, würde höchstwahrscheinlich eine Form des Verbs שוב gewählt werden. Die emphatische Verwendung des Pronomens אתה und des Gottesnamens (die in Elijas Gebet in Vv. 36–37 je dreimal vorkommen) deutet darauf hin, dass es um den Gegensatz zwischen Jhwh und Baal geht. Es muss Jhwh gewesen sein, der Israel zum Zurückwenden bewegt hat, weil Baals Nutzlosigkeit nun vor Augen geführt wurde. Die Vorstellung, dass Jhwh für das Zurückkommen seines Volkes verantwortlich sein könnte, begegnet nicht nur in diesem Gebet (vgl. 1 Kön 12,15, wo das Substantiv סבה verwendet wird, sowie in Jes 63,17). Darüber hinaus besteht hier eine weitere Parallele zur Mose-Geschichte, nämlich zu Moses Erzählung über die Herzensverhärtung des Pharaos. Damit verbunden ist der Gedanke, dass Jhwh zur Mehrung seines Ruhms die Rückkehr seines Volkes selbst bewirkt.