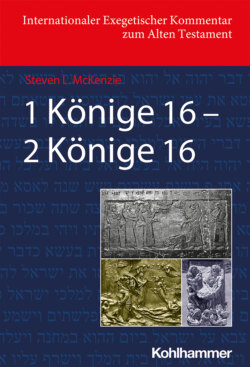Читать книгу 1 Könige 16 - 2 Könige 16 - Steve McKenzie - Страница 49
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Diachrone Analyse
ОглавлениеDer prophetische Erzähler Das plötzliche Erscheinen Elijas sowie der Beginn eines längeren Abschnitts, der überwiegend aus Prophetenerzählungen besteht, zeigen an, dass hier der Verfasser nicht mehr DtrH ist. Mit Ausnahme von 1 Kön 21,20–22.24 und 2 Kön 1,2.5–8.17–18* stellen die Prophetenerzählungen von hier bis 2 Könige 13 Hinzufügungen aus der Zeit nach DtrH dar. Wie bereits in der Einleitung angedeutet, sind die Elija-Geschichten in 17–19* als Einleitung zu den Elischa-Geschichten verfasst worden, und zwar in Gestalt einer Apologie der Gerichtsprophetie, was am Beispiel des Hauses Ahabs verdeutlicht wird. Der für diese Einleitung und für die Redaktion der Elischa-Geschichten verantwortliche Verfasser/Redaktor wird als prophetischer Erzähler (PE) bezeichnet. Der Wechsel beginnt mit der Interpolation in 16,31–33, in der Ahab und Isebel angeklagt und zum Hauptziel der Gerichtsprophetie Elijas erklärt werden. Sie sind die Ursache für die von Elija angekündigte Dürre. In Kap. 17–18 versammelt PE mehrere unabhängige Geschichten und Prophetenlegenden unter dem Oberthema der Dürre, obwohl ursprünglich nur bei einer von ihnen (18,1–16*) eine Dürre vorausgesetzt war.
17,1: Elijas Ankündigung Elijas Ankündigung der Dürre in 17,1 ist redaktionell (PE). Im Vers wird betont, dass es Elijas Wort ist, auf das hin die Dürre beginnen und enden wird. Das hebt sich gegenüber dem Kontext der Kap. 17–18 ab, wo das Wort Jhwhs ein wichtiges Motiv ist, das als Hinweis auf eine unabhängige Legende verstanden wurde, in der der Gottesmann selbst die Dürre ankündigt.47 Wie bereits in der synchronen Analyse ausgeführt besteht der Hauptzweck dieser Kapitel darin, Jhwhs Wort mit dem Wort Elijas gleichzusetzen (17,24), so dass Elijas Verkündung in V. 1 eintrifft. In dessen Dienst ich stehe (V. 1) ist ein Proprium der Elija-Elischa-Geschichten; nur in ihnen wird es im Rahmen der dort benutzten Schwurformel zur Legitimierung verwendet (18,15; 2 Kön 3,14; 5,16).48 Elija verwendet allgemeine Begriffe für Tau und Regen, um sich nicht auf die beiden Jahreszeiten in Palästina zu beziehen, sondern auf das Ausbleiben jeglicher Niederschläge.49 Das Wortpaar sowie Elijas Fluch besitzen eine Parallele im ugaritischen Aqhat-Epos (KTU 1.19.1.42–45):
| šb‛.šnt yṣrk.b‛l. | Sieben Jahre verschwand Baal, |
| tmn.rkb ‛rpt. | Acht der Wolkenfahrer. |
| bl.ṭl.bl rbb | Kein Tau, kein Sprühregen. |
Die – der Geschichte in 18,1–16* entlehnte – Dürre wird zum Thema, unter das die Kap. 17–18 gestellt werden und das unterstreicht, dass Jhwh die Kontrolle über Regen und Fruchtbarkeit besitzt.
17,2–4: Der Auftrag, zum Wadi Kerit zu gehen Auch die wiederholten Anweisungen an Elija in Vv. 2–4, im Wadi Kerit Zuflucht zu suchen, wo er etwas zu trinken findet, sind redaktionell. Die Wortereignisformel in V. 2 passt zur Betonung des Wortes Jhwhs durch PE. Sie sollte nicht als „deuteronomistisch“ bezeichnet werden,50 denn sie kann auch prophetischen Ursprungs sein, weil sie in mehreren Textpassagen über die frühe Königszeit zu finden ist.51 Sie ist in jüngeren prophetischen Texten – vor allem bei Jeremia und Ezechiel – weit verbreitet, und sie zählt nicht zur ausschließlichen oder charakteristischen dtr Terminologie.52 Das Wort Jhwhs setzt die Episode von Vv. 2–7 in Gang, die in der Begrifflichkeit von Befehl und Erfüllung formuliert ist. Das Argument, dass „von hier aus“ (מזה) in V. 3 auf eine ältere Geschichte verweist, die eine weggefallene spezifische Ortsangabe enthielt,53 liest in die Worte zu viel hinein. Die mangelnde Genauigkeit könnte darauf hindeuten, dass es sich um einen nicht näher bestimmten Ort handelt. Bei Jhwhs Auftrag, im Wadi Kerit Zuflucht zu suchen, wird die Ankündigung der Dürre in 17,1 mit 18,1–16 verknüpft. Dort gibt Elija sich Ahab zu erkennen, der vergebens nach dem Propheten gesucht hat, um der Dürre ein Ende zu setzen.
17,5–6: Die Legende vom Wadi Kerit Elijas Aufenthalt im Wadi in Vv. 5–6 (ohne die redaktionelle Erweiterung gemäß Jhwhs Wort) ist eine ältere, von PE verwendete Legende. Bestätigt wird diese Einschätzung durch die Tatsache, dass Elijas Handeln in V. 5 (er ging und blieb) nicht genau mit Jhwhs Auftrag in V. 3 (Geh … verstecke dich) übereinstimmt. Wenn der Name Kerit (V. 4) mit dem Verb „ein Festmahl geben“ zusammenhängt, könnte er für diese Geschichte (V. 5) gebildet worden sein. Ein Wadi ist ein von herabströmendem Regenwasser eingeschnittenes Tal und kann sehr groß (wie beispielsweise das Wadi Mudschib in Jordanien) und sehr zerklüftet sein, was es zu einem guten Versteck macht. Für das Wadi Kerit wurden Ortslagen beiderseits des Jordans vorgeschlagen – vor allem Wadi Qelt im Westen und Wadi Jabis (Jabesch) im Osten, wobei Letzteres auf Euseb zurückgeht.54 Das Wadi Qelt ist zweifelhaft, weil es nicht besonders abgeschieden liegt.55 Doch das Argument, dass das Wadi Jabis gemeint sei, weil Elija aus Gilead stammte, entbehrt der Grundlage, da der Hinweis auf Gilead in V. 1 eine Glosse ist.56 In der Legende hinter Vv. 5–6 könnte es darum gegangen sein, den Gottesmann als Eremiten darzustellen, der allein in der Wüste lebt und von Tieren versorgt wird. Bei der Erwähnung von Tieren, die Menschen unterstützen, die in besonderer göttlicher Gunst stehen, handelt es sich um ein volkstümliches Motiv.57 Tiere erscheinen in der Bibel auch an anderen Stellen als Diener und Boten Gottes (z. B. Num 22; Mt 3,16). Dass die Raben einen Verweis auf Araber darstellen, ist von dem Wunsch geleitet, das Wunder allein rational zu betrachten, was dem Zweck der Legende zuwiderläuft.58 Das Wunder ist umso erstaunlicher, als Raben für gewöhnlich aggressive Aasfresser sind. Als solche sind sie kultisch unrein (Lev 11,15; Dtn 14,14). Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Geschichte älter ist als die Überlieferung der Rechtstexte, weil Elija schließlich nicht die Raben isst, sondern nur die von ihnen gebrachte Nahrung. Fleisch gab es in der Regel nicht jeden Tag zu essen, sondern nur zu besonderen Gelegenheiten wie etwa an Feiertagen. Deshalb stellt der allabendliche Verzehr von Fleisch durch Elija (V. 6 OG) einen Topos für üppige Kost dar und spielt auf die Mosetradition und die Versorgung Israels in der Wüste (Ex 16; Num 11) an. PE beschließt diese Episode und schafft die Voraussetzungen für die Vv. 8–16, indem er erklärt, wie Elija durch das Austrocknen des Wadis zum Weggang gezwungen wurde (V. 7).
17,8–16: Eine Überarbeitung von 2 Kön 4,1–7 Die Wortereignisformel in V. 8 markiert den Beginn einer neuen Episode und bezeugt das PE-Thema des Wortes Jhwhs. Auch das Motiv von Auftrag und Ausführung, das mit Elijas Reise nach Sarepta in Vv. 9–10aα verbunden ist, verrät die Hand von PE. Die Legende hinter dem übrigen Stoff von Vv. 8–16 ist eine Umgestaltung der Elischa-Legende von 2 Kön 4,1–7. In beiden Fällen gibt es eine Witwe, die sich in einer Notlage befindet. In beiden Fällen greift der Prophet auf wundersame Weise ein, um sie und ihre Kinder zu retten; dazu verwendet er den Rest Öl, den sie noch hat. In der Forschung werden die beiden Geschichten meist als parallele Erzählungen angesehen, die eine gemeinsame Vorlage haben. Betrachtet man aber die vorliegende Geschichte als Überarbeitung der Elischa-Legende, dann lassen sich einige Fragen beantworten, die sich anhand der Elija-Version stellen: Woran erkennt Elija die Witwe? Warum sprechen die beiden – die sich vermeintlich nicht kennen – miteinander so vertraut? Wie kann die Witwe wissen, dass Elija ein Anhänger Jhwhs ist? Warum befolgt sie seine Anweisungen, obwohl sie ihn nicht kennt, und geht dabei so weit, dass sie ihm die letzte Mahlzeit überlässt, die sie und ihre Kinder zu sich nehmen werden?59 Solche Fragen lassen sich beantworten, wenn man 2 Kön 4,1–7 als Vorlage der hier betrachteten Geschichte ansieht – denn nun kennen sich die beiden Figuren bereits.
Die Vorlage ist in Israel angesiedelt, weil die Witwe der Prophetengilde nahestand (2 Kön 4,1). PE verlegt sie in die phönizische Stadt Sarepta (V. 9), was im Einklang mit Elijas Untertauchen steht sowie damit, dass so die Kontrolle Jhwhs über Niederschlag und Fruchtbarkeit in Baals und Isebels Reich veranschaulicht werden kann. Die Elischa-Legende setzt keine Dürre voraus, doch die extreme Armut der Frau als Witwe passt gut unter dieses Oberthema. Das Wort לכלכלך, das sich auch in V. 4 findet, weist auf die gleiche Hand hin und verbindet die Geschichte des PE noch enger mit den Vv. 1–7. Paradox wirkt dabei, dass Elija schließlich für die Witwe sorgt, die sich um ihn kümmern soll.60 Die Verse 10–16* sind um das Motiv von Auftrag und Ausführung herum angeordnet. Elija erfüllt (V. 10) Jhwhs Auftrag, nach Sarepta zu gehen. Seine Bitte an die Witwe und ihre prompte Antwort (V. 11) setzen wie in 2 Kön 4,1–7 voraus, dass sie sich kennen. Dass die Begegnung so abrupt beginnt, wird dadurch ein wenig abgemildert, dass Elija zu Beginn um Wasser bittet (Vv. 10bβ–11bβ), was an Begegnungen wie die zwischen Jakob und Rebekka (Gen 29) oder Mose und Zippora (Ex 2,15–16; vgl. Joh 4,6–7) erinnert. PE bindet die Bitte durch eine Wiederaufnahme (er rief sie/ihr nach, „Bring mir bitte …“)61 – eine von Verfassern wie Redaktoren verwendete Technik – als Anlehnung an das Motiv der Dürre in den Kontext ein. In dieser Weise überarbeitet er die Elischa-Legende, damit sie den ihr zugedachten Zweck in der Elija-Geschichte erfüllt, wozu auch die Einbettung der Bitte um Wasser gehört. PE verändert die Notlage der Witwe von der Schuldsklaverei zur Bedrohung durch den dürrebedingten Hungertod. In 2 Kön 4,1–7 wird das Öl aus einem einzigen Gefäß verteilt und verkauft, um die Schuld zu tilgen; in 1 Kön 17,8–16 ist die Not unmittelbarer – der Hungertod muss verhindert werden –, weshalb es unterschiedliche Behältnisse für Öl und Mehl gibt, also für die Zutaten von Brot.
Elijas Bitte um Nahrung stellt den Auftakt für die Ankündigung und den Vollzug des Wunders dar. Die Witwe schwört bei Jhwh, deinem Gott (V. 12), weil sie Phönizierin ist. Elija verwendet die prophetische Wendung „Fürchte dich nicht“ (V. 13), was der Frau bestätigt, dass er der Stellvertreter Gottes ist, in dessen Namen spricht und im Begriff ist, sich für sie einzusetzen.62 In Vers 14a wird konkretisiert, warum die Frau nun beruhigt ist, indem nämlich das Wunder vorausgesagt wird, das sich gleich ereignen wird. Diese Voraussage führt unter Verwendung der Botenformel „so spricht Jhwh“ das Wort Jhwhs ein und verrät dadurch die Handschrift PEs. Zugleich stellt die Formel klar, dass Jhwh durch Elija spricht. Die Formel wird hier nicht so verwendet wie an anderen Stellen in den Elija-Geschichten (2 Kön 1,4.6.16), aber die Verwendung entspricht der „eschatologischen“ Verwendung in einer Gruppe von Elischa-Geschichten (2 Kön 2,21; 3,16–17; 4,43; 7,1), wo es um die wundersame Stillung von Grundbedürfnissen wie Essen und Trinken geht.63 Auch in Vers 14b werden zwei Themen von PE beleuchtet, nämlich die Dürre sowie Jhwh als eigentlichen Bringer des Regens (18,1). Die Witwe kommt dem Auftrag Elijas nach (V. 15) und wird dadurch belohnt, dass nun gemäß Jhwhs Wort (V. 16) stets Öl und Mehl vorhanden sind.64
17,17–24: Eine Überarbeitung von 2 Kön 4,8–37 Die Geschichte in Vv. 17–24 ist, anders als häufig vorgeschlagen,65 keine Interpolation, sondern ebenfalls eine überarbeitete Version einer Elischa-Legende, und zwar von 2 Kön 4,8–37.66 Danach in V. 17 zeigt den Beginn einer neuen Episode an, obwohl nun die gleichen Figuren und das gleiche Setting verwendet werden. Es wird keine Wortereignisformel gesetzt, weil Elija nicht an einen anderen Ort geschickt wird, als er in V. 2 und V. 8 war. Vielmehr wird die Geschichte durch eine Krise angestoßen, nämlich durch den Tod des Sohnes der Frau. Die Frau ist die phönizische Witwe (V. 20). Ihre Figur wird mit der Frau von Schunem aus der Elischa-Legende verschmolzen, wobei dies nicht ganz gelingt. Einige Elemente der Elischa-Version werden mit herübergenommen, auch wenn sie den Gegebenheiten der Elija-Geschichte nicht völlig entsprechen. Der Titel Herrin des Hauses (V. 17) passt nicht dazu, dass die Witwe sehr arm ist; in der Elischa-Geschichte ist er jedoch stimmig, weil die Frau von Schunem wohlhabend ist. Ebenso ist der eingerichtete obere Raum in 17,19.23 fehl am Platze, aber für die Elischa-Geschichte ist er unverzichtbar, weil dort der Raum für den Gottesmann erst gebaut wird. Dass Elija den Jungen in den oberen Raum trägt, dient keinem erkennbaren Zweck und wird so zu einem blinden Motiv.67
Der Sohn der Frau – oder besser gesagt, eines ihrer Kinder (OG) – wird in Vv. 8–16 (MT) erwähnt. Ihre Beziehung zu Elija ist bereits in der vorangegangenen Geschichte geknüpft worden. Deshalb geht sie zu ihm, als ihr Sohn stirbt, und beschuldigt ihn, durch seinen Aufenthalt bei ihr Unheil über sie gebracht zu haben (V. 18). Die Frage der Witwe in V. 18 und der sich darin niederschlagende Schmerz rekurrieren auf 2 Kön 4,28. Sie beschuldigt Elija faktisch, den Tod ihres Sohnes verursacht zu haben, wie das auch die Frau von Schunem tut. Der Titel Gottesmann kommt in den Elischa-Geschichten häufiger vor und wird in 2 Könige 4 durchgängig verwendet, doch Elija wird nur in 17,18.24 und 2 Kön 1,9–13 so bezeichnet. Deshalb gehört der Titel ursprünglich zur Elischa-Tradition und wird erst sekundär auf Elija übertragen. Die Witwe geht davon aus, dass sie für frühere Sünden bestraft wird. Ihre Frage nimmt die Frage Obadjas in 18,9 vorweg.
Der Tod des Sohnes und dessen Auferweckung durch Elija Da nicht explizit gesagt wird, dass der Junge gestorben ist, werden in den Kommentaren zahlreiche Überlegungen zum Verständnis des Todes im Alten Israel angestellt. Für die hier betrachtete Textpassage ist diese Frage obsolet, weil vom Kontext her deutlich ist, dass der Junge tot ist. So heißt es in V. 17, dass er zu atmen aufgehört hat;68 die Witwe beschuldigt Elija, dass er den Tod ihres Sohnes verursacht habe (V. 18); und in V. 22 ist zudem davon die Rede, dass die נפש („Leben, Seele“) des Jungen wieder zu ihm zurückkehrt (V. 22). Auch in der Elischa-Legende (2 Kön 4,20), die als Vorlage unserer jetzigen Geschichte diente, besteht kein Zweifel am Tod des Jungen. Darüber hinaus ist die (durch den Gottesmann vermittelte) Macht Jhwhs über den Tod ein wichtiger theologischer Aspekt der vorliegenden Geschichte.
Dass Elija den Jungen in den oberen Raum bringt (V. 19), stammt – wie bereits erwähnt – aus 2 Könige 4. Das dreimalige Anhauchen des Jungen (OG) in diesem Raum ergibt mehr Sinn, als dass sich Elija dreimal über ihn hinstreckt, wie es MT überliefert (V. 21b).69 Dahinter verbirgt sich die Kurzfassung von Elischas magischem Handeln aus 2 Kön 4,34–35.70 Die rituelle Handlung ist allerdings zu einem weiteren blinden Motiv geworden, da Jhwh durch das Gebet zum Handeln bewegt wird, das zur Erweckung des Jungen führt. Elija ist nur Bittsteller. Nur Jhwh kann dem Jungen das Leben zurückgeben. גם (sogar oder auch) im Munde Elijas ist eine Anspielung auf die Dürre und deutet darauf hin, dass über die Frau – die phönizische Witwe –, die ihm geholfen hat, nun ein weiteres Unglück hereingebrochen ist. Als sie ihren Sohn zurückbekommt (V. 24), bezeugt sie in ihrem Bekenntnis Jhwhs Wort als Quell des Lebens und der Wahrheit. Bei PE bildet dies die Klimax im Hinblick auf das Motiv des Jhwh-Wortes in diesem Kapitel.