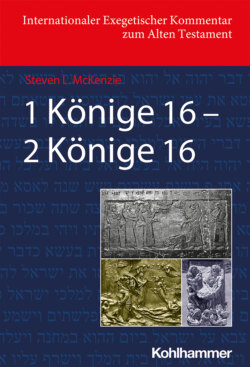Читать книгу 1 Könige 16 - 2 Könige 16 - Steve McKenzie - Страница 52
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anmerkungen zu Text und Übersetzung
Оглавление1 Nach einiger Zeit: Gelesen wird ויהי מימים רבים, was sich in einigen hebräischen Handschriften findet und von GBL (καὶ ἐγένετο μεθ᾽ ἡμέρας πολλὰς) vorausgesetzt wird. ויהי מימים wird sonst auch in Jos 23,1; Ri 11,4; 15,1 verwendet. MT hat ויהי ימים רבים, wobei ein Verb im Singular mit einem Subjekt im Plural verknüpft wird (vgl. jedoch 1 Kön 11,3).
3 Obadja: Bedeutet „Diener Jhwhs“. Die Wurzel ‛bd in Personennamen stellt ein Bekenntnis zur Jhwh-Treue dar, insbesondere in nachexilischer Zeit. Sie kommt mit Bezug auf elf Figuren in der HB vor, allesamt in den Chronikbüchern, Esra und Nehemia, sowie außerdem für den Namen des Propheten, der hinter dem Obadjabuch steht, und für Elijas Gesprächspartner.1
der dem Haus vorstand: Siehe zu 16,9.
4 abschlachtete: So GBL, τύπτειν, das meist die Übersetzung von נכה Hifil ist; dabei ist dies der einzige Fall in der Hebräischen Bibel, wo es für כרת steht. MT wurde wohl davon beeinflusst, dass das gleiche Verb im nächsten Vers vorkommt.2 Dass das Verb כרת eine Verbindung zum Wadi Kerit in Kap. 17 herstellt, könnte hier auch eine Rolle gespielt haben.
je fünfzig: Gelesen wird חמשים חמשים wie in V. 13 und mit den Versionen.3 Im MT (חמשים איש) ist die Wiederholung der Anzahl durch Haplographie weggefallen, und es findet sich eine Erweiterung durch איש, die in GBL fehlt. Die ältere Lesart ist in der Paraphrase der Elija-Geschichten im „Elija-Apokryphon“ (4Q382, Fragment 1, Zeile 2) erhalten, wo das Wort חמשים einmal ganz und einmal teilweise zu lesen ist. Die Wiederholung der Anzahl deutet auf den distributiven Sinn hin.
in einer Höhle: So MT mit dem bestimmten Artikel im Sinne des „Objekts, das bekannt war und wiedererkannt wurde“.4 Die distributive Verwendung (siehe die vorangegangene Anmerkung) deutet darauf hin, dass es um zwei Höhlen geht, die jeweils einer Fünfziger-Gruppe Unterschlupf bieten. Diese Interpretation wird durch andere G-Zeugen belegt, die in zwei Höhlen haben.5
und versorgte sie: Gelesen wird das Imperfekt consecutivum ויכלכלם, statt des Perfekts (וכלכלם) im MT, basierend auf der erneuten Nennung von Obadjas Taten in V. 13, wo das Imperfekt consecutivum gesetzt wird. Beide Formen können verwendet werden, um wiederholte Handlungen zu bezeichnen.6
mit Brot und Wasser: Zur Verwendung von zwei Akkusativen beim Verb כול (Pilpel) siehe Joüon §125u.
5 Komm, lass uns ziehen: So GBL: δεῦρο καὶ διέλθωμεν. MT hat לך בארץ. Die OG setzt δεῦρο/δεῦτε wie im klassischen Griechischen für den Imperativ von הלך im hortativen Sinn von „komm, komm schon“ und Formen von πορευω für den Imperativ „geh“.7 Im vorliegenden Fall deutet G also darauf hin, dass auf לך der Kohortativ ונעברה folgte, was angesichts der ersten Person Plural נמצא im Fortgang des Verses und des Infinitivs לעבר in V. 6 mehr Sinn ergibt als der MT. Die ursprüngliche Lesart war hier vermutlich נעברה(ו) לכה.8 Das würde auch erklären, wie es zum Verlust des Kohortativs durch Haplographie gekommen ist.
und keines unserer Tiere umkommen wird: Wörtlich: und die Tiere werden nicht abgeschlachtet werden von uns. Mit GL wird versuchsweise gelesen: καὶ οὐκ ἐξολοθρευθήσονται ἀφ᾽ ἡμῶν κτήνη = ולא תכרת ממנו בהמה. MT: ולוא נכרית מהבהמה, damit wir nicht einige Tiere töten [müssen]. Sowohl GL als auch GB (καὶ οὐκ ἐξολοθρευθήσονται ἀπὸ τῶν σκηνῶν [eine Textverderbnis von κτηνῶν innerhalb der griechischen Überlieferung]) deuten auf ein Passiv hin, was mehr Sinn ergibt als der MT, weil das Weideland die Tiere vor dem Hungertod bewahren wird, statt dass sie von Menschen getötet werden. תכרת wird als Nifal rekonstruiert, worauf GL ἐξολοθρευθήσονται hindeutet. Ein zweites Problem stellt das partitive מן dar. Ahab hofft darauf, dass er kein einziges Tier töten muss und nicht, dass er es vermeiden kann, einige von ihnen zu töten.9 Wiederum ist GL passender.
6 das Land: So MT (הארץ). GBL hat den Weg (τὴν ὁδὸν). Beide Lesarten sind möglich. Andererseits könnten auch beide Lesarten durch einen durch den Kontext motivierten Fehler beim Abschreiben entstanden sein; בארץ kommt im vorangegangenen Vers und דרך zwei weitere Male in V. 7 vor.10
Ahab ging in die eine Richtung: So GBL. MT + alleine (לבדו), hervorgerufen durch das später im Vers verwendete Wort.
7 unterwegs: So MT. GBL + alleine (μόνος).
(begegnete ihm) dort Elija: So MT und GL: והנה אליהו = καὶ ἰδοὺ Ἠλιου wie in Vv. 8.11. GB Elija kam (καὶ ἦλθεν Ηλιου).
er warf sich rasch nieder: Basierend auf GB: καὶ Ἀβδιου ἔσπευσεν, GL: καὶ ἔσπευσεν Ἀβδειου. MT hat ויכרהו, er erkannte ihn. Das Verb ἔσπευσεν = וימהר, er eilte [, sich niederzuwerfen] ergibt mehr Sinn (vergleiche 1 Sam 28,20) und vermeidet den Widerspruch, der im MT dadurch entsteht, dass Obadja einerseits Elija erkennt und andererseits fragt, wer er ist.11
9 dass du übergeben würdest: Dass das Partizip an dieser Stelle etwas nicht reales ausdrückt, findet sich bei Joosten, Verbal System, 279.
10 Bei Jhwh, deinem Gott: Siehe zu 17,1.
ließ er das Königreich oder Volk schwören: So MT: והשביע את־הממלכה ואת־הגוי. GBL: in ließ er das Königreich und sein Land niederbrennen spiegelt sich eine Textverderbnis von ἐνέπλησεν (<ἐμπίπλημι, „sich füllen, erfüllen“ als Übersetzung des hebräischen השביע) mit ἐνέπρησεν (<ἐμπίπρημι „brennen, entzünden“) innerhalb der griechischen Tradition.12 Diese Verderbnis ist vermutlich durch den Wechsel von „Volk“ in „Land“ hervorgerufen worden. Zur Verwendung des Imperfekts zum Ausdruck wiederholter Handlungen in der Vergangenheit siehe GesK §107e.
11 Elija ist da: So MT. Fehlt in GBL aufgrund von Haplographie (והיה … הנה). Es wird in der Wiederaufnahme in V. 14a wiederholt.
12 Aber sobald ich von dir weggehe, wird [der Geist] Jhwh[s] dich … bringen: Zur Syntax und den zwei unmittelbaren Handlungen siehe Joüon §166i. רוח könnte eine Glosse sein, um Distanz zu Gott herzustellen; meist ist das Substantiv feminin, doch das Verb ישא ist maskulin gebildet.13 Es gibt jedoch auch andere Fälle, in denen רוח maskulin ist,14 und die Textzeugen sind sich darin einig, es beizubehalten.
meiner Jugend: So MT. GBL haben seiner Jugend in Übereinstimmung mit der dritten Person. Beides ist möglich.
13 Dir wurde berichtet – das wurde es doch, mein Herr?: So MT, wo allerdings dir fehlt, der Bezug auf die zweite Person, der sich in GBL findet. Im Deutschen wird der Sinn am besten durch die zweite Person wiedergegeben.
ich hundert der Propheten Jhwhs versteckte: So MT (ואחבא מנביאי יהוה מאה איש) und GB. GL sowie die Mehrzahl der griechischen Textzeugen haben zwei Verben: Ich nahm 100 der Propheten Jhwhs zu mir und versteckte sie, in Übereinstimmung mit V. 4.
je fünfzig: Dabei deutet חמשים חמשים auf die Verteilung hin. MT + איש. Siehe zu V. 4.
in einer Höhle: Siehe zu V. 4.
15 Beim Leben: Siehe zu 17,1.
in dessen Dienst ich stehe: Siehe zu 17,1. Hier und in 2 Kön 3,14; 5,16 könnte die Wendung auch darauf abheben, dass der Prophet wie in 1 Kön 22,19; Jer 23,18.22 vor der göttlichen Ratsversammlung stand.15
16 lief Ahab: MT: ging Ahab (וילך אחאב); GBL: καὶ ἐξέδραμεν Ἀχααβ καὶ ἐπορεύθη = וירץ אחאב וילך. Die bessere Lesart lautet וירץ. Sie wurde im MT ersetzt und in G, beeinflusst durch den Anfang des Verses, mit dem prosaischeren וילך verschmolzen.
17 Hier bist du: Zur exklamatorischen Nuance der Interrogativpartikel siehe Joüon §161b.
18 Jhwh: MT hat die Gebote Jhwhs (vergleiche 19,10; 2 Kön 17,16; 2 Chr 7,19; Esra 9,10). GBL: Jhwh dein Gott.
nachgelaufen seid: Gelesen wird der Infinitiv absolutus הלוך wie von GL vorgeschlagen. MT und GB haben die zweite Person Singular, ותלך, was in Spannung zum Suffix bei בעזבכם steht. Andere Textzeugen (Syr, Vulgata, Targum) haben die zweite Person Plural, doch das erklärt die Lesart von GL nicht.16
19 Karmel: Ein dreieckiger Höhenzug, der ca. 24 km süd-südöstlich der heutigen Stadt Haifa bis zum Eingang zur Jesreel-Ebene verläuft und die Küstenebene von Akko von der von Dor trennt. Der Name bedeutet vermutlich „Weinberg-artig“, also „fruchtbar, üppig“ in Anspielung auf die reiche Vegetation.17 Vermutlich markierte er die Grenze zwischen Israel und Phönizien.18 „Berg Karmel“ (Dschebel Kurmul) bezieht sich meist auf den Felsvorsprung am Mittelmeer bei Haifa. Wie ein anderer Name für den Höhenzug – Dschebel Mar Elias (Sankt Elija) – andeutet, ist dies die Ortslage, an dem traditionell der in diesem Kapitel geschilderte Wettstreit angesiedelt wird. An den Wettstreit wird auch am El-Muhraka („der Brennende“) am südwestlichen Gipfelpunkt des Höhenzugs erinnert, wo sich seit 1883 ein Karmelitenkloster befindet. Der Felsvorsprung gilt schon sehr lange als heilige Stätte. Vermutlich ist er gemeint, wenn in ägyptischen und neuassyrischen Inschriften von der „Antilopennase“ die Rede ist; sie wird von einem Beamten Pepis I. erwähnt, einem Pharao der sechsten Dynastie (ANET 228b).19 Thutmoses III. spricht vom Rosch Qadesch, „heiligen Gipfel“ (ANET 243a), und Salmanassar III. bezeichnet ihn als Ba’li-ra’si, „Baal des Felsvorsprungs“.20 Spätere Verweise auf die Heiligkeit des Karmel in griechischen und römischen Quellen führen diese Tradition fort. Hierzu zählen Pseudo-Skylax (5.–4. Jahrhundert v. Chr.), Tacitus und Suetonius (die sich beide auf Kaiser Vespasian beziehen, ca. 69 n. Chr.) sowie Iamblichus (ca. 300 n. Chr.).21 Eine dort gefundene Weiheinschrift aus dem 2.–3. Jahrhundert n. Chr. bringt den Karmel mit dem Zeus von Heliopolis in Verbindung, dem Gott von Baalbek.22
Propheten Baals: So MT (נביאי הבעל). In GBL spiegelt sich die abwertende Bezeichnung für Baal: τοὺς προφήτας τῆς αἰσχύνης = נביאי הבשת.
Aschera: So MT. GBL haben den Plural. Hugo ist im Anschluss an Schenker der Ansicht, dass MT hier an 1 Kön 16,33; 2 Kön 13,6 angleicht, wo die Aschera in Samaria gemeint ist.23 Doch die Aschera in 16,33 ist eher ein Kultobjekt als eine Gottheit wie an den anderen beiden Stellen.
20 So sandte Ahab Boten aus und sammelte ganz Israel am Karmel: White rekonstruiert folgendermaßen: וישלח אחאב ויקבץ את־כל־ישראל אל־הר הכרמל.24 MT zufolge lässt Ahab nach ganz Israel aussenden (בכל־בני ישראל), um die Propheten Baals herzubeordern, die schon da sind (V. 22) und ihr Quartier in Jesreel aufgeschlagen haben (V. 19).
21 Wie lange willst du noch an zwei Krücken hinken?: So MT (עד־מתי אתם פסחים על־שתי הסעפים). GBL haben ἕως πότε ὑμεῖς χωλανεῖτε ἐπ᾽ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις = Wie lange willst du auf [GL und VL: deinen] beiden Knien hinken? Die genaue Bedeutung dieser Frage ist nicht klar, weil das Verb mehrdeutig ist und das Substantiv mit „Meinungen“ übersetzt wird. פסח wird in der Bibel in zwei Bedeutungen verwendet, die sich auf zwei ursprünglich getrennte Wurzeln zurückführen lassen (vergleiche BDB 820 und HALAT 893): (1) „überspringen, vorbeigehen“, was der Ursprung des oder ein Wortspiel mit dem Namen des Passafestes ist (Ex 12,13.23.27) und deshalb „verschonen“ bedeuten kann (Jes 31,5); (2) eine Ableitung vom Substantiv „Lahmer“, פסח (vgl. 2 Sam 4,4, Nifal), mit der Bedeutung „hinken“ (1 Kön 18,26, Piel).25 Im letztgenannten Vers bezeichnet oder parodiert das Verb den rituellen Tanz der Propheten Baals. Dabei ist nicht klar, ob das Verb in V. 21 die Bedeutung „hüpfen“ oder „hinken“ besitzt. Der andere Hauptteil der Frage, das Substantiv סעפים, ist ein Hapaxlegomenon. Es stammt von einer Wurzel mit der Bedeutung „spalten, teilen“ und könnte sich deshalb auf gespaltene bzw. geteilte Felsen, Wege, Ansichten oder Äste und deshalb Krücken beziehen. Das hier entworfene Bild könnte deshalb das eines Vogels oder Tieres sein, das zwischen Zweigen oder Klüften hin- und herspringt, das eines an Krücken humpelnden Menschen oder aber von jemandem, der zwischen Wegen hin- und herwechselt. Es könnte sich aber auch um eine Redewendung handeln, bei der es darum geht, dass man seine Ansicht oder Meinung ändert. Die Übersetzung lehnt sich hier versuchsweise an Thiel an, der anführt, dass der Schlüssel zum Verständnis des Ausdrucks die Zahl „zwei“ ist.26 Üblicherweise ging man an einer einzelnen Krücke; so könnte der Versuch, stattdessen und statt auf eigenen Beinen an zwei Krücken zu gehen, zum Stolpern und Fallen geführt haben. Deshalb stellt das Hinken an zwei Krücken eine Metapher für Instabilität dar.
gab keinerlei Antwort: So GBL. MT + ihm.
22 450 Propheten Baals: So MT. GBL + und 400 Propheten der Aschera, im Rückgriff auf V. 19.
23 einen: So GBL: (τὸν ἕνα). MT: einen Stier.
den anderen Stier: So GBL: τὸν βοῦν τὸν ἄλλον = הפר האחר. MT hat הפר האחד aufgrund der Verwechslung ähnlich aussehender Buchstaben. MT fügt noch und ihn auf das Holz legen hinzu, was eine Erweiterung ausgehend von Elijas vorangegangenen Anweisungen ist.
24 den Namen Jhwhs: So MT. GBL + meines Gottes. VL lässt den Gottesnamen aus und liest meines Gottes, was darauf hindeutet, dass Jhwh und meines Gottes alte Varianten sind.
der Gott, der antwortet: So MT und GB. GL und VL + heute (σήμερον).
wirklich Gott: So MT mit dem Artikel (הוא האלהים).
Das ist eine gute Idee: Wörtlich: „das Wort ist gut“. So MT: טוב הדבר. GBL + das du gesagt hast.
25 Baals: So MT. GBL: des Gräuels (τῆς αἰσχύνης = הבשת).
Sucht euch einen Stier aus und richtet ihn zuerst her: Die Passage denn ihr seid diejenigen, die am zahlreichsten sind (IBHSy, 248) ist an unterschiedlichen Stellen überliefert; GL und VL haben es nach euch, während MT und GB es nach zuerst setzen. Das deutet darauf hin, dass es sich hier um eine Glosse handelt, durch welche die Anzahl der Gegner Elijas hervorgehoben werden soll.
26–29 VL überliefert in diesen Versen unter Beibehaltung von OG einen ursprünglicheren Text als MT.27 Insbesondere trennt VL – anders als MT – die Handlung nicht in zwei unterschiedliche Bewegungen, die vor und nach dem Mittag stattfinden, sondern schildert einen einzigen zeitlichen Bogen von dem zeitlich nicht festgelegten Beginn des Wettstreits bis zur Zeit des abendlichen Opfers.
26 nahmen sie den Stier: So GBL und VL. MT + den man ihnen gegeben hatte.
riefen sie den Namen Baals an: So GL und OL. MT und GB + vom Morgen bis zum Mittag in Vorwegnahme der Erwähnung des Mittags in V. 29.
Oh Baal, antworte uns: So MT. GBL und VL: Antworte uns, oh Baal, antworte uns.
niemand antwortete: MT und GB + dann hinkten sie um den Altar herum, den sie gemacht hatten. Fehlt in VL und passt aus anderen Gründen nicht.28 Das Verb פסח wird hier in anderer Bedeutung verwendet als in V. 21. Dort bezieht es sich auf das Hin- und Herschwanken zwischen Jhwh und Baal, hier dagegen beschreibt es den kultischen Tanz der Propheten Baals. Darüber hinaus ergibt das Verb עשׂה im Singular hier kaum Sinn; es stimmt mit dem נתן der Glosse oder Erweiterung weiter vorne im Vers überein, wo es sich selbstverständlich auf Elija bezieht. Die griechischen Textzeugen G und das Sebir des MT lösen das Problem, indem sie den Plural עשו lesen, doch der Satz ist höchstwahrscheinlich eine spätere Entfaltung von פסח, die ein Wortspiel darstellt und der Beschreibung der Propheten Baals etwas mehr Farbe verleiht. Die Verspottung durch Elija im nächsten Vers zielt darauf, dass die Propheten Baal anrufen, ohne eine Antwort zu erhalten, aber sie bezieht sich nicht auf ihr Herumhüpfen um den Altar.
27 Elija verspottete sie: Voran steht in MT und GBL mittags. Diese Notiz, durch welche die Erzählung im MT in zwei Abschnitte geteilt wird – vormittags und nachmittags –, fehlt in VL und gehört zu einer Erweiterung, die in MT bezeugt ist und als Rezension auch in den griechischen Textzeugen.29 In OG wird der Titel Elijas erweitert und der Tischbiter gelesen (so GBL und VL). Das Verb ויהתל ist eine sekundäre Bildung von der Wurzel תלל (BDB 251; HALAT 247), die eine Täuschung bezeichnet; demnach hätte Elija die Propheten Baals zu der Annahme verleitet, er würde wirklich denken, dass Baal Gott sei.30
indem er sagte: So MT und GB (ויאמר = καὶ εἶπεν). GL und VL: καὶ προσέθετο λέγων = ויסף לאמר = wiederum sagte.
Ruft lauter: Zu dieser Übersetzung als Komparativ siehe IBHSy, 264; Joüon §102g.
vielleicht ist er verhindert, oder vielleicht schläft er und muss aufgeweckt werden: Gelesen wird אולי שׂיג הוא אולי ישן הוא ויקץ. Dies ist die Vorlage der OG-Lesart, wie sie Trebolle auf der Grundlage von VL rekonstruiert.31 Er schlägt vor, dass MT mit כי־אלהים הוא כי שיח לו eine Variante dieser Lesart stützt und dass der vorliegende Text eine Kombination dieser beiden Varianten darstellt. Meine eigene Rekonstruktion der hinter MT stehenden Entwicklungen sieht etwas anders aus. Wie Trebolle notiert, ist die Wendung וכי־דרך לו sekundär; sie findet sich im MT, aber nicht in den griechischen Textzeugen. Gleiches gilt vermutlich für כי־אלהים הוא, das MT und GB ebenfalls bezeugen, nicht aber GL. Das Wort שיח ist eine Glosse zu שיג, einem Hapaxlegomenon. Die Glosse wird erstmals im MT hinzugesetzt, und auf sie folgen die zwei Hinzufügungen. Die Etymologie von שיג verweist auf die Bedeutung „weggehen, beiseite gehen“ oder „Ausscheidung, Stuhlgang“ (HALAT 1229). Auch שיח kann sich auf Stuhlgang oder Urinieren beziehen;32 diese Bedeutung scheint die Glosse klären zu wollen. Womöglich soll שיח ursprünglich das Nachsinnen Baals bezeichnen, so jedenfalls viele moderne Kommentatoren und Übersetzungen (vgl. 2 Kön 9,11). Doch der Bezug auf Körperfunktionen passt gut zu Elijas Verspottung seiner Gegner und ihres Gottes. Dieses Verständnis reicht mindestens bis zum Targum Jonathan zurück, das seinen eigenen Euphemismus verwendet und vielleicht auch Rashi beeinflusst haben könnte.33
28 ihrem Brauch gemäß: So MT und GL. Es fehlt in GB, vermutlich aufgrund einer Haplographie, die auf die Ähnlichkeit von כ und ב zurückgeht.
29 Sie waren immer noch in Ekstase, als die Mittagszeit vorbei war: Gelesen wird ויתנבאו עד אשׁר עבר הצהרים mit GL: καὶ ἐπροφήτευσαν ἕως οὗ παρῆλθε τὸ μεσημβρινὸν. MT hat ebenfalls diese zeitliche Ansetzung der Ereignisse (wie VL), wobei die Satzteile umgekehrt angeordnet sind: ויהי כעבר הצהרים ויתנבאו. GB stimmt im Wesentlichen mit GL überein, wobei allerdings abends (הערב) statt Mittagszeit (הצהרים) steht, was vermutlich eine Verschreibung von ערב anstelle von צהרים ist, motiviert durch עבר.
Als dann zur Zeit des Opferns immer noch keine Stimme war, sagte Elija zu den Propheten Baals: „Tretet nun zur Seite, und ich werde mein Opfer herrichten.“ Also traten sie zur Seite, aus dem Weg: In MT gibt es eine lange Haplographie, die durch die Wiederholung von sagte Elija an dieser Stelle und zu Beginn von V. 30 hervorgerufen wurde. Die Haplographie hat in der Folge beim MT zu einer Veränderung des Wortlauts und dessen Erweiterung am Ende zu ואין־ענה ואין קשב geführt.34 Mehr dazu siehe auch unten zu Vv. 30–32.
30 zum Volk: So GBL. MT: zum ganzen Volk.
kam näher hin zu ihm: MT + und er richtete den Altar Jhwhs wieder her, der niedergerissen worden war. Siehe zu V. 32.
31 Anzahl der Stämme: So MT und GB. GL: Anzahl der zwölf Stämme.
Israels: So GBL. MT: der Söhne Jakobs.
Jhwh gesagt hatte: So GBL: ἐλάλησεν κύριος; MT: das Wort Jhwhs kam (היה דבר יהוה).
32 er verbaute die Steine: So GL und VL. MT bzw. GB lesen er baute aus den Steinen einen Altar im Namen Jhwhs35 und er verbaute die Steine im Namen Jhwhs. Alle drei Lesarten betten die Interpolation in Vv. 31–32a ein (dazu siehe unten). Ich übernehme die kürzeste Lesart. בנה mit der Bezeichnung eines Materials als Objekt ist sonst nur 1 Kön 15,22 = 2 Chr 16,6 anzutreffen. Die längere Form ויבנה (statt ויבן) kommt in den Königebüchern häufig vor und scheint einem Guttural vorgezogen worden zu sein (10,29; 16,25; 2 Kön 3,2; 13,11).36
richtete den Altar Jhwhs wieder her, der niedergerissen worden war: MT hat diese Lesart am Ende von V. 30, während GBL sie an dieser Stelle nach V. 32a platzieren. In GB ist die Wendung Jhwhs aus stilistischen Gründen weggelassen, weil der Gottesname bereits in V. 32a vorgekommen ist.37 Die unterschiedlichen Platzierungen gehen auf den Einschub von Vv. 31–32a zurück, den MT hinter den Satz stellt, GBL jedoch vor ihn. Dem Einschub zufolge hat Elija einen neuen Altar gebaut, was in direktem Widerspruch zur Aussage steht, dass er einen vorhandenen Altar wieder hergerichtet hat.38 Zur Verwendung von רפא „heilen“ für das Reparieren unbelebter Objekte siehe Jer 19,11. Neh 3,34 bezieht sich ebenfalls auf das Erwecken von Steinen – vermutlich eines Altars – zu neuem Leben (√חיה).
Graben: So MT (תעלה) hier sowie in Vv. 35.38, wo es in GL transkribiert wird (θααλα). GB hat an allen drei Stellen Formen von θαλασσα („See“).
33 Er schichtete das Holz auf den Altar und zerteilte den Stier, den er auf das Holz legte: Gelesen wird ויערך את־העצים על המזבח וינתח את־הפר וישם על־העצים. Dies ist die Lesart des MT zuzüglich der Wendung auf den Altar. GBL haben eine längere Lesart: er schichtete das Holz auf den Altar, den er gemacht hatte, und zerteilte das Brandopfer und legte [es] auf das Holz und schichtete [es] auf den Altar. MT erscheint angesichts der fehlenden Erwähnung des Altars unvollständig. In G scheint den er gemacht hatte eine Erweiterung zu sein, und die Schlussformulierung (schichtete [es] auf den Altar) ist eine Wiederholung und fehl am Platze. Hat man dies jedoch erst einmal korrigiert, besteht der einzige signifikante Unterschied zwischen den Lesarten in Stier/Brandopfer, was antike Varianten sein könnten.
34 Füllt: So MT. GBL: Bringt mir (λάβετέ μοι = קחו לי).
vier Krüge: So MT und GB. GL: zwei Krüge, wahrscheinlich beeinflusst durch „ein zweites Mal“ im weiteren Verlauf des Verses. Näheres zu כד siehe zu 17,12.
auf das Opfer und das Holz: So MT. In GL steht auf den Altar voran; bei GB folgt so machten sie es.
35 er füllte auch den Graben mit Wasser: So MT und GL. GB hat eine pluralische Verbform, in Anlehnung an die Pluralformen des vorangegangenen Verses.
36 Dann rief Elija zum Himmel: So GBL. MT weist eine deutlich andere Lesart auf: zur Zeit des Opferns trat der Prophet Elija heran. Letzteres wirft viele Probleme auf, was darauf hindeutet, dass es sich um eine an die falsche Stelle gesetzte Glosse handelt: Der Zeitpunkt des Opferns wurde bereits genannt und liegt in der Vergangenheit (V. 29); der Titel Prophet wird für Elija in diesen Erzählungen an keiner anderen Stelle verwendet (siehe jedoch 19,16); und das Verb trat heran scheint hier deplatziert zu sein; an wen oder was ist er herangetreten?
36–37 antworte mir, Jhwh, antworte mir heute mit Feuer, damit dieses Volk erkennen kann, dass du, Jhwh, Gott bist in Israel, und dass ich dein Diener bin, der dies durch dich getan hat, und dass du ihre Herzen umgewendet hast: So GL und VL:39 ἐπάκουσόν μου κύριε ἐπάκουσόν μου σήμερον ἐν πυρί καὶ γνώτω πᾶς ὁ λαὸς οὗτος ὅτι σὺ εἶ μόνος κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ καὶ ἐγὼ δοῦλός σὸς καὶ διὰ σὲ πεποίηκα ταῦτα πάντα καὶ σὺ ἔστρεψας τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ τούτου ὀπίσω σου sowie exaudi me, domine, exaudi me hodie in igne ut sciant omnis populous hic quoniam tu es dominus deus Israel et ego servis tuus et propter te feci haec opera et tu versasti cor populi huius retro. MT gibt die beiden Hauptsätze in Vv. 36–37 in umgekehrter Reihenfolge wieder: lass verlauten, dass du Gott bist in Israel und ich dein Diener bin, und dass ich durch dein Schwert all dies getan habe. Antworte mir, Jhwh, antworte mir, damit dieses Volk erkennen kann, dass du, Jhwh, Gott bist und ihre Herzen umgewendet hast. GB ist länger, weil sich in V. 37 die Wiedergabe des MT spiegelt: Antworte mir, Jhwh, antworte mir heute mit Feuer, damit dieses ganze Volk erkennen kann, dass du, Jhwh, der Gott Israels bist und ich dein Diener bin und ich dies durch dich getan habe. Antworte mir, Jhwh, antworte mir, damit dieses Volk erkennen kann, dass du, Jhwh, Gott bist und das Herz dieses Volkes umgewendet hast. Die Lesart des MT deutet auf kleinere Erweiterungen des OG an zwei Stellen hin: dieses Volk im Unterschied zu dieses ganze Volk sowie ihr Herz statt das Herz dieses Volkes. Demgegenüber erweitern MT und GL geringfügig, wenn sie all dies lesen. Die textlichen Schwierigkeiten dieses Verses gehen teilweise auf die Textpassage und ich dein Diener bin und ich dies durch dich getan habe zurück, die eine spätere Glosse ist.
38 Feuer Jhwhs: So MT. GBL + vom Himmel.
verzehrte das Opfer und das Holz und leckte das Wasser auf, das auf ihnen war und das Wasser, das im Graben war: ותאכל את־העלה ואת־העצים ואת־המים אשר עליהם והמים אשר־בתעלה לחכה. MT: verzehrte das Opfer und das Holz und die Steine und den Staub und leckte das Wasser auf, das im Graben war. GBL: verzehrte das Opfer und das Holz und das Wasser, das [L: auf ihnen war und das Wasser, das] im Graben war und auf den Steinen war, und das Feuer leckte die Steine und den Staub auf. Die unterschiedliche Platzierung von die Steine und den Staub deutet darauf hin, dass diese Worte eine Erweiterung darstellen.40 MT deutet die Steine und den Staub als Objekte von תאכל, während GB sie als Objekte des später folgenden Verbs leckte versteht.41 Darüber hinaus weist GL auf die Haplographie der Wendung עליהם והמים אשר hin.
39 Dann fiel das ganze Volk auf sein Gesicht: So GBL. MT: Als das ganze Volk das sah, fielen sie auf ihr Gesicht.
Jhwh ist es, der Gott ist; er ist Gott: Alle wichtigen Textzeugen scheinen hier Erweiterungen vorzunehmen. MT: Jhwh ist Gott, Jhwh ist Gott. GBL: Wahrlich, Jhwh ist Gott, er ist Gott. Wenn die Lesart von G von Dtn 7,9 beeinflusst wäre, wie manchmal angenommen wird, würde man das Suffix erwarten: „Jhwh ist unser Gott, er ist Gott“.
40 Elija sagte zu ihnen: So MT. GBL: Elija sagte zum Volk. Beide Lesarten sind möglich.
Wadi Kischon: Der Nahr el-Muqaṭṭa ist heute der gleichnamige Wasserlauf; er fließt am nordöstlichen Rand des Karmel entlang und mündet östlich von Haifa ins Mittelmeer; in der Debora-Erzählung (Ri 4,7.13; 5,21) und in Ps 83,10 wird auf ihn Bezug genommen.42
41 ich höre: Zu dieser Übersetzung von קול + Genitiv siehe Joüon, §162e.
starkem Regen: Wörtlich: „das Tosen des Regens“, so MT (המון הגשם). GBL: τῶν ποδῶν τοῦ ὑετοῦ, das Nähern (wörtl. „Füße“) des Regens.
42 auf den Karmel: So GBL. MT: auf den Gipfel des Karmel.
beugte sich: Das Verb גהר kommt in der HB dreimal vor, nämlich hier sowie in 2 Kön 4,34–35 im Kontext von Elischas Auferweckung des Sohnes der Frau von Schunem. Meist wird das Wort mit „beugen, sich ducken“ übersetzt. Smith hat eine neue Deutung des Wortes vorgeschlagen, und zwar ausgehend von seinem mutmaßlichen Vorkommen in einer ugaritischen Beschwörung (KTU 1.178.11).43 Er nimmt an, dass das Wort die Bedeutung „erklingen lassen“ oder „laut sein (eine laute Stimme haben)“ hat und schlägt vor, dass Elija das Geräusch des herannahenden Gewitterregens nachahmt. Der Gedanke hat seinen Reiz, doch den nächsten Satz vermag er nicht zu erklären. Dann müsste Elijas Legen seines Kopfes zwischen seine Knie ebenfalls nachahmend gemeint sein. Es scheint גהר zu erklären und vielleicht für eine Wolke zu stehen. Falls dem so wäre, würde man erwarten, dass das Geräusch des Regens auf die Wolkenbildung folgt, nicht aber ihr vorangeht. Siehe zu 2 Kön 4,34–35.
seine Knie: MT Ketib: sein Knie.
43–44 „Geh siebenmal zurück und blick“. Also ging der Diener siebenmal zurück: So GL. In GB spiegelt sich eine Dittographie: Und geh siebenmal zurück; und geh zurück siebenmal. Also ging der Diener siebenmal zurück. MT hat die Haplographie: Geh zurück siebenmal.
44 war dort eine kleine Wolke: So GBL. MT: er sagte, „Dort ist eine kleine Wolke …“.
die von Westen heraufkam: So MT: עלה מים. GBL: ἀνάγουσα ὕδωρ = מעלה מים, Wasser heraufbringend; VL ist mit der Wiedergabe von „Wasser vom Meer heraufbringend“ (מעלה מים מים) eine Dittographie. MT ist zu bevorzugen, weil alleine Elija davon weiß, dass die Wolke Regen bringen wird.
Spanne [deinen Streitwagen] an: So MT: אסר. GBL: ζεῦξον τὸ ἅρμα σου = אסר רכבך. Vgl. 2 Kön 9,21.
bevor der Regen dich aufhält: Die Vokalisierung des Verbs יַעַצָרְכָה im Codex Leningradensis lässt sich nicht erklären; anders dagegen יַעֲצָרְכָה in anderen Handschriften. Das längere Suffix bei -kh statt -k ist im MT relativ selten (vgl. Gen 10,19; 27,7), aber typisch für die Orthographie der späten Nachexilszeit.44
45 Augenblicklich: עד־כה kommt in Ex 7,16 und Jos 17,14 vor, wo es „bis jetzt, bislang“ bedeutet. Die Wiederholung vermittelt den Eindruck der Unmittelbarkeit, d. h. „zwischen einem Augenblick und dem nächsten“ oder „just in diesem Augenblick“.45
Ahab bestieg seinen Streitwagen und fuhr nach Jesreel: So MT: וירכב אחאב וילך יזרעאלה. GL: καὶ ἔκλαιε καὶ ἐπορεύετο Αχααβ εἰς Ιεζραελ = Ahab weinte und ging nach Jesreel. GB hat mit ἔκλαεν eine fehlerhafte Schreibweise für ἔκλαιεν = ויבך,46 was seinerseits eine fehlerhafte Schreibweise von וירכב ist.47 Das Verb רכב bezieht sich auf den Akt des Besteigens und auf das symbolische Sitzen auf einem königlichen Tier oder Transportmittel.48 Insofern ist der Streitwagen bereits im Verb impliziert.
46 er gürtete: Das hier im Piel verwendete Verb שנס ist in der HB ein Hapaxlegomenon. Allerdings kommt es im Ugaritischen (KTU 1.3.2.11–13) in der Beschreibung Anats als Kriegerin vor:
| ‛tkt rišt lbmth | Sie befestigt Köpfe an ihrem Oberkörper; |
| šnst kpt bḥšh | sie sichert Hände an ihrem Gürtel. |
Es hat in Kombination mit מתנים „Lenden“ die gleiche Funktion wie חגר (2 Kön 4,29; 9,1). Der Ausdruck geht wohl ursprünglich darauf zurück, dass ein Obergewand um die Hüfte oder Lenden herum befestigt wird, damit die Beine für größere körperliche Anstrengungen frei sind;49 es wird vor allem in militärischen Kontexten verwendet. Elija bereitet sich darauf vor, loszulaufen.
nach Jesreel: So GB (εἰς Ισραηλ) = יזרעאלה.50 GL: ἕως Ιεζραελ. MT hat eine Erweiterung: עד־באכה יזרעאלה.