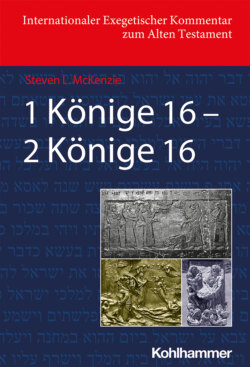Читать книгу 1 Könige 16 - 2 Könige 16 - Steve McKenzie - Страница 48
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Synchrone Analyse
ОглавлениеDie drei Geschichten des Kapitels und ihre gemeinsamen Motive Kapitel 17 umfasst drei Geschichten, die auf die Einleitung in V. 1 folgen (Vv. 2–7, 8–16, 17–24). Jede von ihnen ist literarisch eigenständig; jede beginnt mit einer Krise und baut dann Spannung auf, bis die Krise bewältigt ist.34 Zugleich sind die Geschichten aber auch miteinander verbunden. In ihnen entwickelt sich Elija von einer passiven Figur, um die sich Jhwh kümmert (Vv. 2–7), zu einer Figur, der die Witwe hilft, die sich um ihn kümmern soll (Vv. 8–16), und dann zu einem aktiven Charakter, der Verantwortung für den toten Sohn der Witwe übernimmt und Jhwh mit Nachdruck darum bittet, den Jungen wiederzubeleben (Vv. 17–24). Die drei Geschichten haben das Thema der Dürre gemeinsam, das in V. 1 angekündigt wird, sowie auch das Wort Jhwhs. Gerahmt wird das Kapitel durch Verweise auf Elijas Wort und Mund (V. 1) und Jhwhs Wort in Elijas Mund (V. 24), wodurch beide gleichgesetzt werden und die Autorität und Legitimität des Propheten als Vertreter und Sprecher Jhwhs bekräftigt wird. Zusammen mit dem Motiv von „Auftrag und Ausführung“, bei dem eine Figur eine Anweisung gibt oder eine Bitte äußert und eine andere Figur diese en détail ausführt (Vv. 3–5, 9–10, 10–15, 21–22), durchzieht das Motiv des Wortes Jhwhs die Vv. 1–16.35 Das Motiv des Wortes Jhwhs So wird in Elijas Wort in V. 1 ein von Jhwh geleisteter Schwur erwähnt. In Vers 2 wird das Wort Jhwhs eingeführt, in Vv. 3–4 davon erzählt und in Vv. 5–6 seine Erfüllung geschildert. In Vers 7 erfüllt sich das Elija-Wort über die Dürre aus V. 1. Vers 8 führt das neue Wort Jhwhs ein, das in V. 9 folgt. Vers 10 stellt dessen Erfüllung dar. In Vv. 11–15 findet sich ein komplexer Fall des Motivs von Auftrag und Ausführung , wobei Elija und die Witwe involviert sind und ein Wort Jhwhs (V. 14) vorkommt. In Vers 16 begegnet die Erfüllungsnotiz für das Wort Jhwhs aus V. 14. In den Versen 17–24 steht das Motiv nicht so stark im Vordergrund, auch wenn sich in den Versen 21–22 MT ein komplizierter Fall des Motivs von Auftrag und Ausführung findet. Die Verse führen zum Bekenntnis der Witwe in V. 24, wonach das Wort Jhwhs wirklich mit Elija ist. In dieser Weise macht das beeindruckende Fazit in V. 24 deutlich, dass das Motiv hier nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ vertreten ist.
17,1: Die Figur Elija Die Geschichten über Elija beginnen plötzlich, ohne dass vorher etwas vorweggenommen oder angekündigt worden wäre (V. 1). Das gilt auch für die Figur des Propheten. Er erscheint und verschwindet ohne vorherige Hinweise oder Warnungen (18,10–12). Wie die Figur, so wirkt auch die Geschichte störend. Gerade erst wurde Ahab vorgestellt, und schon betritt Elija die Bühne, und die Erzählung nimmt eine andere Wendung und widmet sich nun gänzlich dem Propheten. Vers 1 ist für den gesamten Elijastoff ein „Ankerpunkt für verschiedene Stränge narrativer Spannung“, wozu die Bestrafung Ahabs, Elijas Beziehung zu Jhwh, die Dürre und die Quelle von Elijas Autorität gehören.36 Elija wird schlicht als „der Tischbiter“ vorgestellt. Diese Bezeichnung wird in den Königebüchern fünf weitere Male wiederholt (1 Kön 17,1; 21,17.28; 2 Kön 1,3.8; 9,36). Dass die Bedeutung des Titels nicht ganz sicher ist, passt zum Träger des Epithetons. Wahrscheinlich ist Tischbe ein Ort, doch seine Lage ist nicht bekannt. Es könnte sich auch um eine Clan-Bezeichnung handeln. Alles an Elija ist etwas undurchsichtig – weder sein Hintergrund, sein Titel, sein Beruf oder seine Legitimation werden klargelegt. Auch sein Name könnte symbolisch auf seine Rolle eines Streiters für Jhwh hindeuten. Das Fehlen präziser Informationen charakterisiert ihn als einen Mann, den das Geheimnis Gottes umgibt. Dennoch wird den Lesenden in 17,1 alles mitgeteilt, was sie wissen müssen. Aus dem Namen „Jhwh ist mein Gott“ geht eindeutig hervor, wofür Elija steht. Er ist streitlustig und aufmüpfig. Er wendet sich an Ahab, ohne dessen Titel zu nennen oder seinen Rang als König anzuerkennen. Er stellt sich selbst als Diener Jhwhs („in dessen Dienst ich stehe“) dar. In dieser Aussage schwingt mehr mit als nur eine Zugehörigkeit oder ein Beruf. Durch sie wird Elijas Botschaft mit der Autorität Jhwhs versehen. Elija ist der Stellvertreter Jhwhs. Sein Schwur beim Leben Jhwhs stellt von vornherein klar, dass die von ihm vorgebrachten Fragen nicht verhandelbar sind. Das weist auf den Gegensatz hin zwischen Jhwh, dessen Leben konstant ist, und Baal, dem sterbenden und auferstehenden Gott. Jhwh hält den Regen zurück, um Ahab und Israel wieder zu sich zurückzubringen, wie Kap. 18 zeigen wird. Jhwhs Macht ist es, durch die es bis auf weiteres nicht mehr regnen wird, und durch das Wort Elijas als des Stellvertreters Jhwhs wird der Regen dann wieder gewährt.
Die Dürre als Gerichtshandeln über Ahab Elijas schwer fassbarer Hintergrund und sein Rang als Stellvertreter Jhwhs übermitteln eine starke sozio-ökonomische Botschaft. Der von nirgendwo stammende Niemand wird, weil er der Stellvertreter Jhwhs ist, in seinem Rang über den König erhoben. Elija richtet den König, und zwar in der Weise, dass der König dadurch seiner Macht und Bedeutung weitgehend beraubt wird. „Weder Tau noch Regen“ bedeutet Dürre. Das ist eine direkte Kampfansage an die Vorstellung, dass Baal über die Fruchtbarkeit gebieten würde, und insofern auch an den Glauben Isebels und Ahabs. Wie lange die Dürre andauern soll, wird nicht enthüllt. Erst am Ende des nächsten Kapitels wird es verraten, nachdem Baal beim Wettstreit am Karmel entscheidend geschlagen ist. Vorerst wird nur gesagt, dass die Dürre jahrelang dauern wird. Es ist eine lange und schwere Dürre mit verheerenden Folgen für die Landwirtschaft, das Vieh und die Wirtschaft des Landes. Schuld an der Dürre ist Ahab; sie ist die Strafe für seine vielen Sünden. Er ist machtlos und kann nichts gegen die Dürre tun. Die Macht liegt bei Elija. Von daher wird in 17,1 die Suche Ahabs nach Elija zu Beginn von Kap. 18 vorbereitet. Deshalb ist der flüchtige Blick in 17,1 eine einprägsame und aufschlussreiche Momentaufnahme vom Propheten und Gottesmann, auch wenn im Vers selbst von solchen Titeln nicht die Rede ist.
17,2–3: Elija versteckt sich im Wadi Kerit Die Wortereignisformel, durch die in V. 2 Jhwhs Wort an Elija angekündigt wird, bestätigt erneut Elijas Rang als Diener und Stellvertreter Jhwhs. Es ist eine Standardformel bei prophetischen Offenbarungen und bestätigt die prophetische Identität Elijas, die in V. 1 angedeutet wurde. Jhwh befiehlt Elija, zum Wadi Kerit zu gehen (V. 3). Wenn „Kerit“ vom Verb mit der Bedeutung „ein Festmahl geben“ abzuleiten ist (siehe die Anmerkung), dann wird hier die Unterstützung Elijas durch die Raben (Vv. 4.6) vorbereitet. Daneben ähnelt der Name dem Verb hakrît, das in 18,4 für Isebels „Abschlachten“ der Jhwh-Propheten verwendet wird sowie in 18,5 für Ahabs Hoffnung, dass die Tiere nicht „abgeschlachtet“ werden müssen. Elija versteckt sich im Wadi Kerit und verhindert dadurch, dass er durch Isebel „abgeschlachtet“ wird. Er wird von Tieren (Raben) versorgt, und sein Ruf nach Regen am Ende von Kap. 18 wird verhindern, dass andere Tiere aufgrund der Dürre „abgeschlachtet“ werden. Die Episode zeigt unmittelbar, dass Jhwh sich um seine Schöpfung sorgt und über sie herrscht.
Wo das Wadi Kerit zu lokalisieren ist, lässt sich nicht sagen, außer dass es sich in der Nähe des Jordans befinden muss. Da Elija nach Osten gehen soll, ist hier vermutlich daran gedacht, dass das Wadi östlich des Jordans liegt. Damit würde sich Elija außerhalb von Ahabs unmittelbarem Zuständigkeitsbereich bewegen, was gut dazu passen würde, dass Jhwh ihm befiehlt, sich hier zu verstecken. Doch warum versteckt sich Elija? Die Anspielung auf 18,4 deutet darauf hin, dass er in das Wadi flieht, um Schutz zu suchen vor Isebel und vielleicht auch vor Ahab, in deren Augen er für die Dürre verantwortlich ist.37 Eine andere Möglichkeit läge in der Suche Ahabs nach Elija in Kap. 18. Vielleicht flieht Elija nicht, um sich selbst zu schützen, sondern um in der sich verschlimmernden Dürre nicht greifbar zu sein. Das würde auch dazu passen, dass sich Elija als Figur schwer fassen lässt.
17,4–6: Elija und die Raben Sowohl Elija als auch die Raben leisten den Anordnungen Jhwhs Folge. Elija geht zum Wadi Kerit, wo sich die Raben um ihn kümmern. Die Sequenz weist eine ausgeklügelte Reihe von Beispielen für das Motiv von Auftrag und Ausführung innerhalb des Motivs des Jhwh-Wortes auf. Die Konstruktion mit vorangestelltem Subjekt und die Verwendung des Perfekts (צויתי) in V. 4 führen zu einer chiastischen Anordnung von Auftrag und Ausführungen:
Jhwh beauftragt die Raben damit, sich um Elija zu kümmern
Jhwh beauftragt Elija, zum Wadi Kerit zu gehen
Elija geht zum Wadi Kerit
Die Raben sorgen für Elija
Elija bekommt zweimal täglich Fleisch (V. 6), was mehr ist als das, was die Israeliten in der Wüste (Ex 16; Num 11) erhalten haben. Hier zeigt sich eine der vielen impliziten Gemeinsamkeiten zwischen Elija und Mose in diesen Geschichten.38 In der Erzählung wird so die theologische Botschaft unterstrichen, dass Jhwh über die Naturgewalten gebietet und imstande ist, sein Volk – auch durch aufwendige Maßnahmen – inmitten von Dürre und Elend am Leben zu erhalten.
17,7: Die Verbindung zwischen den ersten beiden Geschichten Elija bleibt im Wadi Kerit, bis auch dies aufgrund des fehlenden Regens austrocknet (V. 7). „Regen“ (geschem) bezieht sich hier immer auf die starken Winterniederschläge, die auf das Jahr gesehen meist am umfangreichsten sind, oder auf Regen im Allgemeinen. In jedem Fall führt die Austrocknung des Wadis aufgrund des Fehlens dieser Niederschläge vor Augen, wie schlimm die Dürre ist. Die Masoreten haben V. 7 als Abschluss der ersten Geschichte angesehen und sie deshalb mit der Setuma (ס) nach dem Vers markiert. Diese Teilung wird in der heutigen Forschung gelegentlich infrage gestellt; hier wird V. 7 eher als Beginn der nächsten Geschichte betrachtet.39 Für die Unterteilung der Masoreten spricht, dass V. 8 und V. 2 sich entsprechen.40 Dabei dient die Wortereignisformel der Strukturierung. Wie in V. 2 Elijas Gang zum Wadi Kerit und die erste Geschichte eingeleitet wird, so wird in V. 8 Elijas Gang nach Phönizien für die zweite Geschichte eingeführt. Zugleich erfüllt V. 7 eine doppelte Aufgabe; er fungiert als Abschluss von Vv. 2–7 und als Einleitung zu Vv. 8–16. Er verbindet die beiden Geschichten dadurch, dass der Wassermangel im Wadi Elija den Anlass bietet, es zu verlassen und anderswo hinzugehen. Diese Funktion als Bindeglied wird in der Übersetzung dadurch hervorgehoben, dass V. 7 als Temporalsatz wiedergegeben wird.
17,8–16: Die Witwe von Sarepta In der zweiten Geschichte initiiert Jhwh – wie bereits in der ersten Geschichte – die Handlung durch einen Auftrag an Elija, sich an einen anderen Ort zu begeben: Steh auf, geh nach Sarepta. Elija setzt dies wortwörtlich (er stand auf und ging nach Sarepta, V. 10) und in Übereinstimmung mit dem Motiv von Auftrag und Ausführung um. Auch wenn dies im Text nicht ausdrücklich erwähnt wird, sollen die Lesenden annehmen, dass die Dürre Phönizien erreicht hat und der Grund dafür ist, dass die Witwe und ihr Sohn dem Tode nah sind. Dass auch Phönizien von der Dürre betroffen ist, zeigt, dass sich Jhwhs Herrschaft auch über die Grenzen Israels hinaus erstreckt. Da Baal der phönizische Hauptgott ist, weist die dort herrschende Dürre auf Baals Machtlosigkeit im Unterschied zu Jhwhs Herrschaft über Gewitter und Fruchtbarkeit hin, die in Kap. 18 eindrücklich vor Augen geführt wird. Phönizien und insbesondere Sidon sind die Heimat Isebels (16,31), was Elijas Handeln dort und die Geschichten über ihn als eine direkte Herausforderung ihres Glaubens erscheinen lässt sowie auch ihrer Macht, Israel diesen Glauben aufzunötigen. Die rechtschaffene Witwe bildet das Gegenstück zu Isebel: Beide sind Phönizierinnen, doch die Witwe freundet sich mit Elija an und gibt ihm Brot und Wasser, wohingegen Isebels Anstrengungen, die Propheten Jhwhs zu töten, dazu führen, dass sie in ihrem Versteck mit Brot und Wasser versorgt werden (18,4.13). Wichtiger noch ist, dass das Handeln der Witwe ein Akt des Glaubens an Elija und an Jhwh ist, während Isebel ungläubig ist und aktiv gegen Jhwh und seinen Stellvertreter Elija angeht.41
Die Geschichte in 17,8–16 zeigt, dass Jhwh durch seinen Propheten nicht nur auf der „Makroebene“ handelt, indem er die Dürre schickt, sondern auch auf der „Mikroebene“, indem er eine arme Witwe mit dem täglichen Brot versorgt. Jhwhs Wort an Elija, dass eine Witwe ihn versorgen würde (V. 9), erweist sich auf mehr als eine Weise als Ironie, denn sie bereitet gerade ihr letztes Mahl zu.42 Indem sie Elija versorgt, sichert sie sich und ihrem Sohn die Nahrung und bewahrt sie beide vor dem Hungertod. Für die Lesenden ist dies ein positives Signal, da in der Erzählung versucht wird, Sympathien für die Witwe zu wecken. Das wird dadurch erreicht, dass die Witwe subtil in bestimmter Weise dargestellt wird; dazu zählt das Fehlen von Bitterkeit trotz ihrer extremen Armut oder ihr Schwur bei Jhwh, deinem Gott, als Ehrerbietung gegenüber dem Propheten, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch keinen Grund gibt, ihn als solchen zu betrachten. Auch kommt sie seiner Bitte nach, ihm zuerst – vor sich und ihrem Sohn – zu essen zu bringen (Vv. 13.15), wobei nicht klar ist, ob sie im Vertrauen auf seine Worte so handelt oder sich in ihr Schicksal ergeben hat. Deshalb denken die Lesenden auch nicht schlecht von ihr, wenn sie zunächst zögert, Elijas Bitte zu entsprechen (V. 12).43 Ebenso wenig denkt Elija schlecht von ihr; seine Antwort fällt bestätigend aus (V. 13) und enthält ein Verheißungswort (V. 14). Die Witwe und ihr Sohn werden nicht verhungern müssen, denn ihnen wird das Essen, wenn auch ein bescheidenes, während der gesamten Dürre nicht ausgehen.
Auftrag und Ausführung in der Geschichte Insofern weist die Geschichte ein komplexes Netz von Aufträgen und Ausführungen auf, die in besonderer Weise mit dem Wort Jhwhs verknüpft sind. Bei Jhwhs Befehl an Elija, nach Sarepta zu gehen, findet sich die Notiz, dass er einer Witwe befohlen hat, sich um den Propheten zu kümmern (V. 9). Elija geht nach Sarepta und findet die Witwe. Er bittet sie, ihm Wasser und Essen zu bringen. Sie kommt dem nach, doch zuvor erklärt sie ihm noch, dass sie im Begriff ist, ein letztes, kärgliches Mahl für sich und ihren Sohn zu bereiten, bevor beide Hungers sterben werden. Elija wiederholt sein Ersuchen und fügt hinzu, dass Jhwh angeordnet hat, dass Mehl und Öl nicht schwinden werden, solange die Dürre andauert. Die Witwe folgt der Anweisung Elijas und bringt ihm zu essen. Auch der Topf mit Mehl und der Krug mit Öl gehorchen dem Befehl Jhwhs und sind erst nach dem Ende der Dürre leer.44 Implizit wird in diesem Teil der Geschichte vorausgesetzt, dass das von Jhwh oder Elija ausgesprochene Wort nicht passiv ist, sondern die Kraft besitzt, die Realität zu verändern. Im Erfüllungsvermerk in V. 16 wird Jhwhs Wort durch Elija erwähnt und damit an die Wortereignisformel angeknüpft, mit der die Geschichte begonnen hat, wodurch beide nun eine inclusio bilden.
17,17–24: Die dritte Geschichte Die dritte Geschichte (Vv. 17–24) beginnt nicht mit der Botenformel, sondern mit dem Überleitungssatz nach diesen Dingen. Da sich hier die gleichen Figuren finden wie in der zweiten Erzählung, erscheint diese dritte nun als Fortsetzung jener zweiten. Die Frau ist die Witwe aus Vv. 8–16. Darüber hinaus wird sie als die Herrin des Hauses bezeichnet, was angesichts ihrer extremen Armut in der vorangegangenen Geschichte merkwürdig ist. Entweder war die Dürre so schwer, dass durch sie eine einst wohlhabende Frau, der von ihrem Reichtum einzig ihr Haus geblieben ist, nun dem Hungertod nahe war45 – oder in Vv. 17–24 wird von einem Vorfall berichtet, der sich erheblich später als die Dürre ereignet hat, als nämlich die Frau wieder wohlhabend genug war, ein Haus zu besitzen, und Elija wieder einmal in der Nähe war.
Chiastische Struktur Manche Exegesen entdecken in Vv. 18–24 eine chiastische Struktur:46
A. Rede der Witwe (V. 18)
B. Rede Elijas (V. 19a)
C. Elija nimmt den Jungen von dessen Mutter (V. 19b)
D. Elija bringt ihn in seinen eigenen Raum
E. Elija legt ihn auf das Bett
F. Elija erweckt das Kind (Vv. 20–22)
E.′ Elija hebt das Kind auf (V. 23a)
D.′ Elija bringt ihn aus dem Raum hinunter (V. 23a)
C.′ Elija gibt ihn seiner Mutter zurück (V. 23a)
B.′ Rede Elijas (V. 23b)
A.′ Rede der Witwe (V. 24)
Durch die Struktur wird veranschaulicht, dass die Auferweckung des Jungen (Vv. 20–22) das Zentrum der Geschichte ist. Gleiches wird durch den Handlungsverlauf verdeutlicht, wenn Elija in den oberen Raum hinaufgeht und dann wieder von ihm herunterkommt.
Die Frau spricht Elija als Gottesmann an (V. 18). Der Titel wird mit Bezug auf ihn auch in 2 Kön 1,9–16 verwendet, doch am häufigsten findet er sich bei Elischa zur Hervorhebung von dessen wundersamen Fähigkeiten. Deshalb ist die Anrede der Frau ironisch gemeint. Sie erkennt Elijas Macht an, kommt aber zu dem Schluss, dass sich diese für sie nachteilig auswirkt. Ihre Missetat bezieht sich vermutlich nicht auf eine bestimmte Sünde, sondern auf die menschliche Natur allgemein. Sie befürchtet, dass Elijas Verbindung zu Jhwh als eine Art Blitzableiter gedient hat und zur Prüfung durch Gott und in der Folge zu ihrer Bestrafung in Gestalt des Todes ihres Sohnes führt.
Die Erweckung des toten Jungen Elija nimmt den toten Jungen mit in seinen Raum (V. 18). Der Grund dafür wird nicht erklärt, doch es bieten sich eine Reihe von Möglichkeiten an. Erstens könnte Elija versuchen, seine enge Beziehung zu Jhwh dazu zu nutzen, ihn privatim anzurufen. Sein Gang nach oben würde dann auf den Ernst der Lage und die Eindringlichkeit hindeuten, mit der er seinen Appell vorbringen möchte. Zweitens könnte einer der Gründe für seine Anrufung Jhwhs darin liegen, dass die Witwe sich ihm gegenüber gastfreundlich gezeigt hat, indem sie es ihm gestattete, bei ihr zu wohnen (V. 20). Den Jungen mit in den Raum zu nehmen, den die Witwe ihm zugewiesen hat, soll Jhwh ganz konkret an die Großzügigkeit der Frau gegenüber seinem Stellvertreter erinnern. Dass Elija und der Junge allein in dem Raum sind, unterstreicht darüber hinaus die Rolle des auktorialen Erzählers, der in die intimen Details dessen eingeweiht ist, was Elija dort sagt und tut.
Elija bittet Jhwh um zweierlei. Zum einen (V. 20) erinnert er ihn daran, was die Frau ihm Gutes getan hat, und beschuldigt damit Jhwh im Grunde, ihr im Gegenzug zu ihren guten Taten Böses anzutun. Damit appelliert er an Jhwhs Gerechtigkeitssinn und seine Sorge um den, der für ihn spricht. Zum anderen (V. 21) wird Jhwh angerufen, dem Jungen das Leben zurückzugeben. Zwischen den Anrufungen streckt sich Elija dreimal über dem Jungen aus. Sein Flehen nimmt nicht nur verbale, sondern auch rituelle Form an. Er versucht, Jhwhs Aufmerksamkeit durch Wort und Tat auf den Zustand des Jungen zu lenken und ihn dazu zu bewegen, zugunsten des Jungen zu handeln. Mit anderen Worten besteht Elijas Rolle hier in der eines Fürsprechers oder Bittstellers gegenüber Jhwh. So bereitet diese Darstellung darauf vor, dass Elija im nächsten Kapitel Fürsprache halten wird, worin eine weitere Parallele zu Mose liegt. In der Geschichte wird dann deutlich gemacht, dass es Jhwh ist, der dem Jungen das Leben zurückgibt (V. 22) – als Antwort auf Elijas Bitten. Eben das wird auch durch das Bekenntnis der Frau am Ende der Geschichte ausgesagt. Sie hat erfahren, dass Elija ein Gottesmann ist und für Jhwh spricht, was bedeutet, dass Elija der „Kanal“ zu Jhwh ist, der letztlich der Quell des Segens ist. Das Bild des Propheten und das Bekenntnis der Frau bereiten auf die im nächsten Kapitel erzählte Konfrontation vor zwischen Elija als dem, der für Jhwh spricht, und den Baals-Propheten. Der Ausgang des sich dann zutragenden Götterwettstreits ist bereits durch die jetzt betrachtete Geschichte festgelegt, denn schon hier zeigt sich, dass Jhwh auch im Lande Baals über Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit gebietet und darüber hinaus noch den Tod (Mot) beraubt, der Baal überlegen ist.