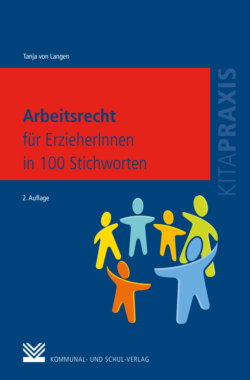Читать книгу Arbeitsrecht für ErzieherInnen in 100 Stichworten - Tanja von Langen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.Abfindung nach § 1a KSchG
Fallbeispiel:
Gabriele N. ist als Kindergartenhelferin in der Einrichtung „St. Theresia“ beschäftigt. Ihr Arbeitsvertrag enthält eine Vereinbarung, nach der „die kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien, Dienst- und Vergütungsordnungen (in Kraft gesetzte Beschlüsse der Bistums-KODA) des Bistums Fulda“ in ihrer jeweils geltenden Fassung Bestandteil des Vertrages werden. Der Träger kündigt das Arbeitsverhältnis zum 30. 6. 2008 mit dem Hinweis auf betriebsbedingte Gründe, weil er die Trägerschaft für den Kindergarten endgültig aufgibt und die Einrichtung schließt. Gabriele N. erhebt hierauf Kündigungsschutzklage. Im erstinstanzlichen Verfahren erweitert sie ihren Klageantrag auf hilfsweise Verurteilung des Trägers zur Zahlung einer Abfindung. Sie beruft sich auf § 9 der „Ordnung über den Rationalisierungsschutz im Bistum Fulda“ (RaSchO), der Regelungen über Abfindungen enthält. Der Träger beantragt die Abweisung der Klage, da er der Auffassung ist, dass § 9 Abs. 8 RaSchO entgegensteht. Darin heißt es: „Erhebt der/die Mitarbeiter/in Kündigungsschutzklage, so ist ein Anspruch auf Abfindung ausgeschlossen.“
(Fall nach BAG, Urt. vom 3. 5. 2006 – 4 AZR 189/05 –)
Habe ich einen Anspruch auf eine Abfindung?
Einen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung gibt es allein in der Form des § 1a KSchG. Mit der seit 1. 1. 2004 geltenden Norm hatte der Gesetzgeber zum Ziel, ein zusätzliches einfaches und kostengünstiges Instrument zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen zur Verfügung zu stellen. Unnötige Kündigungsschutzklagen sollen so verhindert werden. Im Gegensatz zum Aufhebungsvertrag bzw. anderen Entlassungsentschädigungen löst diese Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis einvernehmlich und außergerichtlich zu beenden, keine rarr Sperrzeit aus.
Nach dieser Norm hat die AN einen Anspruch auf eine Abfindung, wenn
•der AG wegen dringender betrieblicher Erfordernisse kündigt,
•in der Kündigungserklärung auf die Abfindung hinweist und
•die AN die Drei-Wochen-Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage verstreichen lässt.
Wesentlicher Nachteil für den AG hierbei ist die Unsicherheit während der Drei-Wochen-Frist, ob die AN nicht doch Kündigungsschutzklage erheben wird. Das BAG hat in diesem Zusammenhang jedenfalls folgende Verzichtserklärung der AN als rechtlich wirksam gebilligt: „Ich erhebe gegen die Kündigung keine Einwendungen und werde mein Recht, das Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses geltend zu machen, nicht wahrnehmen oder eine mit diesem Ziel erhobene Klage nicht durchführen“ (BAG, NZA 1986 S. 258).
Der Anspruch entsteht aber nicht – wie man meinen könnte – erst mit Ablauf der Klagefrist, sondern mit Ablauf der Kündigungsfrist der zugrunde liegenden betriebsbedingten Kündigung (BAG, Urt. vom 10. 5. 2007 – 2 AZR 45/06 –).
Der Anspruch setzt den Hinweis des AG in der Kündigungserklärung voraus, dass die Kündigung auf dringende betriebliche Erfordernisse gestützt ist. Tatsächlich vorliegen müssen diese betrieblichen Gründe jedoch nicht, denn dies könnte zweifelsfrei ohnehin nur das Arbeitsgericht feststellen, was durch diese Norm ja gerade entlastet werden soll. Die Kündigung muss also lediglich als betriebsbedingt bezeichnet werden.
Das Gesetz schreibt weiterhin vor, dass der AG die AN darauf hinweisen muss, dass die AN bei Verstreichenlassen der Klagefrist die Abfindung beanspruchen kann. Streng darauf achten muss der AG also, die AN spätestens mit der Kündigung auf den Bestand einer entsprechenden Regelung oder auf die Möglichkeit hinzuweisen, eine Abfindung zu erhalten, wenn sie auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage verzichtet. Im Fallbeispiel hat die Klägerin vom Gericht eine Abfindung zugesprochen bekommen, obwohl sie Kündigungsschutzklage eingereicht hatte. Das BAG war nämlich der Ansicht, dass Voraussetzung eines Wahlrechtes zwischen Abfindungsanspruch und Einleitung einer Kündigungsschutzklage die Kenntnis der beiden Alternativen ist. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass sich dies bereits aus dem Sinn der Abfindungsregelung ergäbe, die ja darin besteht, das Verhalten der AN zu steuern, indem der AG einen Anreiz schafft, keine Kündigungsschutzklage zu erheben. Im entschiedenen Fall hat der AG aber an keiner Stelle die AN auf ihren Abfindungsanspruch hingewiesen, so dass ihr Schritt zur Klageerhebung nicht auf ihrer bewussten Entscheidung für diese Alternative und gegen eine Abfindung beruhte. Sie hatte daher trotz Klageerhebung einen Abfindungsanspruch (BAG, Urt. vom 3. 5. 2006 – 4 AZR 189/05 –).
Auch ist der AG verpflichtet, die AN über die sozialrechtlichen Folgen vollständig und verständlich zu informieren. Unterlässt er dies, kann die Beendigungsvereinbarung unwirksam oder anfechtbar oder der AG zum Schadensersatz verpflichtet sein (BAG, Urt. vom 10. 2. 2004 – 9 AZR 401/02 –).
In welcher Höhe kann ich nach § 1a KSchG eine Abfindung verlangen?
Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Bruttomonatsverdienste für jedes Jahr des Bestehens des Arbeitsverhältnisses. Bei der Ermittlung der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten auf ein volles Jahr aufzurunden. Über diese Höhe, die gesetzlich vorgeschrieben ist, hinaus können die Vertragsparteien auch eine höhere Abfindung vertraglich vereinbaren. Ob eine solche erhöhte Abfindung zur Auslösung einer rarr Sperrzeit führt, ist allerdings noch nicht entschieden.
Kann ich nicht erst einmal den Verlauf meiner Kündigungsschutzklage abwarten, ggf. diese noch zurücknehmen und eine Abfindung fordern?
Leider nicht. Die Rechtsprechung legt hier einen strengen Maßstab an: Zweck des § 1a KSchG ist es danach, gerichtliche Auseinandersetzungen der Arbeitsvertragsparteien zu vermeiden. Deswegen ist der AN eine Abfindung zu versagen, wenn sie eine gerichtliche Auseinandersetzung eingeleitet hat. Dies gilt beispielsweise sogar für eine verfristete Klage, also eine Klage, die erst nach Ablauf der dreiwöchigen Klagefrist eingereicht wird. Deren Rücknahme kann nicht das Gegenteil bewirken, denn die AN soll gerade nicht zunächst den Verlauf des Kündigungsschutzprozesses abwarten und die Klage dann bei sich abzeichnender Erfolglosigkeit zurücknehmen dürfen, um doch noch in den Genuss der Abfindung zu kommen (BAG, Urt. vom 13. 12. 2007 – 2 AZR 971/06 – und vom 20. 8. 2009 – 2 AZR 267/08 –).
Muss ich meine Abfindung versteuern?
Bis zum 31. 12. 2005 waren Abfindungen teilweise steuerbefreit. Dies ist mit Wirkung ab 1. 1. 2006 entfallen. Sie sind also mit dem jeweiligen persönlichen Steuersatz zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag zu versteuern. Der bei kirchensteuerpflichtigen Personen anfallende Kirchensteuerbetrag von 8–9% kann im Einzelfall und auf Antrag teilerlassen werden. Hierzu genügt ein formloser schriftlicher Antrag beim zuständigen Kirchensteueramt.
Tipp:Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BSG löst der Anspruch nach § 1a KSchG auch keine Sperrzeiten für den Bezug von Arbeitslosengeld aus. Das bedeutet: Die gekündigte und abgefundene Arbeitnehmerin hat vom ersten Tag der Arbeitslosigkeit an Anspruch auf Arbeitslosengeld. Doch Vorsicht: Keine gesicherte Rechtslage zur Sperrzeit ist derzeit gegeben, wenn – was rechtlich möglich ist – per Aufhebungsvertrag ein höherer Abfindungsbetrag als der Regelsatz des § 1a KSchG vereinbart wird. In diesen Fällen ist die Hinzuziehung einer Anwältin dringend anzuraten, um Nachteile für Sie zu vermeiden.
Verwandte Suchbegriffe:
•Kündigung
•Kündigungsschutz
•Sperrzeit