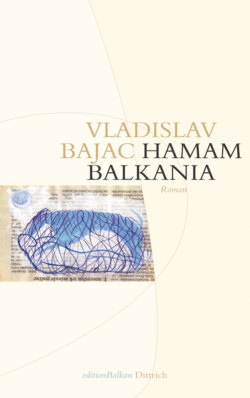Читать книгу Hamam Balkania - Vladislav Bajac - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. KAPITEL
ОглавлениеObwohl Bajicas Alter anfangs erschwerend auf sein Fortkommen wirkte, stellte es bald eine vortreffliche Ergänzung seines Talents, seines Fleißes und seiner Bescheidenheit dar, die er bei seinen Studien zeigte. Nicht nur, dass auch jene Burschen auf ihn hörten, denen es ganz und gar nicht recht war, sich einem fremden Glauben, Willen oder allen möglichen neuen Erkenntnissen zu unterwerfen, sondern es wandten sich auch ausgesprochen oft die Lehrer, die Ältesten verschiedener Dienste des Sultans an ihn. Er fiel allen auf und so war er gemeinsam mit einem Dutzend ähnlich wahrgenommener junger Männer dazu auserkoren, sich Bildung schneller und auf verkürztem Wege anzueignen.
Bereits nach drei Jahren Aufenthalt im Serail von Edirne, gemeinsam mit den anderen begabten jungen Männern, drang die Erfahrung des Krieges in sein Leben. Fünf Jahre nach der Eroberung Belgrads, im April 1526, rüstete Sultan Süleyman zu einem neuen Feldzug gegen Ungarn. Sein Liebling, der Großwesir Ibrahim Pascha, seiner Herkunft nach ein Grieche aus Parga, forderte, dass auch die älteren Schüler aus dem Serail den Sultan begleiten sollten, um sich so schnell wie möglich in einem echten Krieg zu stählen und möglichst bald zum Offizier befähigt zu sein. So bestimmte Deli Husrev Pascha als Vollstrecker vertraulicher und wichtiger Aufgaben noch einmal den Pfad des Erfolgs für die jungen Leute. Seinen noch sehr jungen Bruder Mustafa ließ er am Hofe von Edirne zurück (obwohl dieser vor Bajica / Mehmed in den Serail gekommen war und demnach »älter« als er war).
In seinem ersten Leben als Bajo Sokolović hatte Bajica Belgrad vornehmlich für die Hauptstadt gehalten, die er allerdings nie betreten hatte. Nachrichten von dieser wunderschönen Festung drangen durch Händler zu ihm wie auch zu den anderen, welche – die Armeen nicht eingerechnet – am meisten in bekannten und unbekannten Gegenden unterwegs waren. Selbst wenn er einen Teil ihrer Geschichten als übertrieben ablehnte, ging auch aus dem Rest ohne Zweifel hervor, dass es sich um eine echte, gründlich befestigte Stadt handelte. Oft dachte er über sie nach, aber er sehnte sich nicht danach, sie zu betreten. In seiner Nähe war der Fluss Drina, der sich, so überlegte er, nicht großartig von der Save oder der Donau unterscheiden konnte. An anderen Orten hatte er einige kleinere Festungen gesehen und er konnte sich daher vorstellen, wie eine Hauptstadt aussehen musste. Reisende erzählten, dass sie sich abgesehen von ihrer Größe nicht wesentlich von der Stadt unterschied, die 1404 unter dem serbischen Despoten Stefan Lazarević erbaut worden war.
Seit er Sokollu Mehmed geworden war, gingen seine Überlegungen zu Belgrad über die bisherigen hinaus. Seit vor fünf Jahren diese Stadt von Sultan Süleyman erobert worden war, wurde sie zu einer osmanischen Stadt, und danach zum wichtigsten osmanischen Ausgangspunkt (und damit auch Stützpunkt) nach Zentraleuropa und eine Startposition zur Verwirklichung des lang gehegten Wunsches, nach Ungarn auch das östrreichische Imperium zu erobern und natürlich auch die Tore Wiens zu erreichen. Bajica sah diesen Ort nunmehr auch als Osmane, der Strategie und Pläne beherrscht, militärische Macht hat, aber auch mit der aufgezwungenen Überzeugung seiner Unbesiegbarkeit. Einerseits. Andererseits regte sich zur selben Zeit eine neue Emotion, die er mit Erstaunen erkannte, denn sie entstand antizipatorisch gegenüber einer Stadt, die er nie gesehen hatte. Die einzige Antwort, die er sich selbst in dieser Frage anbieten konnte, war anscheinend, dass dies zu einem Teil des Widerstands in seiner noch zarten Zweiheit gehörte, die ihn ausmachte. Als er die Stadt aber sah, begriff er, dass er sich in sie verlieben musste, gerade so im Kopf und im Voraus. Ein Blick auf die Tore, Türme, Mauern und Gebäude auf diesem Fićir bajir11 wie auch auf die nach europäischer Art gebauten Häuser neben dem Kalemegdan12, die durch Kopfsteinpflasterstraßen und -gassen miteinander verbunden sind, mit den alten orthodoxen Kirchen und den im Bau befindlichen Moscheen, mit dem einen oder anderen Brunnen und den äußeren Stadttoren, nachdem er das also alles gesehen hatte, begriff er auch, warum er sich verlieben musste. Belgrad war ihm ähnlich: ein Mischling mit klaren Zeichen der Zugabe eines neuen Lebens zu dem existierenden, mit großen Unterschieden zum vorherigen. Er sah in der Stadt sowohl Serben als auch Türken. Sie lebten ganz dicht nebeneinander; ob sie einander mochten, ertrugen oder duldeten, konnte er nicht ergründen. Doch er meinte zu sehen, warum, denn er begriff, dass auch das künftige Schicksal dieser Stadt wie sein eigenes sein könnte: Die Serben werden sich niemals von ihr lossagen, und die Türken werden sie als ihre eigene betrachten!
In einem breiteren Kontext gesehen, konnte sich eine solche Denkweise auf mehrere Fakten aus der (gemeinsamen? serbisch-türkischen) Vergangenheit stützen. Der erste türkische Überfall und die erste erfolgreiche Verteidigung fanden im Jahr 1440 statt. Erst etwa fünfzehn Jahre später, nur drei Jahre nach der Eroberung von Konstantinopel und dessen Transformation zu Istanbul, begann Sultan Mehmed II 1456 einen neuen Feldzug gegen Belgrad. Diese Eile offenbarte, welche Bedeutung die Politik des Osmanischen Reiches Belgrad beimaß. In den Schlachten auf den Belgrader Flüssen und an deren Ufern bewiesen die Verteidiger großen Mut, besonders die serbischen Matrosen. Es gelang ihnen, die Stadt zu retten. Belgrad wurde von da an zum Symbol der Verteidigung der Werte Europas und erhielt die Bezeichnung Schutzwall des Christentums13. Allerdings konnte sie 1521 nicht Süleyman I, dem Gesetzgeber, trotzen. Dieser gab der »Weißen Stadt«14 den islamischen Namen Dar ul-Jihad15, und im Gegenzug verhalfen ihm seine Feinde zu dem Namen »der Prächtige«.
Die Wahrheit war folgende: Für das Osmanische Reich war diese Stadt ein einzigartiges Absprungbrett für jede neue Eroberung in Richtung des endgültigen Ziels – der Stadt Wien; und für die europäischen Mächte im Bündnis gegen die Osmanen war die Stadt eine begehrte Grenze, mit Opfern, die nicht ihre Bürger waren. Die Serben boten hinsichtlich der Interessen beider Seiten – der islamischen wie der christlichen – eine ideale Basis: eine formbare Masse und eingeklemmt zwischen Hammer und Amboss.
Das war Vergangenheit. Und was, wenn die Zukunft etwas völlig Gegensätzliches bringen würde als das, was er kurz zuvor gedacht hatte: Die Serben werden sich von ihr lossagen und die Osmanen werden sie nie als ihre akzeptieren? Darüber hatte er nicht weiter nachdenken dürfen und auf einmal nahm die Idee der Ähnlichkeit oder gar möglichen Identität zwischen dem Schicksal der Stadt und seinem eigenen Gestalt an.
Nun fand Bajica heraus, was die kaiserliche Straße war, die die Serben Straße nach Konstantinopel nannten und auf der auch er nach Belgrad gekommen war. Er konnte nicht wissen, wieviele Male er noch auf dieser Straße, gewöhnlich den Flussebenen folgend, kommen und gehen würde. Diese Straße sollte mehr als ein Symbol seines gesamten Lebens werden.
Die Militärbefehlshaber schützten die Jungen aus Edirne nur in einer Hinsicht: Sie positionierten sie unter keinen Umständen bei den Kämpfern in der vordersten Linie und sie schickten sie auch nicht in den direkten Kampf. Sie durften deren Leben nicht riskieren, denn die jungen Burschen sollten dem Sultan und dem Reich erst zeigen, ob und inwieweit sie überhaupt auch zur Verteidigung des eigenen Lebens fähig sind. Aber zunächst galt es zu überleben. Für den Anfang reichte es völlig aus, dass sie in ihrer Nähe genügend Blut sahen; es war nicht notwendig, die eigenen Hände mit Blut zu besudeln. Jene erste Begegnung mit dem massenhaften Tod schockierte Bajica und seine Kameraden gerade in dem Maße, dass es ihnen gelang, einen klaren Kopf zu behalten und mit sehr einfachen Arbeiten fortzufahren, welche die Agas ihnen gaben. Die Ranghöheren, das sah man, hatten viel Erfahrung mit derartigen Situationen und machten in keinem einzigen Moment diesbezüglich auch nur einen einzigen überflüssigen Zug. Die große Zahl der Pflichten, die ein Feldzug besonders dem Kommandanten abverlangte, erwies sich als willkommen, um die »Lässigkeit« gegenüber den Jungen zu rechtfertigen. Aber eigentlich war alles geplant: Sie ließen scheinbar los, damit jene sich abhärten und begreifen konnten, was sie künftig erwartete. Natürlich wachten die Agas ungemein über ihre Sicherheit, was sie geschickt verbargen. Jene vordergründige Einsamkeit flößte den Jungen zunächst schreckliche Angst ein, doch nach erfolgreich getaner Arbeit wurden sie mit Selbstvertrauen belohnt.
Der Natur des Ortes nach, in dem sie stationiert lagen, waren Bajica und seine Kameraden in Truppen, die in jeder Hinsicht die Kämpfer sicherten – Stoßtrupps, Janitscharen und Einheiten mit lokalen Soldaten. Auf jeden Stoßtrupp kamen mehrere einfache Soldaten und Reservisten, Handwerker, Händler, Kämmerer und andere, die dafür Sorge zu tragen hatten, dass jeder von ihnen seine Sache so gut wie möglich machte. Davon hing ab, ob die Kämpfer in der vordersten Linie umkamen, wann und wieviele sinnlos oder nicht. Bajica verstand damals die absolute Wichtigkeit der Strategie, der Organisation einer ganzen Kette von Tätigkeiten und Aufgaben, die ein untrennbares Ganzes bildeten. Falls nur ein Glied dieser Kette brach, und sei es ein noch so unwichtiges, war auch das Ganze gefährdet. Von außen betrachtet, sahen die Dinge anders aus: Sichtbar waren die Prominenten (Einzelpersonen oder Ereignisse), die ganze Armee aber, die diese herausgehobenen Positionen ermöglicht hatte, verharrte tief im Schatten. Die Handlungsmechanismen dieses Beispiels konnte er auf das gesamte Reich anwenden. Die Kämpfer in den ersten Reihen (wie auch der Sultan und ihm Nahestehende im Staat) riskierten mehr als alle anderen das eigene Leben (das heißt, sie trugen im Staat die größte Verantwortung). Manchmal büßten sie es ein, aber im Falle eines Triumphes nahmen sie dafür die »Bürde« von Ruhm und Reichtum (an Macht und Luxus im Staat) auf sich.
Das Töten als sichtbarstes Werkzeug dieses Feldzugs interessierte ihn ganz und gar nicht, erst recht nicht konnte es ihn begeistern. Dies hatte man ihn auch im Serail gelehrt. Jetzt sah er die Übungen in der Praxis. Er war sicher, dass man dies auf ein notwendiges Minimum reduzieren könnte. Gewalt konnte und musste nicht in diesem Maße praktisch der einzige Maßstab für Erfolg sein. Ihn interessierte, wie man den Tod vermeiden kann. Leichter gewöhnte er sich an den Tod als an das Töten.
Größere Anziehungskraft übten Handwerker und Erfinder auf ihn aus. Zu ihnen fühlte er sich hingezogen auch durch die vielen Sprachen, die sie benutzten. In Erstaunen versetzten ihn ihr Glauben an das eigene, noch nicht gemeisterte künftige Wissen: Sie gaben sich offensichtlich nicht mit dem zufrieden, was sie bereits wussten. Das war besonders evident, wenn ihnen der Sultan oder der Großwesir eine unverhoffte, neue und scheinbar unmögliche Aufgabe stellte. Ihr Glaube an das Mögliche bezauberte Bajica völlig. Sie gingen an die Lösung jedes noch so kleinen Problems mit einem solchen Fleiß heran, als hinge davon das Schicksal der ganzenWelt ab.
Unter den Baumeistern und Handwerkern erspähte er einen Mann, der mehr als zehn Jahre älter als er sein musste, sich durch seinen Elan aber derart von allen anderen hervorhob, dass er aussah, als hätte er Bajicas Alter. Und gerade an ihn wandte sich Ibrahim Pascha mehrfach!
Diesmal war er nahe genug um zu hören, wie sich die beiden auf Griechisch unterhielten. Er wusste, dass der Großwesir seiner Herkunft nach Grieche war, und nun begriff er, dass auch dieser jüngere Mann genau wie er durch die Knabenlese zugeführt worden war, um dem Osmanischen Reich zu dienen. Ibrahim Pascha hatte ihm gerade suggeriert, sich durch Ideen hervorzutun, um im Dienst schneller voranzukommen.
Wie freute sich Bajica über dieses Belauschen und über seine Kenntnisse des Griechischen, das er so gewissenhaft im Kloster gelernt hatte! Nun wird er wenigstens noch einen Gesprächspartner haben, mit dem er sich auf verschiedene Art und Weise unterhalten kann.
Und ausgerechnet während er darüber nachdachte, bemerkte der Wesir sein unverhohlenes Interesse an dem Gespräch. Der Pascha wusste offensichtlich sehr genau, wer Bajica ist, denn er wandte sich auf Griechisch an ihn, sagte ihm, dass er sie miteinander bekanntmachen kann.
»Ihr werdet euch nicht nur miteinander bekanntmachen«, begann der Wesir, »sondern ihr werdet einander auch mit dem bekanntmachen, was ihr wisst.«
»Das ist Sinan. Er wird zum hohen Offizier ausgebildet, interessiert sich aber auch für das Bauen. Wenn ich ihn brauche, finde ich ihn eher unter den Baumeistern als unter den Kämpfern. Da er zur Leibwache des Sultans gehört, hat der Herr ihn sich gemerkt und fragt zuweilen nach ihm. Dann müssen Lutfi Pascha, der Kommandant der Garde und ich häufig seine Abwesenheit rechtfertigen. Obwohl, Hand aufs Herz, er sich unserem Sultan mit den Ideen in seinem Kopf als nützlicher erwiesen hat als mit dem Säbel in der Hand.«
Bajica wunderte sich über den vertraulichen Ton des Großwesirs gegenüber einem Opfer der Knabenlese16. Doch Ibrahim Pascha lieferte schon die Erklärung nach:
»Vom ersten Tag des Jahres 1511 an, als er aus der anatolischen Provinz Kayseri ins Herz des Reiches kam, und das als fast Neunzehnjähriger, wurde Sinan Jusuf meinem Hof zugeteilt. Darin seid ihr euch ähnlich: Auch du bist in dem Alter aus Bosnien hergebracht worden, wenngleich zu einem späteren Zeitpunkt. Beide seid ihr der Herkunft nach orthodoxe Christen, und du, Mehmed, wärst um ein Haar auch noch Mönch geworden. Sinan hat sich schon vor fünf Jahren bei der Eroberung von Belgrad als ein mutiger und exzellenter Kämpfer erwiesen, aber er entdeckte einige andere Eigenschaften an sich, von denen das Reich größeren Nutzen haben könnte: Das Bauen ist es, was ihn interessiert, und so wurde ihm gestattet auch dieses Handwerk zu erlernen. Eine ideale Gelegenheit ebenso für das Erlernen des Zusammenhangs zwischen Bauen und Zerstören.«
Nachdem Bajica ihn auf den letzten Satz hin mit Verwunderung und Unverständnis angesehen hatte, klärte der Pascha mit einem selbstzufriedenen Lächeln alles auf.
»Ich sehe, dass du dich fragst, wie das ist, im Angesicht des Krieges das Bauen zu erlernen, wo dieser doch dem Gegenteil dient, der Zerstörung vor allem?! Doch hast du daran gedacht, was eine Armee vor und nach den Zerstörungen tun muß?«
Ja, tatsächlich. Das war ihm nie in den Sinn gekommen.
»Vor einem Angriff sind die Bauleute der Voraustrupp der Armee und errichten Straßen, Brücken, Dämme und Wälle. Nach einer Schlacht kann es vorkommen, dass sie das, was sie gerade errichtet haben, zerstört vor sich sehen, und dann müssen sie von vorn beginnen. All diese Zerstörungen konnte auch der Feind vorgenommen haben, aber das, was ganz sicher erneuert werden muss und was hauptsächlich wir zerstören, sind die Städte und Festungen, die von uns erobert werden. Meist bleibt nach uns wenig davon übrig, aber es muss, wenn auch nicht alles, doch zumindest ein Teil in Ordnung gebracht werden, damit wir während unserer Vormärsche und Rückzüge unsere Wachen und Außenposten in den Befestigungen lassen können. Diese Befestigungen verteidigen wir dann vor anderen. Zugegeben, im Frieden sieht es für die Baumeister besser aus. Da können sie Moscheen, Karawansereien, Basare, Brunnen, Minarette, Krankenhäuser und Medressen errichten.«
Ibrahim Pascha begriff, dass er sich vom Erzählen hatte hinreißen lassen und überließ nun die beiden ihrem Zwiegespräch.
Seit dem Augenblick ihrer Bekanntschaft waren Sinan und Mehmed beinahe unzertrennlich. Natürlich in dem Maße, wie die Umstände dies zuließen. Und die kamen ihnen entgegen, wenigstens vorläufig.