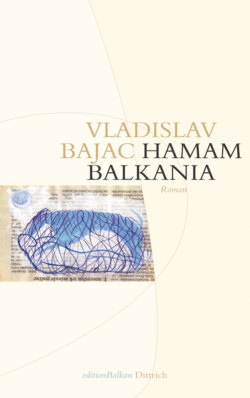Читать книгу Hamam Balkania - Vladislav Bajac - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VOR BEGINN
ОглавлениеVišegrad hat wie jeder andere Ort sein reales Leben. Aber wie kaum ein Ort hat die Stadt auch ein imaginäres. Meine Erfahrung mit der Metaphysik Višegrads begann im April 1977, auf den Zufahrtswegen zur Stadt, bevor ich zum ersten Mal die Brücke über die Drina erblickte, die sicher dazu beigetragen hatte, dass die Stadt für ewig in die Geschichte einging. In mein kleines Heft für Haikus, das ich noch habe, notierte ich damals zu einem Gedicht, das ich durch die Scheiben des Busses entdeckte, den geopoetischen Kommentar »auf dem Schotter von Višegrad«:
Ein Stein zwischen ihnen
Zwei Kiefern zog
im Wald einen Scheitel.
Žarko Čigoja, mein Gastgeber und Freund aus der Studienzeit, ging davon aus, dass die Brücke von Mehmed Pascha Sokolli (präzise türkisch Sokollu) aus dem Jahr 1571 – Ivo Andrićs Brücke – Gewinn und Genuss genug für diesen Anlass war, und so zeigte er mir gar nicht erst weitere Sehenswürdigkeiten seines Geburtsstädtchens. Er hatte keinerlei Vorstellung davon, wie egoistisch ich war, und eigentlich auch unglücklich darüber, dass ich diese prächtige Brücke mit anderen teilen musste. Aber wie konnte ich annehmen, dass die Einführung in die Geheimnisse der Umgebung von Višegrad erst durch künftige Erfahrung verdient werden musste, auf Grundlage derer man in der Lage sein konnte, das zu genießen, was geboten wird? Wieder ging es um eine geheime Bruderschaft. Volle sechsundzwanzig Jahre musste ich auf den Eintritt in jene Bruderschaft warten! Es hat sich ausgezahlt. Das Warten hatte mich eigentlich Andrić gelehrt – bei der erneuten Lektüre seines Meisterwerks während des Studiums der Literaturwissenschaft war ich noch nicht imstande, die Lektüre mit dem Leben zu verbinden: So überging ich leichtfertig seine Angaben zum Baubeginn der Brücke – zu ihrem Wesen –, zum »Heranschaffen von Steinen aus den Steinbrüchen, die in den Bergen bei Banja, eine Stunde Fußweg von dem Städtchen entfernt, angelegt wurden«. Sogar zwei der zumindest in literarischer Hinsicht wichtigsten Brücken in ganz Bosnien – die über die Drina und die über die Žepa – wurden aus ein und demselben weißen Gestein aus meinem Haiku: mit Liebe und Geld der (türkisierten oder islamisierten) Serben Mehmed Pascha Sokolović und Jusuf Ibrahim errichtet, aber unsterblich wurden sie durch die knappen und weisen Worten von Ivo Andrić, des Mannes, der seinem Helden das Lebensmotto zuschrieb: Im Schweigen ist Sicherheit.
Als ich mich bei meinem Freund darüber beklagte, dass mir beim Schreiben ein wenig die Puste ausging, sagte er mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Er habe eine sichere Medizin gegen diese Krankheit. Gerade käme auch der türkische Schriftsteller Orhan Pamuk zu ihm, mit derselben Diagnose, so dass wir uns beide gemeinsam mit seinem Rezept therapieren lassen könnten.
Das einzige, was ich über Banja wusste, über Sokolovićs Bad, über das Višegrader Bad, wie es von allen genannt wurde, war – abgesehen davon, dass hier Sintervorkommen sind, mit denen die Višegrader Brücke gebaut wurde –, dass dieser Ort in fünf Kilometer Entfernung von der Stadt eine Heilquelle ist. Hier hatte Mehmed Pascha Sokolović 1575 in hohem Alter einen Hamam mit einer Kuppel errichtet, weil er seinen heimatlichen Gefilden (noch) etwas schenken wollte. In einer Broschüre aus dem Jahr 1934 las ich, dass dieses radioaktive Wasser (mehr als vierhundert Meter über dem Meeresspiegel) Rheumatismus, Neuralgien und Frauenkrankheiten heilt. Man sagt, dass das Wasser des Bades außerordentlich gut für kinderlose Frauen sei. »Wenn eine kinderlose Frau sorgfältig Bäder nimmt und dann in Bälde ein Kind zur Welt bringt, schüttelt das ganze abergläubische Dorf den Kopf und sagt: Bei Gott, hätte sie nicht ein Bad genommen und wäre nicht vom Zauber benommen, dann wär auch kein Kind zur Welt gekommen …«
So machte auch ich mich durch dichten Wald auf den Weg zum Hamam, den ich nach der seltenen und zauberhaft aussehenden Pflanze, die nur hier wächst, Elfenhaar nannte. Das Treffen mit meinem alten Bekannten Orhan Pamuk, dem berühmtesten türkischen Schriftsteller, der aus Istanbul stammt, machte mich froh. Ich war ein bisschen darüber verwundert, dass auch er an einer Schreibflaute litt, war er doch für ergiebiges Schreiben bekannt. Falls es doch vorkam, dass er in einer Phase seines Schriftstellerlebens kaum ein Buch veröffentlichte, so erwies sich das, was folgte, als ein ausgesprochen kräftiges Baby.
Ich persönlich brachte seltener Kinder zur Welt, und meist hatten sie mittleres Gewicht. So war mein Rhythmus. Im letzten Jahr aber empfing ich nicht ein einziges und ich machte mir ernsthaft Sorgen. Deshalb begebe ich mich zu dem Stein, der Wasser geboren hatte: Eine derartige Fruchtbarkeit bringt mir den Glauben zurück. Der Stein, auf den ich klettere, wurde mehr als vier Jahrhunderte geschliffen! Ein Stein in den Farben des Grases und des Mooses! Das Wasser heiß, aber nicht kochend, ganz himmlisch warm. Und ein Körper, der sich in einen Geist verwandelt! Lebendig, aber tot! Pamuk und unser Gastgeber versuchen, sich durch den Wasserdampf zu unterhalten, aber die Worte lösen sich in den Glasfenstern der Kuppel auf und verlieren jeglichen Sinn. Wir werden Helden (Affen) aus dem Film mit dem Sufi-Titel Baraka des Regisseurs Ron Fricke: Auf der Stelle schwimmen wir an der Oberfläche, die sich in Nebel verwandelt und in einen anderen Aggregatzustand übergeht, wobei sie jeglichen Intellektualismus mit sich nimmt. Die Lider fallen zu, aber die Augen finden keinen Schlaf. Wenn es gefährlich wird, schiebe ich mich durch das kraftvolle Wasser, unter den dicken Strahl, der aus dem Gebirge in dieses kleine Becken schießt, nun über meinen Rücken. Ich werde ausgepeitscht wie nie zuvor. Und ich bin glücklich, von Kopf bis Fuß! Hier begegnen sich Kabbala, Zen, Sufismus, orthodoxe Askese, katholisches Ausradieren der Angst vor der Sünde, artistischer Islam und Dschanna … So wie der Farn kann das Elfenhaar nirgendwo sonst als an diesem Ort wachsen, weil nur hier das Wasser aus einer Tiefe von hundertachtzig Metern und aus der noch wichtigeren historischen Tiefe von achtunddreißigtausend Jahren entspringt. Das Alter genügt, um nicht an den Gründen ihrer Existenz und der Hinwendung zur Welt zu zweifeln.
Daher auch meine Beziehung zur Vergangenheit. Das Uralte, das ich hier einatme, ist ganz authentisch und man kann dem nicht widerstehen. Der Geist verliert zuerst die Orientierung, und dann die Vorstellung von Zeit, und danach verliert auch der Körper die Orientierung, und dann ebenso die Vorstellung von Zeit. Dieses eigenartige Nirwana verwandelt mich in ein großes Fragezeichen: Hatte sich der kinderlosen Frauen in diesem Hamam nicht zufällig irgendein Mann angenommen, der für seinen gesunden Samen bekannt war? War dieses Bad nicht ein männlicher Harem für die untröstlichen kinderlosen Frauen? Was für ein Genuss dieses verschwiegene Bad erst für die Begs, Paschas, Wesire und Sultane, ganz egal, ob Gastgeber oder Gäste, gewesen sein musste! Egal, welches Geschlecht dieses aktive Wasser und seine Badenden bediente – gesagt wird, und in einem verlorenen gegangenen Text steht es geschrieben, dass ein Liebesakt unter diesem Wasserstrahl aus dem Gebirge (mit einer Temperatur von 34 Grad) wie das Genießen der Schönheiten in den paradiesischen Gärten von Walhalla und Dschanna ist.
Dieser Hamam könnte ein idealer Platz für eine Karawanserei sein. Wieviel Geld würden die Reisenden hier lassen! Doch die Natur (und auch das Schicksal) wollte ihn vor den zu belebten Straßen verbergen, und so wurde er in einer Höhe angelegt, die der müde Reisende nicht mal in Gedanken zu überwinden versucht. Eben deshalb wurden die Steine des Hamam von Jahrzehnten und Jahrhunderten geschliffen, und nicht von Menschenhand. Allerdings muss zugegeben werden, dass sich jene Hand einmischte, wo und wann immer sie konnte: Daher kann man Zitate in alten Schriften finden (erkennbar an der Sprache, doch ohne Notwendigkeit, unbedingt ihre Quelle und die Entstehungszeit anzuführen), die sich mit der Gegenwart decken: »Gleich neben dem Bad wurde ein Gebäude errichtet, in dem ein bekannter Pächter eine Restauration und Zimmer zum Übernachten unterhält. Vor diesem Gebäude gibt es eine recht große Veranda, von der aus sich herrliche Naturpanoramen eröffnen.«
Ich weiß nicht, wie bekannt der gegenwärtige Pächter, privater Businessman oder nicht, ist, doch entledigte er sich weder der »Restauration« noch der »Veranda«. Denn wahr ist, das Badevergnügen im winzigen paradiesischen Bassin wäre nicht vollkommen, wenn man nicht danach über eine Art Halbbrücke noch die Restaurantveranda aufsuchen könnte. Eigentlich ist sie ein großer unverglaster Hängeerker über der tiefen Gebirgsschlucht, der den Badegästen mit seiner wunderschönen Aussicht auch die Gedanken weitet und sie, nachdem ihre Gedanken abgeprallt von den bosnischen Bergen und Schluchten erneut ihre Schultern streifen, nicht mehr den Eindruck haben, unfruchtbar zurückzukehren. Und erst das Essen! Neben allen einheimischen Vorspeisen wartet auf sie eine königliche junge Forelle, die eine Stunde zuvor telefonisch in Zlatibor bestellt wurde, frisch gefangen in den umliegenden Stromschnellen. Eine, die ohne Nahrung überwintert und gerade begonnen hat, das noch unberührte Futter zu fressen.
Diese zivilisatorische Errungenschaft des Restaurants darf man allerdings auch heute nicht mit der Karawanserei aus dem 16. Jahrhundert verwechseln. Das ist nicht dasselbe. Heute gibt es für die, die diese Schönheit gern etwas länger genießen möchten, ein Hotel – ein Rehabilitationszentrum namens Elfenhaar mit all dem nötigen Komfort, aber auch mit einem modernen Bassin, das natürlich mit Thermalwasser gefüllt ist. Seine Radioaktivität verdankt es Radon, und wo es Radon gibt, sind auch Ärzte und Physiotherapeuten vor Ort. Natürlich müssen Sie nicht krank oder um ihre Gesundheit besorgt sein, um an diesen Ort zu kommen. Gerade wenn Sie gesund hierher kommen, beweisen Sie sich, dass Sie dem Hedonismus noch nicht abgeschworen haben.
Nicht einmal Mehmed Pascha Sokolović machte aus dem Hamam, dem »schönen Kuppelbad«, eine Karawanserei, sondern errichtete diese etwas weiter unten, »nahe der Drina, als Sokolovićs steinernen Han oder Karawanserei, die etwa zehntausend Pferden und Kamelen Unterschlupf zu bieten vermochte.« Sie meinen, dass die Zahlen übertrieben sind? Das würde ich nicht sagen. Und selbst wenn, dann nicht übermäßig. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie das Unternehmen des Baus einer Brücke wie der Višegrader in den siebziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts ausgesehen haben mag! Zu Lebzeiten von Mehmed Pascha gab es in Višegrad etwa siebenhundert Häuser, eine Moschee namens Selimiye, Brunnen, etwa dreihundert Läden, eine öffentliche Küche für die Armen der Stadt, ein Derwischkloster – Tekke. Im Dorf Sokolovići (es hatte seinen Namen nach dem Pascha erhalten oder der Pascha seinen Namen nach dem Dorf, ganz egal) gab es die Sokolović-Moschee, aber auch eine christliche Kirche, die – so erzählt man sich – der Pascha für seine orthodoxe Mutter errichten ließ. Das sollte natürlich niemanden verwundern, wenn man davon ausgeht, dass die Mehrheit der Leute weiß, dass kein anderer als Mehmed Pascha Sokolović als Wesir des osmanischen Diwan im Jahr 1557 persönlich das Patriarchat von Peć wiederherstellen ließ und an dessen Spitze seinen Bruder Makarije setzte, und das, wie die Quellen vermerken, in dem Moment, »als die Orthodoxie sich im Chaos befand und im Zerfall begriffen war, und der nationale Gedanke des serbischen Volkes in den schweren Fesseln der Sklaverei langsam in Vergessenheit geriet«. Einige Historiker sind der Ansicht, dass der letzte »große Wesir mit diesem Akt das serbische Volk vor seiner endgültigen Vernichtung und Ausrottung bewahrte«. Das kann nicht so weit entfernt sein von der Wahrheit, wenn man weiß, welche Bedeutung in jener Zeit das serbische Volk in Ermangelung eines eigenen selbständigen Staates der Kirche beimaß, als dem einzigen vorhandenen Ersatz für Staatlichkeit. Daher gilt für Mehmed Pascha Sokolović, dass er »ein unbeugsamer Muslim und gleichzeitig … ein guter Patriot war (der sich ehrenhaft seinem Volk erkenntlich zeigte)«. Er glaubte, den Islam so mit seiner bosnischen Heimat, mit seinen serbischen Wurzeln und dem christlich-orthodoxen Glauben versöhnen zu können.
Und das ist der Grund dafür, weshalb (in meinen Gedanken) hier, im Hamam, der beste und populärste, aber auch umstrittene türkische Gegenwartsschriftsteller Orhan Pamuk auftauchte – weil er, falls Romanschreiben mit Ideologie zu tun hat, seine Bücher den Beziehungen zwischen Ost und West widmete und so denselben Weg einschlug wie einige seiner Vorfahren. Ich hatte die Gelegenheit, mich in Gesprächen mit Pamuk davon zu überzeugen, nicht nur bei der Lektüre seiner ausgezeichneten Bücher. Und ein zweiter Grund: Sein Meisterwerk Rot ist mein Name befasst sich mit dem Osmanischen Reich (teilweise auch mit der Zeit von Mehmed Pascha und deren Folgen); mich informierte es über wichtige Beziehungen des türkischen Systems – das Eroberungsverhalten und die Eroberung neuer Räume für Kunst innerhalb dieses Reichs, worüber ich fast gar nichts wusste. Für all die Anstrengungen zum Wohle anderer verdiente sich Pamuk ein virtuelles (für ihn vielleicht derwischhaftes) Baden. Übrigens, Sauberkeit und Reinigung kann es nie genug geben. Ebensowenig nicht das Genießen oder den akšamluk »den bosnischen Brauch, am frühen Abend im Gras, meistens am Wasser zu sitzen und Schnaps zu trinken, zu singen und zu erzählen.«.
Was wären wir für Schriftsteller, wenn wir uns nicht manchmal, neben dem Hamam, auch ein wenig Freude durch akšamluk gönnen würden. Unter der Bedingung, das Wort gleichzeitig und gleichberechtigt als hedonistisches und philosophisches zu fassen.
Das Problem eines Schriftstellers, eines der unzähligen, besteht darin, dass er häufig Realität mit Imagination vermischt. Daher rührt auch das berühmte Verwischen der Grenzen zwischen dem Ereigneten und dem Erfahrenen. So glich ich Begegnungen mit mir nahestehenden Menschen zeitlich an; jene, die fünf Jahrhunderte vor mir lebten, näherte ich meiner Zeit, mich und meine Freunde (oder Figuren, ganz egal) versetzte ich in Leben, die Jahrunderte älter waren als wir. Daher konnte es geschehen, dass sich unsere realen und irrealen Begegnungen häufen.
Das war einer der Wege zur Erfüllung des Traums von der zeitlichen Allmacht des Wortes.
Bücher entstehen im übrigen wegen dieses Traums.