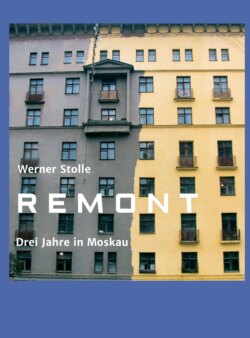Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinkauf im Bolschoi-Theater
16. September 1989
Michael und Sabine holen uns am frühen Morgen ab. Auf dem Weg zum Ismai-lowski-Park machen wir kurz Station am Komsomol-Platz, um einen Blick auf die drei architektonisch unterschiedlichen Bahnhöfe zu werfen: den Leningrader, den Jaroslawler und den Kasaner Bahnhof. Insgesamt gibt es neun Kopfbahnhöfe in Moskau, die alle nach ihren Zielorten benannt sind und deren Baustil typische Elemente der jeweiligen Region aufweisen. Ein Soldat bittet darum, sich von seinem Freund vor unserem roten Passat fotografieren zu lassen. Lässig lehnt er sich ans Fahrzeug, schiebt die bollerige Schirmmütze in den Nacken, öffnet die Uniformjacke, neigt den Kopf neckisch zur Seite und lächelt. Sein Freund drückt ab.
Der größte Flohmarkt Moskaus auf dem riesigen Gelände des Ismailowski-Kultur- und -Freizeitparks ist schon deshalb eine besondere Attraktion, weil man hier unglaubliche Schätze entdecken und natürlich kaufen kann, in der Regel für Rubel, aber Devisen werden auch nicht verschmäht. Ganze Bildgalerien sind zwischen Büschen und Bäumen zur Schau gestellt. Alte Drucke, kistenweise Schwarzweißfotografien, alte Leicas, Musikinstrumente, Mobiliar, Münzen, Bildbände, Schallplatten, blauweißes Gzhel-Porzellan, Schmuck und Besteck aus Silber und Melchior, Fabergé-Eier, altes Spielzeug, natürlich Samoware und Souvenirs, vor allem Matrjoschkas und Palech-Lackdöschen - eigentlich alles, was das Herz begehrt, liegt dort dekorativ aus; unter der Hand werden Leninorden, Militaria-Artikel, Ikonen und bester Kaviar hervorgezaubert. Zwei Musiker in Kosakenuniform singen folkloristische Lieder und spielen Akkordeon dazu. Von überall her ist Musik zu hören. Dieses bunte Treiben und das Überangebot an Waren erschlagen einen förmlich. Was für ein enormer Kontrast zu dem, was die grauen Geschäfte dieser Metropole dagegen zu bieten haben! Wir stärken uns erst einmal mit einem deftigen Schaschlik. Und das wird uns vom Grill heiß und fettig direkt von Hand zu Hand überreicht. Die Brandwunden an den Fingern können wir erst nach dem Verzehr lindern.
Am frühen Nachmittag kommt die dritte Interdean-Fuhre. Die Kisten, die wir nicht unbedingt haben wollen, weil LAGER draufsteht, lassen wir diesmal wieder zurückgehen, wenn möglich, ins Lager. Immerhin ist jetzt mein Schreibtisch dabei. Zumindest sehe ich vom Balkon aus, wie er aus dem Lkw gewuchtet wird. Schön, dass ich ab heute nicht mehr am Esstisch arbeiten muss und meine ganzen Schulutensilien in diesem guten Stück verstauen kann. Wir schaffen schon mal Platz im geräumigen Wohnzimmer, wo er gleich aufgestellt wird. Die beiden deutlich kleineren Räume dienen als Kinderzimmer und Schlafzimmer.
Wir wundern uns, dass seit geraumer Zeit nichts mehr vom Interdean-Team zu sehen ist. Alle Mann sind aber noch da. Sie stecken rauchend ihre Köpfe zusammen und gestikulieren wild durcheinander. Der Schreibtisch hat schon die ersten Meter bis zum Hauseingang geschafft. Die Gruppe wird interessiert von unserem Milimann, so nennen wir unseren Milizionär, beäugt. Kurz darauf erfahren wir, man müsse ein kleines Problem lösen. Das Problem sei der Schreibtisch, und der wolle partout nicht in den Fahrstuhl passen, weder hochkant noch quer noch diagonal. „Aber das kriegen wir hin“, heißt es optimistisch. Man habe noch einige Tricks auf Lager, um das Teil zu überlisten. Das Ärgerliche sei, dass das Ding sechs Beine habe, und die könne man nicht abschrauben, höchstens absägen. Ich sehe mich schon im Geiste den Bürostuhl auf die gleiche Höhe kürzen. Wir sind gespannt auf die Tricks.
Als ich das nächste Mal vom Balkon auf das Szenario schaue, ist der Schreibtisch mit Gurten vertäut. Die Jungs wollten ihn flaschenzugartig über unseren Balkon in den sechsten Stock und von dort in die Wohnung hieven, bemerkten aber gerade noch rechtzeitig, dass die Balkontüren viel zu schmal für so ein Unterfangen sind. Das Fahrstuhlproblem würde also nur in die sechste Etage verlagert. Darüber, dass ebenso schmale Türen zum Treppenaufgang führen, sind die engagierten Packer nicht ganz unfroh. „Keine Chance, das Ding geht zurück“, sagt der Chef markig. Die Schreibtischplatten für den zweiten Arbeitsplatz hätten gut in den Fahrstuhl gepasst. Aber die sind diesmal leider noch nicht mit dabei.
Jetzt wird aufgeräumt. Die leeren Kartons regnen wieder mit großem Hallo hinab in die Tiefe. Dabei stören die im Hof parkenden Fahrzeuge nicht wirklich. Nur der Packer, der die Pappe von den Autodächern absammeln muss, ist nicht ganz so begeistert. Dafür darf er jetzt das Feuer im Drahtcontainer entfachen.
Im Bolschoi-Theater, für das Herr Knötzsch uns ja Karten organisiert hatte, sehen wir zusammen mit Hellmuth und Roswitha „Die Soldaten“ nach Jakob Michael Reinhold Lenz als moderne Oper von Bernd Alois Zimmermann, ein Gastspiel des Staatstheaters Stuttgart. Die Inszenierung ist beeindruckend, vor allem weil viel Action präsentiert wird, bei der das Bühnenpersonal zu Höchstleistungen herausgefordert ist. Auf mehreren Ebenen singen und spielen bis zu 45 Akteure auf der fast 40 Meter tiefen und 30 Meter hohen Bühne. Toneinspielungen, Diaprojektionen, hin und her schwingende Scheinwerfer, scheinbar sich bewegende Puppen und weitere Effekte unterstützen die Show. Später kommt noch eine Jazzband dazu. Die Handlung bleibt - wenn man sie nicht kennt – undurchschaubar, der Hoch-Tief-Wechselgesang klingt schrill und unverständlich. Die Briten in der Reihe vor uns fragen, was eigentlich gespielt wird. Recht bald geben sie auf und stehlen sich davon.
In der Pause stehen Sekt, Brote, Kuchen und vieles mehr zum Verkauf. Spätestens jetzt wissen wir, warum so viele Einheimische mit größeren Taschen bewaffnet sind. Sie nutzen diese Pause, um Defizitlebensmittel zu hamstern. Alltägliche Kleidung dominiert unter den Gästen. Besonders gestylte Menschen gehören meist einer ausländischen Delegation an, die von ihren ebenfalls vornehm gekleideten sowjetischen Gastgebern hierher eingeladen worden sind.
Als wir ganz oben im fünften Rang ankommen und den Blick über die samtroten Sessel und goldverzierten Balkone bis hin zu den prachtvollen Ehrenlogen schweifen lassen, entdecken wir zufällig Manfred, der offenbar die Opernaufführung für das ZDF aufzeichnet. Ein Toilettenbesuch ist weniger empfehlenswert. Dort werden Verstöße gegen das Rauchverbot scheinbar toleriert. Die bläulich vernebelten Räumlichkeiten sind restlos überfüllt von Süchtigen. Wer hier freiwillig länger verweilt, als er muss, hat sich mit seiner kurzen Lebenserwartung längst arrangiert.
Am Ende der Vorstellung gibt es minutenlang Applaus und Bravo-Rufe.
Auf dem Weg in die Dobryninskaja, wo wir noch einen Schampanskoje bei Hellmuth und Roswitha trinken wollen, um den gemeinsamen Abend abzurunden, machen wir unfreiwillig Bekanntschaft mit einem GAI, weil wir eine rote Ampel übersehen haben. Er pfeift energisch mit seiner schrillen Trillerpfeife und winkt uns unmissverständlich an den Straßenrand. Wir haben Glück; er belässt es bei einer freundlichen Ermahnung. GAIs sind Verkehrspolizisten. Sie gehören im ganzen Land zum Straßenbild und regeln den Verkehr. Ihren Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten. Ein GAI kontrolliert manchmal auch Fahrer, die nichts verbrochen haben oder etwas verbrochen haben sollen, von dem der Fahrzeughalter gar nichts weiß. Diskussionen und Rechtfertigungen geraten meist zum Nachteil des Beschuldigten. Hin und wieder sieht man, wie ein Gegenstand, der mal stark einem gerollten Schein und mal einer Packung Zigaretten ähnelt, blitzschnell im weiten Ärmel der Uniformjacke eines GAI verschwindet. So ist das Problem gelöst. Ein GAI darf nämlich mit einer Art Lochzange einem von ihm gestellten Verkehrssünder ein kleines Löchlein in seinen Führerschein knipsen. Das hat die gleiche Bedeutung wie ein Strafpunkt in Deutschland, der im Zentralregister in Flensburg aktenkundig wird. Ab einer bestimmten Anzahl von Löchern ist dann der Lappen weg. Aber es gibt auch, wie in unserem Fall, gut gelaunte, empathische GAIs. Hellmuth erzählt beim Schampanskoje, er habe bei einer angeblichen Verkehrsübertretung seine Papiere vorzeigen müssen. Die hatte er leider nicht dabei. Nicht einmal eine Sprawka hatte er zur Hand. Stattdessen zeigte er seine EC-Card vor. Nach großzügigem Kopfnicken und militärischem Gruß lotste der GAI Hellmuth wieder in den fließenden Verkehr.