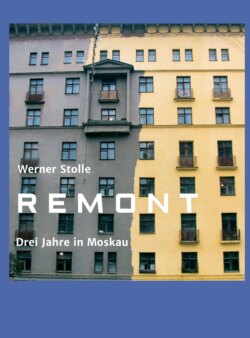Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMarkttreiben
30. September – 8.Oktober 1989
Wenn irgendwo in Moskau ersehnte Mangelware eintrifft, spricht sich das schlagartig überall herum. Heute gibt es Chiquita-Bananen auf dem Nowotscherjomuschkinskij-Kolchosmarkt - hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich unser Markt in der Wawilowa, und er ist nicht nur der mit dem längsten Namen, sondern auch der mit dem reichhaltigsten und qualitativ besten, aber auch teuersten Angebot der Stadt -. Da Südfrüchte grundsätzlich sehr selten zu finden sind, ist schon von weitem eine Riesenwarteschlange zu sehen. Diesen Umstand wiederum haben sich einige ältere Frauen zunutze gemacht. Sie bieten den Wartenden selbstgebackenes Brot und schmackhafte Piroggen zum Verkauf. Wir haben von beidem schon selbst probiert; es lohnt sich. Außerdem tut man ein gutes Werk, wenn man bei ihnen kauft, da man so ihre magere Rente auffrischt. Meist reisen die Frauen mit dem Überlandbus oder der Elektritschkaja, eine Art Bummelzug, der in jedem noch so kleinen Dorf anhält, in die Metropole, um ganz gezielt vor den Märkten, bisweilen auch in Parks und auf Bahnhofsvorplätzen, ihre selbsthergestellten Lebensmittel, oft auch Kleidung und Hausrat, zu verkaufen. Bei den extrem niedrigen Ticketpreisen für Bus und Bahn lohnt sich dies allemal, selbst wenn das Geschäft nicht so richtig läuft. Die Polizei greift nur ein, wenn es zu Rangeleien kommt und die öffentliche Ordnung gefährdet scheint. Es ist nicht direkt untersagt, sich durch privaten Handel ein Zubrot auf der Straße zu verdienen, aber auch nicht ausdrücklich erlaubt. Diese Grauzone dient letztlich auch dem Staat, der die Mangelwirtschaft zu verantworten hat.
Die Lage hat sich so zugespitzt, dass in staatlichen Läden angeblich jetzt, ab Oktober, Fleisch, Mehl und Grütze nur noch gegen Coupons ausgegeben werden sollen. Auch geht das Gerücht um, in der Stadt Kujbischew habe kürzlich weder Fleisch noch Zucker ausgegeben werden können, weil es zum Drucken der entsprechenden Zuteilungscoupons an Papier gemangelt habe.
Dazu passt, was wir in der Hauspostille lesen: Nach einer Umfrage des Soziologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften „erwarten 45 % der Moskauer für die nächsten zwei bis drei Jahre eine Verschlechterung ihrer materiellen Lage“.
Ein Knäuel hat sich um einen Anbieter gebildet, der Beutel mit Kaffeebohnen anpreist, allerdings zu einem für diese Verhältnisse unverschämt hohen Preis. Da aber viele Menschen, die auf dem Markt einkaufen, der, wie gesagt, sehr teuer ist, kann er davon ausgehen, dass sein Kaffee von Wohlhabenderen aufgekauft wird. Wer weiß, vielleicht gibt es erst in ferner Zukunft wieder echte Kaffeebohnen! Das ist das oberste Prinzip einer Mangelwirtschaft: Man kauft das, was plötzlich da ist; das, was man gerade dringend benötigt, ist nicht da. Also kauft man das, was man dringend eines Tages benötigen könnte, auch dann ein, wenn man es eigentlich nicht gerade jetzt braucht. Wer in der Bananenschlange Glück hat, bedient zu werden, bevor alles ausverkauft ist, nimmt natürlich so viele Bananen mit, wie er tragen kann, was dazu führt, dass sich nach jeder Kundenabfertigung eine gewisse Unruhe in der Warteschlange ausbreitet. Da fallen bisweilen auch unschöne Bemerkungen. Heute aber läuft alles ruhig und gesittet ab.
Am Sonntag mache ich mit den Kindern einen Ausflug zu den Leninhügeln. Auf dem Weg dorthin sehen wir auf einer Straßenkreuzung einen Wolga, ein etwas kleineres Auto als der Tschaika, oder die Tschaika, wie einige Insider sagen, weil Tschaika übersetzt „Möwe“ heißt. Der Wolga, hier wiederum sagt kein Mensch, auch der Insider nicht, die Wolga, ist aufgebockt, die Motorhaube geöffnet und eingerastet. Daneben steht sein Fahrer und schnitzt selbstvergessen mit einem Taschenmesser an einem Stück Holz herum. Sollte das fertige Endprodukt ein Ersatzwerkzeug werden, um damit die Panne zu beheben? Wir wollen das Ergebnis nicht abwarten und fahren, als die Ampel auf Grün schaltet, weiter.
Nicht alle Russen fahren bei Grün weiter. Diejenigen, die wissen, wann ungefähr die Ampel von Rot auf Grün springt, so kann man es nennen, denn das Orange wird im Prinzip immer ausgelassen, starten schon bei Rot, es sei denn, ein GAI steht direkt vor ihnen. Rote Ampeln legt der einheimische Fahrer oft zu seinen Gunsten aus. Worin liegt der Sinn, bei Rot anzuhalten, wenn doch die Fahrbahn vor einem frei ist? Noch nie waren wir in einem Land, wo die Verkehrsregeln so eigenwillig ausgelegt werden wie in der Sowjetunion, und das trotz der hohen Strafen, der überwiegend schlechten Zustände der Fahrzeuge und der üblen Straßenverhältnisse. Dazu gibt es eine Null-Promille-Vorschrift. Sogar „die Fußgänger halten sich prinzipiell nicht an die Verkehrsregeln. Viele von ihnen gehen vorzugsweise bei Rot über die Straße. Sie überqueren die Fahrbahnen an Stellen, an denen es keine Überwege gibt“, warnt die Botschaftsverwaltung. Besonders gefährlich sind Straßenbahn- und Bushaltestellen: „Aussteigende Passagiere pflegen an der Rückseite und an der Vorderseite der Busse ohne Rücksicht auf den Verkehr über die Fahrbahn zu laufen.“ Warum die Menschen täglich ihr Leben riskieren, bleibt mir ein Rätsel.
Gerade noch hatten wir warme Septembertage. Heute, es ist der 2. Oktober, bedeckt eine ca. fünf Zentimeter dicke Matschschneedecke Straßen und Wege.
Dieser plötzliche Wetterumschwung ist wahrscheinlich die Ursache dafür, dass nun für zwei Tage weder die Heizung noch das warme Wasser funktioniert. Der Jahreszeitenwechsel ist schon seit Tagen in der Öffentlichkeit zu beobachten. Gehen die Temperaturen am Ende des Sommers zurück, was ja nicht gerade ungewöhnlich ist, gibt es Veränderungen im Stadtbild. Die russischen Kinder dürfen von nun an nur noch mit Mütze, Schal und Handschuhen das Haus verlassen, selbst dann, wenn die Temperaturen wieder ansteigen sollten. Die Eltern sind sehr besorgt, dass ihre Kinder sich einen grippalen Infekt einfangen könnten. Diese Sorge ist der Anlass für diese beinharte Erziehungsmaßnahme. Andererseits weiß man, wie schwierig es ist, im Krankheitsfall an Medikamente zu gelangen. Auch die Versorgung in den Krankenhäusern ist alles andere als optimal.
Piroschka, eine Kollegin aus Ungarn, die mit einem Deutschen verheiratet ist, der in Moskau bei Hoechst arbeitet, unterrichtet an unserer Schule Russisch. Sie hat heute Geburtstag und gibt einen aus: ungarische Salami, ungarischer Kuchen, Tokajer und Schampanskoje. Ungarische Spezialitäten kauft Piroschka regelmäßig in einem unscheinbaren ungarischen Geschäft in der Dorogomilowskaja Ulitsa ein. Während wir diese Kostbarkeiten im Lehrerzimmer genießen, diskutieren wir über das, was wir seit gestern durch das Fenster beobachten. Gegenüber, vor der amerikanischen Botschaft, wimmelt es nur so von Menschen. Insgesamt sollen es an die 50 000 an diesen beiden Tagen sein, die gegen die neuen Einwanderungsgesetze der USA demonstrieren. Ausgelöst wurde diese Protestaktion, als immer mehr Armenier vor das Gebäude der Botschaft zogen in der Hoffnung auf ein Ausreisevisum. Die Armenier wollen wegen der massiven Blockaden und Schikanen der Aserbaidschaner das Land verlassen und in die USA auswandern.
Am Tag der Verfassung, dem 7. Oktober, kommt es auch in der Gorkowo Ulitsa zu größeren Menschenansammlungen. Wir entdecken Transparente der russischnationalen Front, Jelzin-Fotos werden in die Höhe gehalten, Menschen aus dem Baltikum fordern eigene, unabhängige Staaten. Alle Demonstrationen und Menschenketten verlaufen friedlich. Die Polizei, die alles im Blick hat, muss nirgendwo einschreiten.