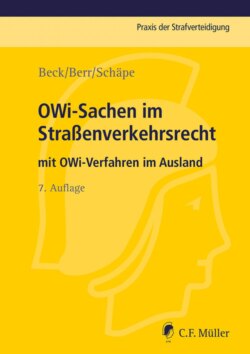Читать книгу OWi-Sachen im Straßenverkehrsrecht - Wolf-Dieter Beck - Страница 67
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Rechtsprechung des BGH und des BVerfG
Оглавление168
Die Streitfrage ist schließlich dem Bundesgerichtshof[26] zur Entscheidung vorgelegt worden zur Klärung folgender Rechtsfrage:
„Ist auch nach dem In-Kraft-Treten der Bußgeldkatalogverordnung am 1.1.1990 vor der Verhängung eines Fahrverbotes grundsätzlich zu prüfen, ob auf den Täter nicht durch eine empfindliche oder verschärfte Geldbuße hinreichend eingewirkt werden kann oder ist diese Prüfung jetzt nur in den erheblich vom Normalfall abweichenden Fällen erforderlich?“
169
Der BGH hat in drei grundsätzlichen Entscheidungen[27] eine Weichenstellung vorgenommen. Zunächst einmal hat der BGH zum Ausdruck gebracht, dass eine erstmalige, grobe Pflichtverletzung durch vorsätzliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit – im entschiedenen Fall war diese mehr als das Doppelte – die Verhängung eines Fahrverbots rechtfertigen kann, ohne dass es noch einer ausdrücklichen Feststellung darüber bedarf, der durch das Fahrverbot angestrebte Erfolg könne auch mit einer erhöhten Geldbuße nicht erreicht werden. In gleicher Weise soll dies nach Auffassung des BGH in allen Fällen des Regelfahrverbots nach der Bußgeldkatalogverordnung gelten. Immer dann also, wenn ein Fahrverbot im Bußgeldkatalog im Regelfall vorgesehen ist, muss der Richter nicht mehr ausdrücklich feststellen und begründen, dass der durch das Fahrverbot angestrebte Erfolg auch mit einer erhöhten Geldbuße nicht erreicht werden kann. Schließlich hat der BGH dies auch noch zum Ausdruck gebracht für den Fall, wenn gegen den Führer eines Kraftfahrzeugs schon einmal wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist und er innerhalb eines Jahres seit der Rechtskraft dieser Entscheidung noch einmal eine Überschreitung von mindestens 26 km/h begeht.
170
Diese Entscheidungen entbinden den Richter allerdings nicht von der Prüfung darüber, ob überhaupt ein Regelfall vorliegt (also normale Fahrlässigkeit, gewöhnliche Tatumstände!). Kein Regelfall kann beispielsweise auch bei einem defekten Tacho gegeben sein.[28]
171
Aus der Rechtsprechung des BGH und des BVerfG ergibt sich Folgendes:
Bei vorgesehenen Regelfahrverboten nach dem Bußgeldkatalog kann das Gericht zunächst einmal grundsätzlich davon ausgehen, dass diese auch zu verhängen sind. Es ist verfassungsrechtlich zulässig, in der Bußgeldkatalogverordnung grobe und beharrliche Verstöße zu konkretisieren. Das Gericht ist allerdings an die Indizwirkung der Regelbeispiele nicht gebunden, es hat eine Gesamtwürdigung vorzunehmen unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls in objektiver und subjektiver Hinsicht.[29] Das Gericht muss prüfen, ob ein Regelfall vorliegt, also ein Fall, wie er in der Bußgeldkatalogverordnung ausgewiesen ist. Ergeben sich keine Anhaltspunkte für ein Abweichen von dieser Regelumschreibung, so ist grundsätzlich das vorgesehene Fahrverbot zu verhängen. Ein geringerer Begründungsaufwand ist in diesem Fall zulässig. Das Gericht muss dann nicht mehr wie bisher ausführlich prüfen, ob anstelle des an sich verwirkten Fahrverbots eine höhere Geldbuße ausreicht, als sie im Bußgeldkatalog vorgesehen ist.[30]
172
Allerdings müssen die Urteilsgründe erkennen lassen, dass der Richter sich der Möglichkeit bewusst war, bei Vorliegen entsprechender Umstände statt auf ein Fahrverbot auf eine den Regelsatz übersteigende Geldbuße erkennen zu können, wenn insoweit das Sanktionsziel erreicht werden kann. Zumindest muss dies dem Gesamtzusammenhang des Urteils zu entnehmen sein.[31] Eines ausdrücklichen Ansprechens der Möglichkeit des Absehens vom Fahrverbot bedarf es allerdings dann nicht, wenn der Begründung des Urteils eindeutig zu entnehmen ist, dass der durch das Fahrverbot angestrebte Erfolg durch eine Erhöhung der Buße bei gleichzeitigem Wegfall des Fahrverbots nicht mehr erreicht werden kann.[32] Das Gleiche gilt grundsätzlich bei einem Verstoß gegen § 24a StVG.[33]
Hinweis
Für den Verteidiger gilt es genau zu prüfen, ob die fragliche Ordnungswidrigkeit fahrlässig und unter gewöhnlichen Umständen verwirklicht worden ist oder aber, ob es irgendwelche Gründe dafür gibt, von abweichenden Kriterien auszugehen, die einen minderen Fall annehmen lassen. Liegt also bei einem Unfall z.B. ein Mitverschulden des Gegners vor oder ergibt sich aus der Tatausführung oder auch in der Person des Betroffenen zu seinen Gunsten etwas vom Normalfall Abweichendes, dann muss nicht immer ein Regelfall vorliegen. Dies kann der Fall sein auch bei besonderer beruflicher Belastung des Betroffenen oder bei nicht typischen Verstößen (z.B. atypische Rotlichtverstöße!). Nach den grundlegenden Entscheidungen des BGH[34] reichen für ein Absehen vom Fahrverbot erhebliche Härten für den Betroffenen aus. Derartige Abweichungen vom Normalfall müssen im Urteil ausgeführt und begründet werden.[35]
173
Bei einer erstmaligen groben Pflichtverletzung durch vorsätzliches Handeln, etwa durch vorsätzliches Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, kann nach der BGH-Rechtsprechung ebenfalls ein Fahrverbot verhängt werden, ohne dass es der ausdrücklichen Feststellung bedarf, der durch das Fahrverbot angestrebte Erfolg könne auch mit einer erhöhten Geldbuße nicht erreicht werden. Dies gilt auch wenn der beharrliche Pflichtverstoß von besonders starkem Gewicht ist.[36] Dies gilt allerdings nur dann, wenn zusätzliche Anhaltspunkte (wie z.B. rücksichtsloses Vorgehen) eine besondere Verantwortungslosigkeit erkennen lassen. Bei „normalen“ vorsätzlichen Verstößen muss das Gericht dagegen nach wie vor zusätzliche Umstände feststellen und festhalten, die eine besondere Verantwortungslosigkeit begründen, um ein Fahrverbot verhängen zu können. Bei einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung (z.B. 150 statt 100 km/h) kann sich nach der BGH-Rechtsprechung vorsätzliche Begehung aufdrängen.[37] Aus dem Maß der Geschwindigkeitsüberschreitung allein kann allerdings nicht immer auf Vorsatz geschlossen werden, es müssen noch andere Gesichtspunkte hinzutreten, z.B. teilweises Geständnis.[38] Wenn der Betroffene anstelle eines fahrlässigen Verstoßes wegen Vorsatzes verurteilt werden soll, muss er vorher darauf hingewiesen werden.[39]
174
Bei allen anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG, also bei Verstößen, bei denen im Bußgeldkatalog kein Regelfahrverbot in Betracht kommt, ist die Frage der Anordnung eines Fahrverbots weiterhin direkt aus § 25 StVG heraus zu entscheiden. Hier gilt also nach wie vor die bisherige obergerichtliche Rechtsprechung, insbesondere die des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht muss stets prüfen, ob anstelle des an sich verwirkten Fahrverbots nicht auch eine erhöhte Geldbuße ausreichend ist. Dies verlangt nicht nur der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der BGH hat dies auch ausdrücklich bestätigt.[40] Die grundlegende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die mehrmals bestätigt wurde, gilt nämlich fort, sie hat für die Auslegung des § 25 StVG Gesetzeskraft. Bei Verstößen nach § 24 StVG, soweit kein Regelfahrverbot nach dem Bußgeldkatalog vorliegt, ist somit nach wie vor insbesondere auch zu prüfen, ob eine grobe Pflichtverletzung, d.h., ein besonders verantwortungsloses Verhalten oder eine beharrliche Pflichtverletzung festzustellen ist.[41]
Teil 1 Ordnungswidrigkeitengesetz › IX. Fahrverbot › 5. OLG-Rechtsprechung, Ausnahme vom Regelfahrverbot