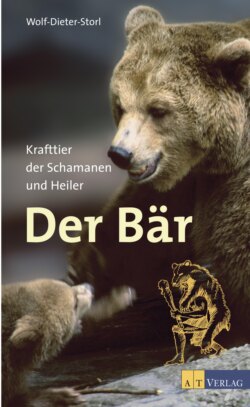Читать книгу Der Bär - Wolf-Dieter Storl - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBegegnung mit Maheonhovan
»Der Bär besitzt Macht – spirituelle Macht.
Er kann sich selber heilen, und er kann andere Bären heilen.
Er ist ein großes Medizin-Tier.«
Aussage eines Cheyenne (nach Grinnell 1923: 105)
»Der Bär war für die Indianer Amerikas ein ganz besonderes Geschöpf.
In den Legenden aus der Tierwelt wird dem Bären
aufgrund seiner Fairness, Strenge und seines Mutes
die Rolle des Vorsitzenden der Tierversammlung zugeschrieben.
In den meisten Stämmen ist der Bärenklan Medizin-, Führungs-
und Verteidigungsklan.«
Sun Bear, Medizinrad
Im Auftrag der National Parks Administration hackten wir Pfade durch die endlosen, in grünes Zwielicht getauchten Regenurwälder. Ohne den aufgeschreckten Rehen, die vor uns flüchteten, oder dem geräuschlosen Vorbeischweben eines weißköpfigen Seeadlers viel Aufmerksamkeit zu schenken, fraßen wir uns über glitschige moosbedeckte Felsen und durch endlose triefende Haine von Riesenfarnen hindurch. Die Riesenfarne bildeten das unterste Stockwerk des Waldes, der aus gigantischen Hemlocktannen, Douglasien, Fichten und Zedern bestand. Unsere Arbeitsgruppe sollte die Olympic Wilderness nahe der Pazifikküste für den Tourismus erschließen. Wo bisher kaum ein Weißer seinen Fuß hingesetzt hatte, sollten nun Wege, Stege und Unterkünfte entstehen. Bei dieser Gelegenheit wurde ich das erste Mal Zeuge der sprichwörtlichen Bärenkraft.
An einem Rastplatz galt es eine Abfallgrube auszuheben. Geräumig und bärensicher sollte sie sein. Fast eine Woche lang schaufelten wir daran. Stämmige Fjordpferde schleiften die dicken Zedernstämme herbei, die wir dann, dicht aneinandergefügt und mit Querbalken befestigt, über die Grube legten. Nun war es so weit. Die ersten Abfälle – unsere eigenen – plumpsten in die Tiefe. Bären, deren Nasen nur mit denen von Spürhunden zu vergleichen sind, können, wie Verhaltensforscher ermittelt haben, einen Abfallhaufen auf eine Entfernung von dreißig Kilometern wittern, und da ihr Geschmack dem des Menschen ähnlich ist, war es kein Wunder, dass wir es schon in der ersten Nacht krachen hörten. Die mühevoll errichtete bärensichere Abfallgrube war dahin. Als wir aus dem Fenster unserer Hütte schauten, sahen wir gerade noch, wie ein Bär die schweren Stämme mit einem Ruck zur Seite zog und in die Grube rutschte, um dort beglückt die leeren Büchsen auszulecken, Steakknochen zu knacken und Obstschalen zu mampfen.
Bären sind keine feigen Hunde
Von der außergewöhnlichen Kraft der Bärenpranke war auch der alte Cowboy, dem ich in einer Bar in Montana begegnete, überzeugt. Er erzählte mir, während er eine Whiskeyflasche leerte, von einer Begegnung mit dem Herrn der Wälder. Der Grizzly, den er überrascht hatte, verpasste seinem Pferd einen derart gewaltigen Nackenschlag, dass es mit dem Reiter auf dem Rücken tot zusammenbrach. Der Cowboy konnte gerade noch seinen Colt ziehen und den Bären niederstrecken. »Nimm eine großkalibrige Flinte mit, wenn du ins Gebirge reitest«, riet er mir.
Guter Rat, aber überflüssig. Die Söhne des Ranchers, mit denen ich gelegentlich in das Gletschergebiet der hohen Rockys ritt, um einige Tage von der Arbeit auszuspannen, hatten sowieso immer griffbereit Schrotflinten im Halfter am Sattel hängen. Glücklicherweise wurden wir beim Reiten nie von einem Bären überrascht.
Tagsüber, wenn wir in den kristallklaren Gebirgsbächen Forellen angelten oder die Beine am Lagerfeuer ausstreckten, ließ sich Meister Petz kaum sehen. Nachts aber, wenn das Feuer, fast erloschen, noch sanft rubinrot glühte, hörte man ab und zu neugierig schnüffelnde Petze, die, vom Geruch des Proviants angezogen, ums Lager strichen.
Unvorsichtige Camper, die ihren mit Keksen, Äpfeln, Schokolade und Sandwiches gefüllten Rucksack nachts als Kopfkissen benutzen, können ein schlimmes Erwachen erleben. Der Bär, der nichts Böses im Sinn hat, aber eben einen Riesenappetit, schiebt einfach den Kopf des arglosen Schläfers beiseite, um an die Köstlichkeiten zu gelangen. Leider kennt er weder seine eigene Kraft noch die Zerbrechlichkeit des menschlichen Genicks. Deshalb bewahrt der kluge Camper keine Nahrungsmittel im Zelt auf, sondern spannt vorsichtshalber ein Seil zwischen zwei Bäume und hängt seine Verpflegung in sichere Höhe, außer Reichweite des Vielfraßes.
Wenn man öfter Gelegenheit hat, Bären zu begegnen und sie zu beobachten, wird man leicht unvorsichtig. Man glaubt, sie gut genug zu kennen. Das dachte ich auch, bis ich einmal einen Sommerjob als Buletten-Brutzler in einer Imbissbude im Yellowstone-Park annahm. Am Morgen war gerade frisches Hackfleisch geliefert worden. Die Pappkartons, in denen es verpackt gewesen war, lagen noch am Nachmittag im Hinterhof. Als gerade mal keine Touristen nach Hamburgern und Cola anstanden, ging ich in den Hof, um die Kartons einzusammeln. Aber da war schon ein Schwarzbär, der genüsslich schmatzend die Pappe ableckte. Da ich den Anblick dieser Tiere gewöhnt war, gedachte ich, ihn wie einen streunenden Köter zu verscheuchen. Wild mit den Händen fuchtelnd, lief ich auf ihn zu und herrschte ihn an: »He, weg da!« Aber Bären sind eben keine feigen Hunde. Er schaute auf, musterte mich, legte die Ohren an, schnaufte wütend und versetzte einer der Kisten einen so gewaltigen Prankenschlag, dass sie wie ein von einem World-Cup-Kicker getroffener Fußball durch die Luft fetzte. Dann raste er auf mich zu. Ich kann schnell laufen und war als Schüler sogar Bester in Leichtathletik, aber so schnell wie ein Bär ist kein Mensch. Die scheinbar so gemütlichen und schwerfälligen Tiere sind, wenn es darauf ankommt, regelrechte Geschwindigkeitsdämonen. Auf kurzer Strecke sind sie fast so schnell wie ein Pferd. Sechzig Stundenkilometer schaffen sie völlig problemlos. Ich erreichte gerade noch die Hintertür, der Bär mir dicht auf den Fersen, als die Tür von der Köchin aufgerissen wurde, die den Vorfall beobachtet hatte. Aus einer Wasserpistole, die sie in der Hand hielt, sprühte ein dünner Strahl und traf den Bären unmittelbar auf die Nase. Das rettete mir in letzter Sekunde das Leben. Die Wasserpistole enthielt Ammoniak. Die Köchin hatte diese ungefährliche Waffe immer bereitliegen, und es war nicht das erste Mal, dass sie gegen die neugierigen Schnüffler zur Anwendung kam. Der Getroffene machte auf der Stelle kehrt und rannte davon. In sicherer Entfernung hielt er inne und rieb sich mit beiden Tatzen die arg beleidigte Nase. Auch wenn er mir den eigentlich verdienten Prankenhieb nicht hatte geben können, hatte der Bär mir dennoch eine gute Lektion in Sachen Respekt vor dem König des Waldes erteilt.
Schwarzbär oder Baribal.
Licht in der Bärenseele
Ein tieferer Einblick in die unergründliche Bärenseele wurde mir jedoch erst durch eine spätere Begegnung im Hochland von Montana gewährt, von der ich nun berichten will.
Einen ganzen Tag lang war ich durch die sommerliche Wildnis gewandert, ohne auch nur einem einzigen Menschen zu begegnen. Der Duft des Steppenbeifuss würzte die Luft, Elche ästen in den sumpfigen Niederungen, Präriehunde pfiffen und Adler zogen ihre Kreise hoch oben am wolkenlosen tiefblauen Himmel. Als sich dieses Tiefblau mit der untergehenden Sonne in ein glühendes Rot-Lila-Gelb verwandelte und die Kojoten ihr Abendkonzert anstimmten, kletterte ich einen steilen Hang empor, wo eine einsame knorrige Ponderosa-Kiefer stand, unter der ich mein Nachtlager aufzuschlagen gedachte. Als ich die Wölbung des Hügels erreichte, standen plötzlich drei Grizzlybären unmittelbar vor mir – so nahe, dass ich sie hätte berühren können. Hoch aufgerichtet standen sie da, mit erhobenen Tatzen.
Ich war übermannt. Sämtliche Gedanken und Gefühle waren plötzlich wie weggewischt. Ich weiß nur noch, dass ich dem mir am nächsten stehenden Bären in die Augen blickte, und mir war, als schaute ich unmittelbar in die Sonne. Helles Licht flutete mir aus diesen Augen entgegen, und ich erlebte etwas, das man nur als einen Moment der Ewigkeit bezeichnen kann.
Plötzlich machte der Bär »wuff«, als sage er: »So!«, ließ sich auf alle viere nieder und trottete gemächlich an mir vorbei. Die anderen beiden folgten. Wahrscheinlich war es ein Muttertier mit zwei fast ausgewachsenen Jungen.
Die Cheyenne-Indianer, mit denen ich gut befreundet war, meinten später, ich sei dem Maheonhovan, dem »himmlischen Bären« in seiner irdischen Gestalt begegnet, dem Bären, den man sonst am Nachthimmel in der Nähe des Polarsterns sieht. Er sei der Wächter der wilden Tiere, kenne die stärkste Medizin und könne sprechen. Den Menschen erscheine er als großer, weiß leuchtender Bär.
Urgeister und der weiße Bär. (Gemälde von Dick West, Cheyenne)
Damals war ich noch jung und glaubte noch zu sehr an die alleinige Gültigkeit der »objektiven Wissenschaft«, um diesen Indianergeschichten viel Bedeutung beizumessen. Dennoch musste ich oft an diese Begegnung denken. Sie rief mir die Märchen, die mir meine Großmutter erzählt hatte, wieder in Erinnerung. Auch da erscheinen leuchtende Bären. »Schneeweißchen und Rosenrot« erzählt von einem Bären, der den kalten Winter in der einsamen Waldhütte, in der die Mädchen mit ihrer Mutter wohnen, verbringt. Im Frühling, als sie ihn zur Tür hinauslassen, reißt er sich den Pelz an einem Nagel auf. Goldenes Licht blitzt unter dem Fell hervor! Im Märchen vom Bärenhäuter verbirgt sich ebenfalls unter einem rauen, verwilderten Äußeren eine strahlende Seele aus Gold. Auch sibirische Sagen kamen mir in den Sinn, in denen von dem Sternenlicht erzählt wird, das der Bär in seinem Inneren trägt. Von all dem werden wir später noch mehr erfahren.
Gerade heute, als ich die Zeilen über die Bärenbegegnung noch einmal durchlas, kam mit der Post ein Buch – »Tierisch gut« von Regula Meyer –, das sich mit dem Sinn und den Deutungsmöglichkeiten von Tierbegegnungen auseinander setzt. Ein guter Freund hatte es mir geschickt. Als Erstes wird die Berührung durch den Bären besprochen. Da heißt es unter anderem: »Die Botschaft des Bären ist für den modernen Menschen eine Erinnerung an Wurzeln, nach denen er sich wieder zu sehnen beginnt, die aber beinahe verloren gingen. Der Bär ist die Verbindung zu unseren Urwurzeln. Er erinnert uns an unsere irdische Herkunft, er zeigt uns den Weg durchs menschliche Leben und verbindet uns mit unserer menschlichen Bestimmung.«
Der Bär verbindet mit den Ahnen, mit den Urmenschen, die ihn einst verehrten, und mit den Menschen, deren genetische Muster wir geerbt haben. »Genauso, wie wir den Bären aus unseren Wäldern vertrieben haben, versuchen wir, uns von den Ahnen und ihren Erfahrungen zu distanzieren und zu befreien. Der Mensch muss lernen, mit den Gesetzen der Natur zu leben und auch den inneren und äußeren Raubtieren ihren Platz zuzugestehen.«
Der Bär mahnt uns, wieder in das natürliche Bewusstsein einzusteigen. »Lassen Sie Instinkt, Intuition, Neugierde und Lebenskraft zu den Werkzeugen werden, die Ihren Hunger nach Leben lenken und die sie immer neue Freuden und Erfahrungen machen lassen. Und achten Sie darauf, wann es Zeit wird, in die tiefe, innere Dunkelheit zu sinken, um von den gemachten Erfahrungen in Stille und Ruhe zu zehren« (Meyer 2004: 20).