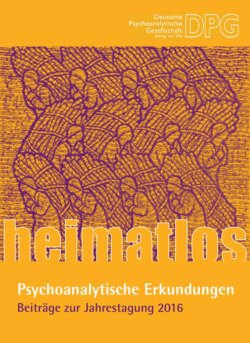Читать книгу heimatlos - Joshua Durban - Страница 7
Heimat, eine Gebrauchsgeschichte zwischen Fürsorge und Verbrechen (F. Schmoll)
ОглавлениеHeimat ist ein vermintes Gelände, ein kontaminiertes Feld für eine volkskundliche Kulturwissenschaft. Es ist die vage Unschärfe, die das schlichte Wortgeschöpf verfügbar macht für jedwelche Absichten und fast immer auch ihr Gegenteil – Integration und Exklusion, Fürsorge und Abweisung, Humanisierung und Vernichtung. Die gespaltene Beziehung, welche dieses Fach – ehedem „Volkskunde“, heute auch Europäische Ethnologie, Empirische Kulturwissenschaft, mitunter auch Kulturanthropologie geheißen – zur Heimat unterhält, liegt nicht nur an dieser Disziplin, sondern in der Sache selbst. In ihrem Namen wurden und werden ganz unterschiedliche, auch widersprüchliche Erfahrungen Intentionen reklamiert.
So gilt für diese Disziplin, was Margarete Hannsmann einmal trefflich in ihrem persönlichen Bekenntnis „Heimatweh“ vortrug: Es gebe kaum ein Wort, so Hannsmann, „das mich zerreißt wie dieses“ – unfassbar unbestimmt im Niemandsland zwischen „schierer Angst“ und „reinstem Glückszustand“. „Schiere Angst“ befiel sie vor bornierter Enge, vor kleinkarierter Gartenzwergkultur und provinzieller Selbstgenügsamkeit. Heimat also zuvorderst als Zwang, Zurückgebliebenheit, als muffige Enge. Einerseits, andererseits aber eben auch: „reinster Glückszustand“, weil kein anderes Wort ihre Gefühle von Geborgenheit, von Aufgehobensein – die Erfahrung einer Übereinstimmung von Innen und Außen, von Vertrautheit mit der Welt besser benennen könne als eben diese scheinbar schlichte Vokabel Heimat (Hannsmann 1986, S. 36).
Für eine volkskundliche Kulturwissenschaft ist nicht nur ein individuelles, sondern ein kollektives Unbehagen mit einer immer unentschiedenen Heimat zu diagnostizieren. Es war in jedem Fall stets eine innige Liaison, aber eben mitunter auch eine verquere, die da unterhalten wurde. Warum, das ist im Grunde genommen simpel; das lag und liegt an einer weithin ungeklärten Doppelrolle gegenüber einem Gegenstand, den man einerseits unentwegt selbst mitproduzierte und gleichzeitig auch aus gebotener Distanz analysierte. In der Rolle des Doppelagenten sozusagen, teilnehmend und beobachtend zugleich, laborierte diese Disziplin unentwegt mit an der „Identitätsfabrik“ Heimat (Köstlin, 1991). Sie modellierte und zementierte Vorstellungen von der schicksalhaften Prägekraft von Heimat-Räumen und Herkunftsgemeinschaften. Ein nicht ungewichtiger Ahnherr des Faches, John Meier, verstand dieses nach dem Trauma des Ersten Weltkriegs denn auch unumwunden als „geistiger Heimatschutz“ (Meier Vorwort, S. 13), als Sinnstifterin, die in einer zerrissenen, krisengeschüttelten Gesellschaft platt gesagt Geborgenheit und Harmonie produzieren sollte. Jedenfalls: In der Gebrauchsgeschichte des Begriffes kippte das Versprechen, das Eigene und Vertraute bewahren zu wollen, regelmäßig in militant-xenophobe Wendungen gegen Fremdes und Offenes. Heimat fungierte alsbald als ideologisch aufgeladene Abwehr- und Abschottungsformel, sodass sich durch und durch Widersprüchliches – Regression und Utopie, Glück und Verbrechen, Humanisierung und Barbarei – an dieses eigentümlich schillernde Wort lagert. Immerzu mobilisierten Imaginationen des Heimatlichen als Kehr- und Nachtseite auch die Bereitschaft zu rücksichtlosem Exzess – das Unheimliche als verdrängter Anteil des Heimisch-Vertrauten (Freud 1919). Nur vordergründig Nicht-Zusammengehörendes kennzeichnet die beiden Seiten einer deutschen Heimat-Geschichte.
Diese Zwiespältigkeit ist geblieben – auch und gerade in unserer Gegenwart, in der wieder viel von Heimat die Rede ist. Globalisierung, beschleunigter Wandel, Migration – eine Welt in Bewegung, Auflösung und Neuordnung: Das sind unruhige Zeiten, in denen „Heimat“ offenkundig besondere Plausibilität entfaltet, in vielerlei Hinsicht Sinn zu stiften scheint (Costadura und Ries 2016). An dieser Stelle könnte gefragt werden: Ist der Begriff vonnöten oder verzichtbar? Vielleicht ist dies schon eine falsche Frage: Wenn dieser Begriff immer wieder mit unterschiedlicher Intonation und Akzentuierung aufgerufen wird, dann sind ihm offenkundig bestimmte Erfahrungen und Bedürfnisse eingeschrieben, die nicht einfach sprach- und gesinnungspolizeilich abgesprochen werden können. Die Berufung auf Heimat kann nicht einfach abgesprochen werden, genauso wenig wie jemand Liebe abgesprochen werden kann, auch wenn sie noch so auf Selbsttäuschung basieren mag. Aber zu fragen wäre in jedem Fall nach den Wirkungen des Wortes: Verschleiert es mehr als es zu klären imstande ist? Der Anspruch auf Heimat – ein legitimes Recht oder ein hoffnungsloses Vereinfachungsversprechen?
Das wäre ja vielleicht schon eine erste wichtige Beobachtung: Das Reden über Heimat hört nicht auf, sondern erfährt im Rhythmus bestimmter Krisen immer wieder Konjunktur. Dieses zweisilbige Wörtchen hat etwas von einem hartnäckigen Wiedergänger, der sich zumindest nicht ordentlich begraben lässt, sondern in regelmäßigen Zyklen immer wieder Krisensymptomatik und Klärungsbedarf signalisiert. Dann wäre zu klären: Liegt das nun daran, dass das „Chamäleon Heimat“ (Bausinger 2009) etwas benennt, das ohne dieses Wort nicht sagbar wäre? Transportiert der Begriff Sehnsüchte, die ohne ihn nicht auskommen? Oder ist es gerade umgekehrt: Besitzt er gerade deshalb seine Anziehungs- und Verführungskraft, weil er so schön verwässert und Nebel wallen lässt – weil er so geschmeidig und kaugummiartig als Platzhalter oder „Plombe“ (Parin 1996) in jede Lücke passt? Was meinen eigentlich diejenigen, die Heimat sagen? Zumindest mag auf den ersten Blick irritieren, in welch unterschiedlichen Zusammenhängen auf sie zurückgegriffen wird und welche Fülle an Erscheinungsformen zu beobachten ist, wenn man sich an eine kleine Inventur von Heimat-Sprechweisen macht.
Unisono bei Lidl oder Edeka bewerben Slogans wie „Heimat ist Ursprung“ oder „Unsere Heimat“ zusammen mit Hübsch-Bildern aus idyllischen Landlust-Welten fragwürdig billige Lebensmittel, die eben garantiert nicht aus sozial und ökologisch intakten Umwelten, sondern aus denaturierten Agrarfabriken stammen. Offenbar benötigt es solch mentaler Geschmacksverstärker wie „Heimat“, dass solche Produkte als einverleibbare Nahrung überhaupt identifiziert werden können – Heimat als mentaler Ersatz, als Selbsttäuschung und Kompensation.
„Unsere Heimat bleibt deutsch“ – heißt es entschieden auf den Transparenten von AfD oder Pegida. Gemeint sind die Kampfparolen weniger als ein selbstgewisses Bekenntnis zum Eigenen, sondern vor allem als Abwehr und Abwertung der Anderen. Hier wird im Namen der Heimat militante Ausgrenzung vollzogen.
Heimat präsentiert sich in Erscheinungsformen des Kitsches und Kommerzes seit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts in allerlei ästhetisierten Varianten: Heimatroman, Heimatfilm, Schlager, Verdirndelung, folkloristische Kulissenheimaten und künstliche Idyllen des Tourismus (Egger 2014).
Heimatgeschichte oder eine „Heimatkunde des Nationalsozialismus“ betrieb der Kulturwissenschaftler Utz Jeggle (Projektgruppe Heimatkundes des Nationalsozialismus 1989) und reklamierte bewusst diesen Begriff, um ihn nicht den Heile-Welt-Aquarellisten zu überlassen. Er hätte bei Versuchen, den Nationalsozialismus in der Welt des Alltäglichen verstehen zu wollen, ja auch ganz nüchtern „Lokalgeschichte“ sagen können oder „Lebenswelten im Nationalsozialismus“. Aber es ging ihm dezidiert um Heimat einerseits als Ort des Zutrauens und der Geborgenheit und andererseits um dessen Nachtseiten, die unheimlichen Abgründe des Heimelig-Vertrauten.
„Heimat ist da, wo ich keine Scheiße an der Backe habe“, meinte einmal überaus entschieden eine Studentin in der ersten Sitzung eines Heimat-Seminars. Nach höflichem Insistieren auf weniger Anschaulichkeit und mehr Konkretion, sprach sie von ihrer Sehnsucht nach einer Welt, in der nicht alles kompliziert und undurchschaubar scheint, und von einem sozialen Raum, in dem sie sich nicht verstellen und verbiegen müsse, sondern „einfach so“ angenommen werde.
„Making Heimat – Germany, Arrival Country“. So lautete 2016 der deutsche Beitrag zur internationalen Architekturausstellung in Venedig. Dabei geht es um die brisante Frage, wie den Heimatlosen unserer Zeit, den Hunderttausenden von Flüchtlingen, nicht nur ein funktionelles Dach über dem Kopf, sondern auch Räume gegeben werden können, die in der Unwirtlichkeit unfreiwilliger Fremde tatsächlich ein Zuhause sein könnten. Auch wenn an Heimat gelagertes Denken und Fühlen immer von Erfahrungen des Verlustes stimuliert werden und mit Intentionen der Kontingenzbewältigung einhergehen: Im Kontext von Flucht, Vertreibung und Migration drängt ihre Abwesenheit am intensivsten zur Vergegenwärtigung von Heimat.
„Heimatschutz“ war um 1900 eine bildungsbürgerliche Bewegung, die die Kehrseite des Fortschritts, die Destruktionsmöglichkeiten moderner Industriezivilisationen und damit auch die Frage nach der Natur, aber auch nach Tradition stellte. Da war zunächst einmal also ein Gestus der Fürsorge, eine bewahrende Zuwendung … Alsbald kippte das in einen Kult des Eigenen und die Eigenart, die zunächst geschützt werden sollte mutierte zum Arteigenen …
„Heimatschutz“ – in der Variante des „Thüringer Heimatschutzes“, aus dem sich der Nationalsozialistische Untergrund schälte, war dies die Legitimation für eine Mord- und Terrorserie gegen alles Nicht-Deutsche.
Das scheint bemerkenswert – dieses reibungslose Hinübergleiten, das Kippen von Fürsorge ins Gegenteil, von Grün nach Braun, dieses chamäleonartige Changieren von Heimat-Kündern zwischen Humanisierungsversprechen und entfesselter Brutalität. Die Erfahrung von Entfremdung mutiert unversehens in die Diagnose von Überfremdung. So erscheint Heimat also im Irgendwo zwischen folkloristischer Gemütlichkeit und Barbarei, zwischen Humanisierung und Vernichtungsobsessionen. Wir haben es mit einem offenkundig schillernden, fast nuttigen Begriff zu tun, der sich an Vielerlei binden lässt: die ewige, die himmlische Heimat als Vertröstung auf das Jenseits, die Zutrauen schenkende Geburts- und Kindheitsheimat, Heimat als Gartenzwerg-Gemütlichkeit unter „Senilitätsverdacht“ (Bausinger 1991, S. 122) Spießeridylle, Kampfvokabel – Heimat also jedenfalls sehr unbestimmt zwischen Glück und Verbrechen, Regression und Utopie.
Das gehört offenkundig zum Wesen dieses Wortgeschöpfs; es entfaltet Bedeutung auf unterschiedlichsten Ebenen. Aber ganz so wahllos und willkürlich sind diese dann ja vielleicht nun auch wieder nicht, zielen sie doch allesamt in irgendeiner Form auf Bindungen. Wäre also nach Bedeutungsebenen zu fragen: Was meinen wir eigentlich, wenn wir Heimat sagen? Ganz so zufällig und austauschbar scheint das Reden über Heimat auf der anderen Seite dann doch wieder nicht zu sein. Gibt es da bei aller Unschärfe und Unbestimmtheit nicht doch etwas Bestimmtes, das immer bei dieser Suchbewegung Heimat mitschwingt?
Da wäre bei der Suche nach Bedeutungsebenen zunächst eine zeitlose und überkulturelle Ebene des allgemein Menschlichen: Der Mensch ist von Natur aus „heimatlos“, zugleich nirgendwo und doch (fast) überall zuhause. Wir sind alle Migranten, verwaiste und bedürftige Fremdlinge auf Erden. Die Welt ist offen, aber abweisend. Der Mensch, von Natur aus in zwiespältiger, disharmonischer Beziehung zur Welt, benötigt eine Eigenwelt, in die er gehört, die ihm vertraut ist, sicher, verlässlich und stabil, mit der er sich anfreunden lässt. Da wäre also eine anthropologische Dimension von Heimat – der Zwang für das Gattungswesen Mensch, sich beheimaten zu müssen. Beheimatung als eine Aufgabe tätiger Weltaneignung, durch die der Mensch – immer und überall – eine für ihn unwirtliche Welt erst in ein Zuhause verwandelt.
Aber muss das gleich Heimat heißen? Oder reicht nicht eben dieses Zuhause – ein Obdach, das einerseits mehr ist als eine Bleibe, aber eben doch nicht so viel unkalkulierbarer Sprengstoff? Darauf, dass das Konzept Heimat seine geistige Heimat in Weltbildern der agrarischen Sesshaftigkeit besitzt, insistierte Peter Sloterdijk. Erst hier sei die Bindung des Selbst an Ort und Raum geknüpft worden als Vorstellung befreundeter Räume. Hat dies damit im globalen Zeitalter beschleunigter Mobilität und Flexibilität mit dem Verschwinden des Raumes, der Entstehung der „Nicht-Orte“ (Marc Augé) und neuen nomadischen Lebensformen an Sinnstiftungspotenzial verloren? Für Sloterdijk schon: „Darum gehört auch das deutsche Wort ‚Heimat’ zu einem Zeichen-Reservoir, dessen Hauptgeltungszeit offenkundig vorüber ist: zum Leitvokabular des agrarischen Weltalters, mitsamt seiner Politik und Metaphysik.“ (Sloterdijk 1999, S. 24)
Wie auch immer, Heimat bedeutet Eingrenzung. Da werden Grenzen gezogen – Zäune, Mauern, Barrieren. Wer Heimat sagt, zieht immer Grenzen zwischen der vertrauten, der überschaubaren und verstandenen Welt des Eigenen (die Welt, in der ich mich auskenne), und der Fremde als unvertraute, unverstandene Welt der Anderen. Hier folgen die Grenzen des Heimatlichen weitgehend der Unterscheidung Edmund Husserls in Fremd- und Heimwelt, wobei Letztere eben die „Welt der All-Zugänglichkeit (…), weitreichende Grundschicht des Normalen, des Allverständlichen in Verharren und Wandel (alltäglich normale Umwelt, alltägliches Menschentum, ‚Durschnittsmenschlichkeit’)“ meint (Husserl 1973, S. 629).
Das sind nicht nur räumliche, sondern immer auch soziale und kulturelle Ein- und Ausgrenzungen. Womit sich die Frage stellt, an was sich Heimat lagert und bindet – an Menschen, ihre Sprache, an Räume, an Landschaften? Heimatgefühle sind oft verknüpft mit primären, mit sinnlichen Erfahrungen – Heimat ist hier eine warme und weiche Welt: der Geschmack von Kindheitsspeisen, Atmosphären, Gerüche, Lichtspiele einer Landschaft, der Zungenschlag und die Färbungen einer unverwechselbaren Mundart. Wie das Schwäbische – dafür mag man sich mitunter schämen, wenn etwa relative Weltläufigkeit durch eine korrekte Aussprache des Hochdeutschen gefragt wäre, der Dialekt einen jedoch gefangen hält und untrüglich identifizierbar macht. Diese Haftung begrenzt und hält gefangen, lässt sich nicht verbergen, wird zum Zwang und Anlass der Scham – tönt aber unendlich vertraut und innig. So verweist auch Wilhelm von Humboldt auf die Macht des Ohres, wenn es um die Erzeugung von Vertrautheit und Bindung geht: „Die wahre Heimath ist eigentlich die Sprache. Sie bestimmt die Sehnsucht danach, und die Entfremdung vom Heimischen geht immer durch die Sprache am schnellsten und leichtesten, wenn auch am leisesten vor sich.“ (Humboldt 1847, S. 315)
Orte, Worte, Menschen – Heimat meint immer Bindung. Und es geht dabei immer um Zugehörigkeit und Verstandenwerden. Was wären also trigonometrischen Punkte möglicher Bindungen und Beheimatungen?
Erstens: Heimat als Bindung an Orte und Räume – ob Haus, Dorf, Flur, Stadtteil, Region oder Landschaft. Das Reden über Heimat zeichnet sich aus durch räumliche Konkretheit, durch Ortsbestimmtheit und die Unverwechselbarkeit von Nah-Räumen (Greverus 1972). Ist Heimat dann das, was Tieren ihr Lebensraum wäre? Das wäre eine fatale Analogie. Tiere sind gefesselt an ihre Lebensräume, in die sie an- und eingepasst sind. Der Mensch ist kein Anpasser. Die Räume, die Menschen bewohnen, sind in relativer Freiheit des Handelns entstanden – in der Freiheit, sie zu gestalten und zu bearbeiten. Und sie können verlassen werden. Womit natürlich auch nicht in Abrede gestellt werden soll, dass die Bindung nicht unversehens zur Fessel werden könnte. Aber, hierin liegt auch eine umweltethische Dimension: Aus einer räumlich gedachten Heimat resultiert die Frage, wie denn die von Menschen geschaffenen und bewohnten Räume beschaffen sein sollten, um in ihnen zu leben, zu arbeiten, zu lieben und zu sterben?
Ein Zweites: Die Rede von Heimat bindet sich an den Umgang mit Menschen – gerade im Exil. Das Reden über Heimat ermöglicht die Thematisierung eines sozialen Miteinander-Seins und zielt dabei primär auf zweckfreie, von Nähe und Verlässlichkeit geprägte soziale Beziehungen. Familie, Gemeinschaft, Nachbarn: Das wäre also eine Welt, in der ich mich nicht verstellen und verbiegen muss – in der ich Anerkennung erfahre und sein kann, wie ich sein möchte. Das ist diejenige Heimat, um eine Wendung aufzunehmen, die Johann Gottfried Herder zugeschrieben wird als die Welt, „in der ich mich nicht erklären muss.“ Heimat erscheint hier als Versprechen einer Gewissheit und Selbstverständlichkeit verlässlicher Bindungen, die nicht hinterfragt oder legitimiert werden müssen, weil sie im Rahmen primärer Sozialisationsprozesse entstanden sind und damit gesetzt scheinen. Heimat bedarf keiner Erklärungen, Begründungen und Legitimationen. Nach einer langen Geschichte nationalistischer und völkischer Ideologisierungen häufen sich Vorschläge, die Essentialisierung und Statik herkömmlicher Heimatbegriffe zu meiden und stattdessen von „Beheimatung“ im Sinne einer Erzeugung sozialer Zugehörigkeit und Anerkennung zu sprechen (z.B. Binder 2008).
Drittens – das zeitliche Bindemittel: Heimat verknüpft Fragen der Herkunft (Ursprung, Abstammung, Tradition …) mit solchen der Zukunft (Heimat als Utopie eines unentfremdeten Daseins). Herkunftsgewissheit und Zukunftsvertrauen – diese Bezüge besitzen gleichermaßen regressive wie progressive Potenziale. Heimat als eine gesellschaftliche Utopie humanisierter Welt, das ist das, was Ernst Bloch im fulminanten Schlussakkord seines „Prinzip Hoffnung“ anklingen ließ: „Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“ (Bloch 1973, S. 1628)
Kulturelle Aspekte – Identitäten: Heimat bezieht sich auch auf ein geistiges Zuhause – gerade und erst recht im Zustand der Heimatlosigkeit: in einer als vertraut erfahrenen Sprache und des Denkens, durch die ich verstehe und verstanden werde. Oder der Glaube als verbindende Heimat.
Schließlich, nicht zuletzt – Heimat und Natur: Heimat eröffnet wie kaum ein anderer Begriff eine Klammer, welche Wirklichkeit nicht auseinander dividiert in Menschengemachtes und außermenschliche Wirklichkeit, die auch ohne den Menschen existiert. Damit ermöglicht die Rede von Heimat die Thematisierung von Fragen nach den Beziehungsmöglichkeiten zwischen Mensch und Natur, nach der Organisation des Stoffwechsels zwischen Natur und Gesellschaft, der Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse. Heimat zählt zu den wenigen Begriffen, die sich der Dichotomie von Natur und Geist, Natur und Gesellschaft verweigern, sondern diese auch in anderen Beziehungsmöglichkeiten zu denken vermag (Piechocki/Wiersbinski 2007).
Zusammengefasst also: Ob Orte oder Menschen, Herkunft oder Sprache – wenn von Heimat die Rede ist, geht es immer um Bindungen, nicht irgendwelche, sondern um solche mit spezifischen, identitätsverbürgenden Qualitäten: Nähe, Unmittelbarkeit, Vertrautheit, Zutrauen, Verlässlichkeit, Identifikation. Es geht um ein Bindemittel, das auf die Vermittlung zwischen inneren und äußeren Wirklichkeiten zielt. Und dies ermöglicht, so das Heimat-Versprechen: Geborgenheit und Zugehörigkeit.
Festzuhalten wäre also: Ganz so wahllos, ganz so zufällig erfolgt das Reden über Heimat sicher nicht, wie dies das anfängliche Nebeneinander von Lidl-Werbung und dem Terror des Nationalsozialistischen Untergrunds vielleicht suggerieren mochte. Und noch ein weiteres wäre wichtig – außer der Frage, was denn gemeint ist, wenn Heimat gesagt wird. Nämlich die Frage, wann Heimat besonders häufig aufgerufen und intensiv beschworen wird – das Phänomen der Konjunkturen, Reprisen und Verdichtungen von Heimat-Thematisierungen. Heimat ist nicht statisch, sondern präsentiert sich als historisch wandelbar. Wann gibt es Konjunkturen für diesen Begriff und für das, was er transportiert? In welchem Verhältnis stehen Kontinuitäten und Wandel in den begrifflichen Gebrauchsweisen – was bleibt gleich und was ändert sich im Reden über Heimat?
Das Wort fällt nicht vom Himmel. Das Wort ist seit dem 15. Jahrhundert im Deutschen gebräuchlich. Vorläuferformen wie das mittelhochdeutsche „heimõt“ benannten zunächst zuvorderst sachlich das Heim, das Anwesen, den Hof – also den materiellen (Grund-)Besitz (Bastian 1995, S. 20-23). „Der Älteste bekommt die Heimat“, hieß es beim Erben. Heimat meinte also primär den Geburts- oder Wohnort, woraus sich dann das traditionelle „Heimatrecht“ ableitete und damit Rechte des Aufenthalts, der sozialen Fürsorge oder des Besitzerwerbs.
Einen neuen Zungenschlag, einen emotionalen und romantischen Klang bekam das Wörtchen Heimat Ende des 18. und im 19. Jahrhundert. Agrarische Gesellschaften bauen auf sesshafte Menschen. Die Industriemoderne benötigt bewegliche, innerlich und äußerlich mobile, flexible Menschen. Je vehementer, rasanter und unüberschaubarer sich der Umbau der alten europäischen Welt in moderne Industriegesellschaften sich vollzog, desto dringlicher wurde als konservative Antwort auf Erfahrungen der Entfremdung und des Zerfalls traditioneller Lebensformen und Bindungen die Anrufung geschlossener, still gestellter Heimaten vorgetragen. Heimat erscheint hier, so Hermann Bausinger, als Gegen- und Ersatzwelt, als „Kompensationsraum, in dem die Versagungen und Unsicherheiten des eigenen Lebens ausgeglichen werden, in dem aber auch die Annehmlichkeiten des eigenen Lebens überhöht erscheinen: Heimat als ausgeglichene, schöne Spazierwelt (…), als Besänftigungslandschaft, in der scheinbar die Spannungen der Wirklichkeit ausgeglichen sind.“ (Bausinger 1986, S. 96)
Das Europa des 19. Jahrhunderts ist kein Einwanderungskontinent, sondern, im Gegenteil, ein Kontinent der Auswanderung und unfreiwilliger Heimatlosigkeit: 50 Millionen Menschen verlassen Europa und suchen eine neue Heimat in Übersee. Es ist eine Epoche der Suchbewegungen und Entwurzelungen – des Vertrautheitsschwunds und des Verlusts von Zugehörigkeits-Gewissheit. Umso mehr ist nun die Rede vom Heimweh, von Ursprüngen, von ländlichen Idyllen und intakten Welten. Diese gefühligen Heimat-Versprechen stehen also krass in Kontrast zur sozialen Realität; vielleicht liegt ja gerade hier die Anziehungskraft eines romantisierten und emotional aufgeladenen Heimatbegriffs (Seifert 2010).
„Jeder Mensch sollte lernen sich irgendwo zu Hause zu fühlen.” (Rudorff 1880, S. 272) Mit dieser 1880 scheinbar schlicht vorgetragenen Forderung nach Beheimatung artikulierte Heimatschutz-Nestor Ernst Rudorff Bedürfnisse, über die sich die Moderne rücksichtslos hinwegzusetzen schien: Geborgenheit, Zugehörigkeit, Harmonie, Sicherheit und Stabilität. In diesem Sinne gewann die Rede von Heimat nicht als präziser Begriff Bedeutung, sondern als vages Gegenkonzept, das die Zumutungen, Destruktionspotenziale und unverarbeiteten Begleiterscheinungen der Moderne thematisierte: Entfremdungserfahrungen, Anonymität, die Funktionalität sozialer Beziehungen, den Zerfall traditionaler Sozialstrukturen sowie die mit Hilfe von Wissenschaft und Technik möglich gewordene Unterwerfung der Natur.
Heimat als emotionale Bindung erschien verfügbar für kleine und große Einheiten wie Dorf, Landschaft, Region, Volk, Staat, Nation etc. Obgleich die deutschen Heimatbewegungen zunächst als regionale Reflexe auf die Zentralisierungstendenzen im Zuge der Nationalstaatsgründung von 1871 reagierten, sollte sich die Bezugnahme auf Heimat besonders nach dem Ersten Weltkrieg als mühelos transformierbar erweisen für ethnopolitische Projekte unter dem Programm der deutschen „Volksgemeinschaft“ (Oberkrome 2004). Vor dem Ersten Weltkrieg hatte die Bewegung des Heimatschutzes durchaus drängende Fragen der Zeit aufgegriffen und auch die Frage nach der Natur als eine Schlüsselfrage moderner Gesellschaften thematisiert. Sie hatte den Fortschrittsoptimismus konterkariert mit den Destruktionspotenzialen moderner Industriezivilisation, auf die Folgen einer Ökonomisierung und Rationalisierung der Natur verwiesen, die im Zeitalter von Wissenschaft, Technik und Industrie historisch ungeahnte Dimensionen erreichten, und sich – so der Tenor der zeitdiagnostischen Beschreibungen – offenbar rücksichtslos über alles Vorgefundene in Natur und Kultur hinwegzusetzen schienen. Diese historisch neuen Erfahrungen ließen sich auch mit der Frage nach „Heimat“ zunächst legitim und rational thematisieren: Wie sollte die Welt beschaffen sein? Wäre ein Primat der Natur nicht höher zu bemessen als jener der Ökonomie? Gab es Grenzen in der menschlichen Naturbeherrschung und Naturausbeutung, die dank moderner Technik und Wissenschaften ins Grenzenlose gesteigert werden konnten?
Spätestens nach den Nationalisierungsschüben der traumatisch erfahrenen Weltkriegsniederlage von 1918 war die Mutation einer Bewegung, die sich dem Anliegen des Bewahrens und Schutz des Lebendigen verschrieben hatte, zur Erfüllungsgehilfin einer Vernichtungsideologie unübersehbar; in der Zwischenkriegszeit vollzog sich im Reden und Denken über Heimat ein allmähliches Hinübergleiten von Grün nach Braun (Bausinger 1982). Der Schutz von Heimat komplettierte alsbald allerbestens den Schollenkult, die Heimattümelei und den Bauernkult der NS-Ideologie. Nicht erst im Nationalsozialismus, aber nun radikal, erfuhr Heimat eine obsessive Aufladung als eine biologistisch begründete Abwehr-, Reinheits- und Gleichartigkeitsideologie. Über die Kategorie der „Eigenart“ oder des „Heimischen“ konnte Heimatliches gegen eine feindliche und bedrohliche Welt der Nivellierung und Standardisierung in Stellung gebracht werden. Das Anliegen des Bewahrens des Eigenen mutierte jetzt zur Ideologie und Praxis der Vernichtung der Anderen. Die über „Blut und Boden“– Zugehörigkeiten ausgeschlossenen Fremden, das waren diejenigen, die nicht „eingewurzelt“ schienen, vor allem die „heimatlosen“ Juden, denen Bindungs- und Verantwortungsfähigkeit für den Boden abgesprochen wurde (Schmoll 2003). Eine anfängliche Integrationsidee mutierte damit zur Ausgrenzungs- und Vernichtungsideologie.
Gemütlichkeit und Brutalität – zwei Seiten einer deutschen Heimat-Medaille. Nach dem Nationalsozialismus, nach der Erfahrung von Flucht und Vertreibung in den inneren und äußeren Trümmerzuständen der Nachkriegszeit und den Erfahrungen von über zwölf Millionen deutscher Heimatvertriebener versprach Heimat erneut Aufgehobensein und Geborgenheit in einer undurchschaubaren Welt. Und natürlich: Heimat erschien als die verlorene Heimat in der Geschichte der Heimatvertriebenen, in der die Konsequenzen von Nationalsozialismus und Weltkrieg unfreiwillige Fortsetzung fanden, unkomfortabel für die Nachfolgegesellschaften, weil ihr Schicksal beidseits des Eisernen Vorhangs nicht so geschmeidig in dominante Geschichtsbilder zu integrieren war und die politische Rhetorik ihrer professionellen Verbände so ungebrochen zu tönen schien. Heimat ist hier die Erinnerung an einen verlorenen Ort der Geburt und Herkunft, der zwangsweise und unrechtmäßig verlassen werden musste (Fendl 2002; Beer 2010).
Heimat blieb indes in der BRD kein Monopol des politischen Konservativismus, sondern fand sich nach dem Fortschritts-, Planungs- und Machbarkeitsoptimismus der Wirtschaftswunderjahre seit den 1970er-Jahren als Sinnstiftungsvokabel neuer sozialer Bewegungen wieder. Hier mobilisierte der Anspruch auf politische Selbstbestimmung Protestbewegungen gegen politische Zentralisierung, Bürokratisierung, Umweltzerstörung und technologische Großprojekte (Bredow/Foltin 1981). Gegen eine so erfahrene Enteignung der Lebenswelten und des Nahraums wurde Heimat hier thematisiert als Ort aktiver Weltaneignung und menschlich gestalteter Umwelt, die Zugehörigkeit, Anerkennung und Selbstbestimmung ermöglichen sollte.
Zur Funktionsgeschichte moderner Heimat-Thematisierungen zählt indes genauso die von der Kulturindustrie produzierte und gelieferte Kulissen-Heimat – als Kitschroman, Schlager oder Heimatfilm. Auch hier fungieren Heimat-Botschaften als Sedativum und lösen Widersprüche in konsumierbaren Bildern heiler Welt und Kitschidyllen auf. Die Anziehungskraft der Heimatfilme der 1950er-Jahre wäre ohne vorangegangene NS-Diktatur und Traumatisierungserfahrungen nicht plausibel.
In jedem Fall: Heimat erschien immer als eine mögliche Antwort auf Krise, ein Krisensymptom. Und dies setzt sich fort mit der Entfaltung moderner Industriezivilisationen bis hin zu unserer gegenwärtigen Epoche der Globalisierung, in der nun wieder so viel von Heimat die Rede ist. Und wieder sind es ähnliche Erfahrungen, ähnliche Zumutungen – Erfahrungen des Verlusts, des beschleunigten Wandels, fragwürdiger Zugehörigkeiten, Auseinandersetzungen mit Fremdem, eben Nicht-Vertrautem. Vielleicht lässt sich ja diese Rechnung aufmachen: Je komplexer die Wirklichkeit, je undurchschaubarer, desto drängender und lauter umgekehrt die Heimat-Reden. In jedem Fall: Dem Reden über Heimat geht immer erst ein Verlust voraus – eine Vertreibung aus irgendeiner Form von Paradies, auch wenn dieses nie ein Paradies gewesen sein mag.