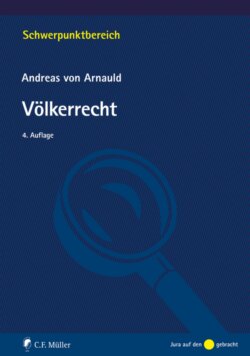Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Indirekter Charakter
Оглавление49
Auch wenn Völkerrecht durch Menschen und letztlich auch für Menschen geschaffen wird, ist die Rolle des Individuums im „westfälischen“ Völkerrecht eine untergeordnete. Das Völkerrecht betrifft den Einzelnen danach nur indirekt durch Vermittlung des Staates (Mediatisierung des Individuums).[49] Es betrachtet den Staat als einheitliches Rechtssubjekt und ist blind für Vorgänge in dessen Innern. Der Staat ist ihm eine black box.
50
Dass aus dieser Perspektive der Mensch nur als Glied eines Staates in Erscheinung tritt, hat Folgen: Wird der Einzelne Opfer der rechtswidrigen Handlung eines anderen Staates, muss im Westfälischen Modell sein Heimatstaat das Anliegen im Wege diplomatischen Schutzes aufgreifen, um die Rechtsverletzung gegenüber dem „mediatisierten“ Individuum auf völkerrechtliche Ebene zu bringen (Rn. 596–606).
51
Diese Mediatisierung greift auch dort, wo ein Mensch (als „Täter“) völkerrechtlich geschützte Güter eines fremden Staates verletzt. Sofern er als Staatsorgan tätig ist, wird die Verletzungshandlung seinem Staat zugerechnet. Bei Privaten indes tauchen Zurechnungsprobleme auf; hier verlagert sich die Verantwortung des Staates primär auf die Ebene von „Überwachen und Strafen“, d. h. er muss durch innerstaatlich wirksame Maßnahmen dafür sorgen, dass völkerrechtlich geschützte Güter und Interessen nicht durch privates Verhalten verletzt werden (Rn. 409). In dieser Staatenfixierung des klassischen Völkerrechts liegt z. B. auch eine der Schwierigkeiten, eine völkerrechtliche Antwort auf die Aktionen privater Terrorakteure zu finden.
52
Auch hier zeichnet sich in Teilbereichen ein Wandel ab; dort nämlich, wo Menschenrechtsverträge den Einzelnen als unmittelbaren Träger der vertraglich niedergelegten Rechte betrachten und ihn mit eigenen Durchsetzungsrechten ausstatten oder wo der Einzelne wegen eines Verstoßes gegen völkerrechtliche Normen (das sog. Völkerstrafrecht) vor ein internationales Gericht gestellt wird. Insgesamt lässt sich in den letzten Jahrzehnten ein Aufweichen der souveränitätsbewehrten Hülle des Staates beobachten: Menschenrechtsverträge schützen nicht allein die Fremden (so noch das klassische Fremdenrecht), sondern auch die eigenen Staatsangehörigen (dieses Verhältnis im Innern des Staates war für das klassische Völkerrecht noch „unsichtbar“); das humanitäre Völkerrecht (früher: Kriegsvölkerrecht) erfasst auch nicht-internationale bewaffnete Konflikte; die Vereinten Nationen widmen sich verstärkt Krisen und Unruhen innerhalb von Staaten. Dies ist teils Folge der bereits beschriebenen Entwicklung hin zu einer Wertegemeinschaft, die in einen Selbstwiderspruch geriete, wenn sie Verstöße gegen ihre Werte im innerstaatlichen Bereich zuließe; zum Teil geht es auch um Prävention, d. h. um die Verhinderung von Friedensgefährdungen im Vorfeld. Da internationale Krisen ihren Ausgang vielfach in innerstaatlichen Konflikten nehmen, z. B. durch sich auflösende Staatsgewalt (sog. failed/failing states), nimmt das moderne Völkerrecht auch innerstaatliche Vorgänge in den Blick.
Vertiefende Literatur zu C.:
D. Armstrong/T. Farrell/H. Lambert, International Law and International Relations, 2. Aufl. 2012; M. Byers (Hg.), The Role of Law in International Politics, 2001; J. Delbrück, Structural Changes in the International System and its Legal Order, SZIER 11 (2001), 1; J. Dunoff/M. Pollack (Hg.), Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations, 2012; G. Fiti Sinclair, State Formation, Liberal Reform and the Growth of International Organizations, EJIL 26 (2015), 445; L. Henkin, International Law: Politics and Values, 1995; F. Hoffmeister/T. Kleinlein, International Public Order, MPEPIL (11/2013); P. Kunig, Völkerrecht als öffentliches Recht – Ein Glasperlenspiel, GS Grabitz, 1995, 325; T. Marauhn (Hg.), Recht, Politik und Rechtspolitik in den internationalen Beziehungen, 2005; A.-M. Slaughter, International Law and International Relations, RdC 285 (2000), 9; D. Thürer, Modernes Völkerrecht: Ein System im Wandel und Wachstum – Gerechtigkeitsgedanke als Kraft der Veränderung?, ZaöRV 60 (2000) 557; J. Varwick, Völkerrecht und Internationale Politik – ein ambivalentes Verhältnis, Politische Bildung 2005, 63; O. Yasuaki, International Law in and with International Politics, EJIL 14 (2003), 105.
Teil I Allgemeines Völkerrecht › § 1 Einführung in das Völkerrecht › D. Entwicklungsperspektiven