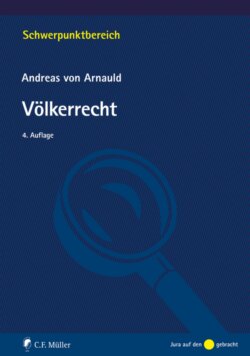Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
D. Entwicklungsperspektiven
Оглавление53
Die soeben aufgezeigten Entwicklungen hin zu verstärkter internationaler Kooperation und sogar Integration scheinen gegenwärtig überoptimistisch. Wir erleben zurzeit eine Krise des Multilateralismus und eine Rückkehr selbstbewusster Staatlichkeit. Die WTO scheint den großen Wirtschaftsmächten unbequem geworden zu sein und wird zunehmend durch bilaterale Handels- und Investitionsabkommen verdrängt oder durch „Handelskriege“ unterminiert. Nicht nur China[50] und Russland[51] treten mit souveränem staatlichem Machtanspruch auf; nationalistische Tendenzen gewinnen auch andernorts an Boden. Die USA werden gegenwärtig von einem Präsidenten geführt, der mit aggressivem Nationalismus auftritt und internationalen Verträgen und Institutionen den Rücken kehrt.[52] Auch die EU scheint zerstritten und steht vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs. Ebensowenig scheint die Rückkehr der Grenzen im EU-Binnenraum in das harmonische Bild zu passen. Steckt das Völkerrecht in einer Krise?[53] Schwingt das Pendel der Geschichte zurück?
54
Dass dies nicht geschehen möge, ist hoffentlich mehr als nur frommer Wunsch. Infolge der Globalisierung sind alle Staaten heute in einem Maße von anderen Staaten und externen Akteuren abhängig, dass sich langfristig nur Kooperationsstrategien auszahlen werden. Donald Trumps Alleingänge und seine Vorliebe für bilaterale „Deals“ sind für die meisten Staaten kein brauchbares Modell und auch für die USA kurzsichtig. Auf Ebene globaler Kooperation mag im Augenblick in vielen Feldern eher eine Phase der Stagnation eingetreten sein; allerdings ist das Völkerrecht schon seit längerem geprägt von einem Spannungsverhältnis zwischen universellen Ansprüchen und regionalen Differenzen. Zwar wirken an der Entwicklung des Völkerrechts seit dem Ende der unrühmlichen Epoche des Kolonialvölkerrechts alle Staaten mit; die stärkere Einbeziehung nicht-westlicher Kulturkreise hat aber nicht nur neue Regeln hervorgebracht (z. B. im Bereich der Umwelt- und Entwicklungspolitik) sondern auch dazu geführt, dass universelle Regeln teilweise unterschiedlich interpretiert werden.[54] Der Übergang von einer bipolaren zu einer multipolaren Weltordnung hat den Trend zu stärkerer Zusammenarbeit in kulturell-geographischen Blöcken verstärkt. Eine Weltrepublik ist nicht in Sicht. Dieser neue Regionalismus führt zu Ungleichzeitigkeiten in der Entwicklung des Völkerrechts. Dies zeigt das Beispiel der EU, die im Vergleich zu anderen internationalen Kooperationen eine einzigartige Integrationsdichte aufweist, damit aber zugleich noch immer als Vorbild für andere regionale Zusammenschlüsse dient. Die Regionalisierung bietet Chancen für eine intensivere Kooperation und effektivere Problemlösung auf regionaler Ebene; eine verstärkte Einbeziehung von Regionalorganisationen wie der AU verspricht Fortschritte bei der regionalen Friedenssicherung. Regionalisierungsprozesse sollten allerdings nicht dazu führen, dass der Konsens über eine alle Staaten umfassende Grundordnung in Frage gestellt wird. Die Sicherung des Friedens und (damit einhergehend) der Schutz der Menschenrechte bilden Leitprinzipien eines internationalen ordre public und damit das Fundament einer allgemeinen Völkerrechtsordnung, innerhalb derer sich regionale Kooperationen fruchtbringend entfalten können.
55
Solche Kooperationen haben weitergehende Wirkungen. Trotz der vielerorts wieder lauter beschworenen staatlichen Unabhängigkeit wird sich die Bedeutung von Souveränität weiter wandeln. Je mehr Staaten Hoheitsrechte auf Internationale Organisationen übertragen, desto mehr wird es zumindest für diese Staaten nötig, Souveränität nicht im Sinne Carl Schmitts auf den einen archimedischen Punkt zu beziehen,[55] sondern mit realitätsgerechteren Konzepten geteilter Souveränität zu operieren. Zudem gilt es, die Auflösung der strikten Trennung von Innen und Außen konzeptionell zu verarbeiten:[56] Souveränitätsbewehrte Abschottung gegen äußere Einmischungen ist schon heute nur noch eingeschränkt möglich; insbesondere die Menschenrechte besitzen hier – zumindest in ihren Kerngarantien – eine zentrale Türöffnerfunktion mit weiterem Entfaltungspotenzial. Zunehmend finden sich Stimmen, die fordern, das Völkerrecht ganz vom Menschen her zu denken und staatliche Souveränität a priori an die Bedingung zu knüpfen, dass der Staat seiner primären Verantwortung zum Schutz seiner Bürger nachkommt. Diese Idee einer Schutzverantwortung (responsibility to protect) des Staates, dessen Versagen eine Auffangverantwortung der internationalen Gemeinschaft auslösen soll, ist nach wie vor nur ein rechtspolitisches Konzept und kein Bestandteil des geltenden Völkerrechts (Rn. 314). Dennoch weist sie im Ansatz auf Prozesse hin, die das Völkerrecht in seiner weiteren Entwicklung prägen könnten. Eine Ablösung des Konzepts souveräner Staatlichkeit steht zwar nicht zu erwarten, wohl aber seine weitere Modifikation und Relativierung.[57]
56
An der zentralen Stellung der Staaten im Völkerrecht dürfte sich nichts ändern. Staaten bleiben Hauptakteure und Garanten für relative Stabilität in den internationalen Beziehungen; ihnen wird auch weiter der Schutz privater Rechte und Interessen auf internationaler Ebene obliegen. Wohl aber lässt sich eine weitere Lockerung der Staatenzentrierung denken. Gerade beim Kreis der Völkerrechtssubjekte entspricht es der Natur des Völkerrechts, faktische Entwicklungen nicht langfristig auszublenden (Rn. 59). Neben Transnationalen Wirtschaftsunternehmen, über deren Status im Völkerrecht schon länger diskutiert wird (Rn. 632), spielen Nichtregierungsorganisationen (NGO) eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne. Schon heute finden sich Ansätze einer Institutionalisierung der Beziehungen zwischen NGO und Internationalen Organisationen, z. B. im Menschenrechts-Monitoring der UNO.[58] Es erscheint durchaus möglich, hierin einen ersten Anfang zivilgesellschaftlicher Elemente im modernen Völkerrecht zu erblicken.[59]
57
Durch die „Rückkehr des Staates“ in allerjüngster Zeit etwas verdeckt, aber nicht beseitigt, wurde ein Trend zur Informalisierung, der sich in den letzten Jahren in den internationalen Beziehungen bemerkbar gemacht hat: Koalitionen der Willigen sind wiederholt an die Stelle institutionalisierter Allianzen getreten, wichtige Entscheidungen werden außerhalb Internationaler Organisationen in informellen Zirkeln wie den G8 oder G20 getroffen, Behördennetzwerke kooperieren weitgehend informell auch über Grenzen hinweg, statt Verträge abzuschließen, beschränkt man sich vielfach auf informelle Abreden und unverbindliche Resolutionen. Angesichts z. T. erheblicher Auswirkungen auch auf den Einzelnen (man denke nur an die Wirkungen der PISA-Studie der OECD auf das deutsche Schulsystem) ist eine drängende Herausforderung an das Völkerrecht, hier Verantwortlichkeiten und Kontrollen zu etablieren.[60] Diese Entwicklungen fordern aber nicht das Völkerrecht per se heraus. Sie stehen zu ihm nicht in einem Konkurrenz-, sondern in einem Ergänzungsverhältnis. Ein Bedürfnis nach „weichen“ Formen internationaler Kooperation hat es immer gegeben und wird es auch weiterhin geben. Ebenso aber bleibt ein Bedürfnis nach verlässlichen und belastbaren institutionellen Strukturen und nach gesteigerter Verbindlichkeit internationaler Verpflichtungen, wie sie nur das Völkerrecht bieten kann. Gerade in einer multipolaren Welt beweist sich der Wert des Völkerrechts als Garant von Stabilität und Verlässlichkeit.
Vertiefende Literatur zu D.:
C. Bailliet, Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes, 2012; E. Benvenisti, Coalitions of the Willing and the Evolution of Informal International Law, in: Calliess/Nolte/Stoll (Hg.), Coalitions of the Willing, 2007, 1; P. S. Berman, Global Legal Pluralism, 2012; A. v. Bogdandy, Demokratie, Globalisierung, Zukunft des Völkerrechts – eine Bestandsaufnahme, ZaöRV 63 (2003), 853; R. Brownsword (Hg.), Global Governance and the Quest for Justice IV: Human Rights, 2005; B. S. Chimni, The Past, Present and Future of International Law: A Critical Third World Approach, MelbJIL 8 (2007), 499; R. Domingo, The Crisis of International Law, VJTL 42 (2009), 1543; J. Dugard, The Future of International Law, LJIL 20 (2007), 729; Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), Die Zukunft des Völkerrechts in einer globalisierten Welt, 2006; S. Hobe, Die Zukunft des Völkerrechts im Zeitalter der Globalisierung, AVR 37 (1999), 253; J. L. Kaul/A. Jha (Hg.), Shifting Horizons of Public International Law: A South Asian Perspective, 2018; H. Krieger/G. Nolte/A. Zimmermann (Hg.), The International Rule of Law: Rise or Decline?, 2019; S. Laghmani, Droit international et diversité culturelle, RGDIP 112 (2008), 241; C. Leben, The Advancement of International Law, 2010; D. Lewis (Hg.), Global Governance and the Quest for Justice I: International and Regional Organisations, 2006; S. MacLeod (Hg.), Global Governance and the Quest for Justice II: Corporate Governance, 2006; P. Odell/C. Willett (Hg.), Global Governance and the Quest for Justice III: Civil Society, 2008; Y. Onuma, A Transcivilizational Perspective on International Law: Questioning prelevant cognitive frameworks in the emerging multi-polar and multi-civilizational world of the Twenty-First Century, RdC 342 (2009), 77; A. Rodiles, Coalitions of the Willing and International Law, 2018; C. Thies, Kulturelle Vielfalt als Legitimitätselement der internationalen Gemeinschaft, 2013; J. Trachtman, The Future of International Law, 2013; Z. U. Türem, Rising Authoritarinism(s) and the Globalization of Law: An Initial Exploration, IJGLS 26 (2019), 1; B. Vogel/R. Dolzer/M. Herdegen (Hg.), Die Zukunft der UNO und des Völkerrechts, 2004; P. Zumbansen, Die vergangene Zukunft des Völkerrechts, KJ 34 (2001), 46.
Kontrollfragen:
| ▸ | Woher stammt der Begriff „Völkerrecht“ und weshalb ist er irreführend? Rn. 1 |
| ▸ | Was sind die Funktionen des Völkerrechts? Wie haben sie sich im Laufe der Zeit gewandelt? Rn. 2–4 |
| ▸ | Ist Völkerrecht Recht? Warum „gilt“ es? Rn. 6–16 |
| ▸ | Inwieweit war und ist der Westfälische Friede von 1648 prägend für das Völkerrecht? Rn. 25, 38 |
| ▸ | Was verbirgt sich hinter den Diskussionen über die Konstitutionalisierung und über die Fragmentierung des Völkerrechts? Rn. 29–34 |
| ▸ | Worin liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Völkerrecht und Privatrecht? Rn. 35–37 |
| ▸ | Was ist kennzeichnend für den genossenschaftlichen Charakter des Völkerrechts? Rn. 39–42 |
| ▸ | Was besagt die Lotus-Regel? Rn. 40 |
| ▸ | Wieso ist das Völkerrecht in besonderem Maße „politisches“ Recht? Rn. 46–48 |
| ▸ | Was versteht man unter der sog. Mediatisierung des Individuums? Rn. 49–51 |
| ▸ | Welche Chancen und Risiken bergen Trends einer stärkeren Regionalisierung im Völkerrecht? Rn. 54 |
| ▸ | Worin äußert sich ein Trend zur Informalisierung in den internationalen Beziehungen? Rn. 57 |