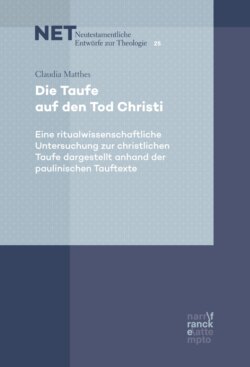Читать книгу Die Taufe auf den Tod Christi - Claudia Matthes - Страница 71
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4.3.2 Verhältnis von Männern und Frauen zueinander
ОглавлениеDie unterschiedliche Stellung und Funktion von Frauen und Männern in der jüdischen Religion ist nur der eine Punkt, der hier zu bedenken ist, der andere ist das Verhältnis von Frauen und Männern zueinander. Es wird v.a. von zwei Grundkomponenten bestimmt: 1) Das Machtgefälle vom Mann zur Frau und 2) die enge Bindung von (Ehe-)Mann und (Ehe-)Frau aneinander.
1) Das Machtgefälle: Wie die Beschreibung von Stellung und Funktion einer Frau innerhalb der jüdischen Gesellschaft gerade gezeigt hat, wird das Leben einer Frau im Wesentlichen von ihrem Verhältnis zu einem Mann (Vater oder Ehemann) bestimmt und es fußt stets auf der Grundüberzeugung: γυνὴ δὲ χείρων ἀνδρὸς εἰς ἅπαντα – „Die Frau ist in jeder Hinsicht geringer als der Mann.“1 Beispiele wie die eingeschränkte Möglichkeit, selbstständig Gelübde abzulegen, zeigen: „In einigen Stellen wird die Frau hinsichtlich der Erfüllung gewisser Gebote auf eine Linie mit den Sklaven u. Kindern gestellt.“2 Dies geschieht mit folgender Begründung: „Weil sie nur ein Herz (für ihren Mann) haben; ebenso ist das Herz des Sklaven nur auf seinen Herrn gerichtet. – Frauen u. Sklaven haben noch einen menschlichen Herrn über sich, u. dessen Dienst nimmt ihr Herz so in Anspruch, daß für den Dienst Gottes Zeit u. Kraft fehlt. Darum werden hinsichtlich der Gebotserfüllungen an die Frauen u. Sklaven geringere Ansprüche gestellt als an die Männer u. Freien.“3
Diese Vorstellung findet sich dann bekannterweise auch in den sog. christlichen Haustafeln wieder: αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς […] (Eph 5,22f).4 Paulus begründet die untergeordnete Stellung der Frau zudem wie folgt: Ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλὴν εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικὸς ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός· καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα (1Kor 11,7–9).
2) Die enge Bindung aneinander, wie sie direkt aus der jüdischen Anthropologie übernommen wird: על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד / ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ προσκολληθὴσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ εἰς σάρκα μίαν (Gen 2,24/LXX). Dass für diese neue Bindung das Vaterhaus verlassen wird, die Grundzelle jeder antiken Gesellschaft, zeigt bereits, was dabei entsteht: die engstmöglich vorstellbare Bindung zweier Menschen aneinander – sie sind nur noch ein Fleisch. Jesus zitiert Gen 2,24, um von der Dauerhaftigkeit und wohl auch Tiefe dieser Bindung her gegen eine Ehescheidung zu argumentieren (Mt 19,5f). Paulus versucht durch eine Bezugnahme auf die ein-Fleisch-Aussage den Korinthern zu verdeutlichen, dass der Umgang mit Prostituierten kein nebensächliches Vergnügen ist, sondern Auswirkungen auf ihren Körper hat, der doch dem Herrn geweiht ist. Indem er τὸ σῶμα in diesem Zusammenhang als μέλος Χριστοῦ bezeichnet, verweist er bereits auf die zweite, nämlich die bildgebende Dimension der σὰρξ-μία-Vorstellung.
Die Ehe zwischen Mann und Frau wird zur Metapher für eine größtmögliche Nähe und Einheit. Im Eph findet sich diese Metapher dann für Christus und seine Gemeinde. Auf ein Gen 2,24-Zitat steht da: τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν· ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν (Eph 5,32). Christi Einheit mit seiner Gemeinde, die sich in seiner Liebe und seinem Sterben für die Gemeinde ausdrückt (Eph 5,25), ist nach Vorstellung des Eph demnach vergleichbar mit dem ehelichen σὰρξ-μία-Sein. Es wird gar reziprok als Vorbild dafür hingestellt, wie sich Mann und Frau zueinander verhalten sollen (Eph 5,33).
Dass die Einheit von Christus und der Gemeinde und damit dem einzelnen Gemeindeglied, verstanden als Glied seines Leibes, verstanden wird als maximale Einheit und Nähe, wie sie bisher nur in der Gemeinschaft von Frau und Mann zu finden war, ist ein Vorstellung, die sich in verschiedenen neutestamentlichen Schriften wiederfindet. Jedoch deutet bereits 1Kor 6,15–20 an, dass dies nicht zwangsläufig eine positive, wenn auch paränetische Einstellung zur Ehe nach sich ziehen muss. Denn es handelt sich nicht um zwei einander zwar vergleichbare, aber unabhängige einende Bindungen. Paulus argumentiert gegen den Umgang mit Prostituierten, weil dieser einen Einfluss auf die Christusbindung habe: καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ (1Kor 6,17).
Die jeweilige Bindung kann gar so eng aufgefasst werden, dass eine Art Konkurrenzverhältnis wahrgenommen wird, als könne man eine derartige Einheit nur einmal eingehen. Wenn auch die Taufe εἰς Χριστόν nicht ohne Weiteres mit der Entscheidung der Jünger für die Nachfolge gleichgesetzt werden soll, so kommt einem dennoch die Forderung des Verlassens sämtlicher Anverwandter als Voraussetzung für die Nachfolge (Lk 14,26f) in den Sinn. Die Entscheidung zur Nachfolge fordert demnach eine Unterordnung, wenn nicht einen Bruch mit allen wichtigen, tragenden bisherigen Bindungen.
Paulus wiederum leitet daraus das Ideal ab, unter einer gewissen Naherwartung, dass es besser ist, solche Bindungen, speziell die so grundlegende und enge der Ehe, gar nicht erst einzugehen: καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι (1Kor 7,1). Wer ledig ist oder Witwe, ebenso die Jungfrauen sollen möglichst allein bleiben. Zwar ist dies kein Gebot, θλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι (1Kor 7,28). Paulus bezeichnet diejenigen, welche versuchen, dem Gatten und dem Herrn gerecht zu werden, als μεμέρισται (1Kor 7,34) – „geteilt“ oder wie Luther kontextuell übersetzt: „geteilten Herzens“.5 Die Bindung an Christus wie auch die Ehe sind für Paulus derartig grundlegende Einheiten, dass es seiner Meinung nach eher das Individuum zerreißen muss, als diese Verbindungen.6
Mit Blick auf Gal 3,28c ist für das Verhältnis von Männern und Frauen also festzuhalten, dass einerseits ein deutliches, abhängiges Gefälle auszumachen ist und andererseits die wechselseitige Bindung aneinander derartig grundlegend verstanden wird, dass sie geradezu zum Paradigma für Einheit wird. Dieses wird verschiedentlich herangezogen, um das Verhältnis Christi zu seiner Gemeinde, aber auch Nachfolge für den Einzelnen zu illustrieren, teilweise in Konkurrenz zu menschlichen Bindungen. Über γὰρ angebunden wird dieser Aspekt in Gal 3,28d ja auch thematisiert.
Die Wahrnehmung, dass 1Kor 12 und Kol 3 ohne das Paar ἄρσεν/θῆλυ auskommen, bringt zwei weitere Fragen auf den Plan: 1) Macht der Argumentationskontext von Gal die Anführung dieses dritten Paares sinnvoll oder gar notwendig?7 2) Wie stellt sich das Verhältnis zu den beiden anderen Paaren dar? Es ist bereits dargelegt worden, dass die Gegensatzpaare Ἰουδαῖος/Ἕλλην und δοῦλος/ἐλεύθερος inhaltlich und motivisch in Gal auch sonst aufgegriffen und problematisiert werden,8 wobei rechtsgeschichtliche Betrachtungen gezeigt haben, dass die Erbthematik Sohn/Sklave zumindest indirekt auch das Verhältnis männlich-weiblich betrifft, insofern als Frauen nur eingeschränkt erbberechtigt sind.
Betrachtet man den direkten Kontext, in dem alle drei Paare geboten werden, wird die Verbindung zu einem anderen Schwerpunkt des Gal jedoch noch deutlicher: Bewirkt wird die dreimalige Negierung bisheriger Kategorien durch die allen, auf gleiche Weise, gewährte Taufe – im Gegensatz zum bisherigen Initiationsritus Beschneidung, welcher lediglich an Männern vollzogen wird. Eine Ergänzung der Taufe um die Beschneidung würde demnach nicht nur alle zu Juden machen und damit an das Gesetz binden, sondern auch die neue „Gleichbehandlung“ negieren. Die gewählte Umschreibung des Taufvorgangs, nämlich sich ganz in Christus hinein zu begeben, funktioniert als Metapher ebenfalls für beide Geschlechter. Sie ist oben bereits als völlig neue, engste und zugleich grundlegende Bindung dargestellt worden. In dieser Weise entsteht in der Taufe eine Bindung, welche zur bisher engsten, grundlegenden Bindung eines Menschen – der Bindung an den jeweiligen Ehepartner – mindestens in Konkurrenz steht, wenn nicht diese ersetzt, denkt man etwa an die Empfehlung der Ehelosigkeit (1Kor 7,1).
Darüber hinaus bietet auch die Zusammenschau der drei Paare weiteren Aufschluss über die Art ihrer Beschaffenheit und damit ihrer möglichen Negierung: Unhaltbar scheint die These geworden zu sein, dass sie einzeln für die religiöse, soziale und biologische Grundunterscheidung der antiken Gesellschaft stehen.9 Viel mehr beinhalten alle drei Paare rechtliche, soziale, religiöse und weitere Aspekte, sodass Meeks zu Recht feststellt, dass: „[…] in verse 28 all the pairs refer quite concretely to social statuses.“10
Inwieweit Gal 3,28c kategorial auf einer Linie mit Gal 3,28a.b gesehen wird, hat erhebliche Auswirkungen auf die Interpretation von οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ. Entsprechend könnte die Vielfalt der diesbezüglichen Forschungspositionen kaum größer sein. Es lässt sich dennoch eine grundlegende Entscheidung ausmachen, dass die Negierung entweder mit dem Gottesverhältnis oder dem zwischenmenschlichen Verhältnis der beiden, nicht aber mit beiden zugleich, in Verbindung gebracht wird.
Forschungsüberblick zu ὀυκ in Gal 3,28c
1. Negierung des unterschiedlichen Status im Gottesverhältnis: „Mann bleibt Mann und Frau bleibt Frau, auch nach der Taufe –, aber sie [die Unterschiede, CM] haben jegliche Heilsbedeutung vor Gott verloren.“11 Die Taufe kommt, anders als die Beschneidung, Männern und Frauen in gleicher Weise zugute und bewirkt durch die „Bekleidung mit Christus“ für beide eine ganz neue, gleiche Stellung vor Gott, was allerdings nicht zwangsläufig auch eine Gleichheit in der Kultpartizipation nach sich ziehen muss.12
2. Negierung des bisherigen Verhältnisses zueinander: In dem neugestalteten Gottesverhältnis sehen manche Exegeten auch Auswirkungen für das Verhältnis von Männern und Frauen nach der Taufe. Jedoch kann die Negierung auf drei unterschiedliche Aspekte des bisherigen Verhältnisses bezogen werden:
2.1 Aufhebung der Unterscheidung von ἄρσεν καὶ θῆλυ: Die neutrische Form sowie die Parallelen aus christlicher Gnosis und Apokryphen sprechen dafür, dass nicht nur die soziale Emanzipation der Frauen im Blick ist, sondern „die metaphysische Beseitigung der biologischen Geschlechtsunterschiede als Folge der Erlösung in Christus“13 – also Androgynie.14 Mit Bezugnahme auf den Kontext (Gal 6,15) kann dies entweder als καινὴ κτίσις verstanden werden oder als Restauration des paradiesischen Urzustandes: Gottebenbildlichkeit, Herrlichkeit und v.a. die ursprüngliche Einheit des Menschen – der „androgyne Urmensch“.15 Diese Interpretation stützt sich auf „eine Lesart von Gen 1,27, nach der der Mensch ursprünglich als androgynes Wesen nach dem Bild Gottes geschaffen war und dann in eine männliche und eine weibliche Hälfte geteilt wurde (Gen 2,21f).“16 Dass hier tatsächlich eine „Transformation ontologischer Kategorien“17 vorliegt – entgegen den sich lediglich auf soziale Rollenverhältnisse beziehenden voranstehenden beiden Paaren –, kann auf den Christus-Anthropos-Mythos zurückgeführt werden,18 einer androgynen Christusvorstellung.19 Da sich für die androgyne Argumentation aber weder alt- noch neutestamentliche Vergleichstexte finden lassen, kann ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ auch als „Annullierung der sexuellen Polarität“20 im Sinne von Asexualität21 interpretiert werden, vergleichbar dem apokalyptischen Motiv, dass die Auferstandenen nicht mehr heiraten werden, „sondern (asexuell) wie die Engel sind“.22 Ähnliche (allerdings paränetische) Tendenzen lassen sich etwa auch in 1Kor 7 finden.
2.2 Aufhebung der Unterschiede zwischen ἄρσεν καὶ θῆλυ: Als Folge der neuen Androgynität (oder auch ohne diese Vorstellung) hat ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ politische und soziale Implikationen und kann als „Emancipation Proclamation for Women“23 verstanden werden, „which legitimized the ministry and place especially of single women in Christ, such as is illustrated in the well known story of Paul and Tecla.“24 Dass die vielfältigen Unterschiede in den gesellschaftlichen wie privaten Rechten und Pflichten zwischen Männern und Frauen nicht mehr bestehen sollen, ist eine revolutionäre Forderung – das oben beschriebene antike Ideal sollte demnach tatsächlich umgesetzt werden. An dieser Stelle allerdings von einer Abschaffung der Diskriminierungen und dem allen gleichen Initiationsritual als dem ersten, über sich hinausweisenden Schritt von der Gleichbehandlung hin zur Gleichstellung von Männern und Frauen25 zu sprechen, scheint doch anachronistisch. Derartige konkrete Folgen, auch nur für die Gemeinschaft der Getauften, können aber auch grundsätzlich angezweifelt werden und die Aufhebung der Unterschiede als lediglich spirituell, erst im Himmel oder sakramental verborgen verstanden werden. Schlier etwa betont die „Wirklichkeit der Gleichheit aller in Christus Jesus“26 und sieht die „natürliche Individualität im Blick auf die Gesamtheit und im Blick auf den Einzelnen in der sakramentalen Wesenheit des Leibes Christi und seiner Glieder erloschen.“27 Jedoch fügt er an: „[…] so hüte man sich, aus ihm [V. 28, CM] direkte Folgerungen für die Ordnung des kirchlichen Amtes oder auch der politischen Gesellschaft zu ziehen.“28
2.3 Aufhebung der Bindung von ἄρσεν καὶ θῆλυ aneinander: Das verbindende καί statt dem kontrastierenden οὐδέ, der adjektivische Sprachgebrauch sowie der kreatürliche Faktor sprechen dafür, dass dieses dritte Paar – anders als die beiden voranstehenden – nicht auf die Gegensätzlichkeit, sondern ihre Bindung aneinander abhebt. Die in der Taufe grundgelegte neue Bindung an Christus (laut Gal 3,27b) löst einerseits bisherige Bindungen und Abhängigkeiten auf und führt andererseits zu neuen zwischenmenschlichen Bindungen, bis hin zur Einheit (Gal 3,28d).29 Im priesterschriftlichen Schöpfungsbericht werden Mann und Frau einander zugeordnet und mit dem Fortpflanzungsauftrag aneinander gebunden (Gen 1,27f). Im nicht-priesterschriftlichen Schöpfungsbericht überbietet die Bindung aneinander sogar diejenige an die Eltern und ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν (Gen 2,24).30 Die Taufe auf Christus führt aber zur καινὴ κτίσις (Gal 6,15; vgl. auch 2Kor 5,17)31 und darin gilt: πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (Gal 3,28d). Christi Tod löst und befreit vom Gesetz, aber löst er auch Bindungen zu Menschen? Der Ruf in die Nachfolge zwingt immer zur Entscheidung, wo eine Bindung – ob an Werte32 oder Personen33 – in ein Konkurrenzverhältnis zu Christus tritt. Diese völlige Neugestaltung menschlicher Bindungen, nach Gal 3 in der Taufe verortet, wirkt dann auch auf die Beziehungen zwischen den Getauften (siehe Gal 3,28d): „Die soziologische Basis, auf der das Christentum beruht, sind nicht – wie im Judentum – die Verwandtschaftsbindungen, sondern die Bindungen der Gemeinschaft – Gemeinschaft in Christus.“34
Auch wenn 3,28c aus der vermeintlichen Parallelität herausfällt, soll eine endgültige Interpretation gerade im Kontext der beiden anderen geboten werden, v.a. da die Vielfalt der Deutungsansätze nahelegt, dass eine isolierte Interpretation dieser nur fünf Wörter zwangsläufig einen spekulativen Charakter beibehält.