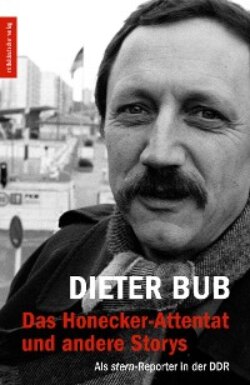Читать книгу Das Honecker-Attentat und andere Storys - Dieter Bub - Страница 23
Wiedersehen mit Halle
ОглавлениеIn den Berichten, die Wilhelm in der Runde vorgelegt bekommt, wird gemeldet, Müller fahre auffällig häufig nach Halle. Fotos zeigten ihn an unterschiedlichsten Orten in der Stadt.
„Gibt es irgendeine Erklärung?“, fragt Meyer.
„Wir haben noch nichts herausgefunden.“
„Sein Verhalten ist merkwürdig. Vergleichen wir seine Aufenthalte in Halle mit seinen Reisen nach Jena, Dresden oder Rostock, so hat das keinen Sinn“, wendet Dr. Otto ein.
„Keine Adresse, kein Kontakt zu Oppositionellen, nichts.“
„Wo hält er sich auf?“
„Überall, in den Straßen rund um den Marktplatz, an der Saale, auf der Peißnitzinsel, im Zoo, in Reichardts Garten …“
„Reichardts Garten?“
„Ein Park, der nach einem Komponisten der Goethezeit benannt ist.“
„Und nirgendwo eine Begegnung, ein Gespräch?“
„Nein, er ist allein unterwegs, auch abends. Er geht immer wieder in die Oper, trinkt im Ratskeller Bier.“
„Er sucht irgendetwas.“
„Es muss eine Erklärung geben.“
Rückkehr: Halle stinkt, die Luft giftig wie damals, verdreckte Kindheit vor fünfunddreißig Jahren, grau gefärbt von Abgasen. Das Plattenbauhotel zwischen Bahnhof und Bezirksleitung der SED, ein überheiztes Zimmer mit Ausblick auf die Straße nach Merseburg, auf der Rückseite die Hochstraße in die Massensiedlung von Neustadt.
Nachmittags angekommen, allein. Müller fährt mit dem klapprigen Fahrstuhl ins Foyer, erwartet von einem Mann in Plastejacke hinter einer Zeitung, die er eilig zusammenfaltet, aufsteht, ihm folgt, bemerkt, dass die Zielperson nicht mit dem Wagen fahren wird, sondern sich zu Fuß zum Roten Turm und durch die Leipziger Straße zur Straßenbahnhaltestelle neben dem Händeldenkmal auf dem Marktplatz bewegt; eine attraktive Rothaarige zu Hilfe ruft, die nun, gemeinsam mit dem Hotelaufpasser, nur wenige Meter entfernt, die Zielperson beobachtet. Die Straßenbahn Richtung Giebichenstein. Sie steigen zu dritt ein. Müller vorn, beide Beobachter hinten. Müller springt im letzten Augenblick heraus. Die Türen schließen sich vor seinen Verfolgern, die nun ohne ihn davonfahren.
Er winkt ihnen zu, eilt zur nächsten Haltestelle, nimmt die nächste Bahn. Unbewacht, ungestört verbringt er ein paar Stunden an der Saale, dem Fluss seiner Kindheit und Jugend. Glücklich wehmütig unterwegs in seinen Erinnerungen die Ausflüge zur Pionierrepublik auf der Peißnitzinsel, an die Küsse, das Mädchen, die erste große Liebe, Doris.
Er riecht und sieht. Die Saale als stinkende Kloake, eine chemische Brühe, die grauschmutzige Schaumkronen trägt. Nein, sauber hat er den Fluss auch aus seiner Kindheit nicht in Erinnerung, aber roch er damals nicht noch nach Wasser, nicht dass er sauber gewesen, zum Baden eingeladen hätte aber war nicht etwas von seiner Ursprünglichkeit geblieben? Als er das Wehr erreicht, die gewaltige Wasserlandschaft seiner Träume, stauen sich die schmutzigen Flocken.
Ohne Bewachung kehrt er in die Stadt zurück, findet er in der Nähe des Hallmarkts eine Imbissbude. Er bestellt Bockwurst mit Senf und Brötchen, dazu Kaffee, aufmerksam von fünf Arbeitern an einem Stehtisch beobachtet. Fremde sind hier die Ausnahme.
„Hamse sich verlaufen?“, fragt einer.
„Nee, ich hatte Hunger“, antwortet Müller. „Is doch jut hier.“
„Der Kaffee, der ist Bohne hier“, sagt ein anderer.
Sie haben den Fremden sofort als einen „von drüben“ erkannt, so als wäre ihm seine Herkunft auf die Stirn geschrieben.
„Zu Besuch, was?“
„Die Händelfestspiele“, erklärt Müller, erzählt ihnen dann doch, er sei eigentlich nach Hause zurückgekommen.
Die Männer sind eine Gerüstbauerbrigade, die zur Mittagspause immer hierher kommen. „Und wie gefällt es Ihnen?“ fragen sie. „Haben Sie Halle wiedererkannt?“
„Es hat sich wenig verändert“, antwortet Müller.
„Klar, immer noch der alte Dreck.“
„Hier passiert doch nischt, rein jar nischt.“
„Ja, is vieles noch wie damals, in meiner Jugend.“
„Mir versuchen, das Schlimmste zu verhindern, dass die Häuser nich zusammenkrachen.“
„Weil alles nach Berlin geht“, sagt ein anderer.
„Mir ham noch nich ma anständige Gerüste. Die könn’ jeden Tach einstürzen. Unn wir mit ihnen.“
„Weil der Arweeter nischt wert is, rein jar nischt.“
Sie reden sich in Rage.
„Das isses doch, es bleibt nischt. Nach Ulbricht hammer jedacht, es wird’s besser. Jetzt is der Schlamassel nur noch größer jeworden. In Berlin wird’s Jeld verprasst unn für hier bleibt nischt übrig. Weeßte.“
„Bei uns draußen im Dorf – die Straße besteht nur noch aus Schlaglöchern, keene Straßenbeleuchtung, da musste ’n Mond noch mit der Stange wegschieb’n. So isses.“
„Mach’s jut. Grüß deine Leute.“
Sie haben nur ein paar Schritte zu einem der grau verwohnten Häuser, gleich hinter dem Markt, in unmittelbarer Nähe neuer Plattenbauten, an Stelle verfallener Straßenzüge, die, unsanierbar, abgerissen werden mussten.
Abends im Weinrestaurant, nur hundert Meter vom Händeldenkmal entfernt. An einem Nachbartisch ein alter Mann mit zusammengefallener Frau, eine herbe schnippische Tochter, Gollmitz, der Sportschinder in der Schule, der damals „Feuer unter ihre Ärsche“ machen wollte, ein arroganter Militär der deutschen Wehrmacht, unerkannt, erkannt überdauert, noch immer diesen eingefressenen Zug der Überheblichkeit. Nun am Ende, bemerkt er den mitleidigen Blick des Fremden, der ihn beobachtet. Nein, er erkennt Müller nicht, vermutet aber in ihm einen seiner ehemaligen Schüler, der ihm zu gehorchen hatte.
Müller könnte zu ihm gehen. Nein, wozu? Der Alte spürt seine Verachtung. In der Bar des Hotels hockt wieder ein müder Mann mit Zeitung im Dienst, der aber erst nach Hause gehen darf, wenn das Zielobjekt mit Sicherheit sein Zimmer betreten haben wird. Schon um seinen Beobachter zu beschäftigen, verschafft er sich Bettschwere an der Bar Schnaps aus Nordhausen und Bier aus Radeberg, das nur in solchen Interhotel-Häusern mit weißer Papiermanschette ausgegeben wird. So, angenehm angetrunken, lassen sich das überheizte Zimmer und der Straßenlärm ertragen.
Am nächsten Vormittag verschwindet Müller über den Keller des Hotels durch den Personalausgang, in einem Café verabredet – mit weit entfernten Verwandten aus Merseburg, die sich für den Westbesuch freigenommen haben und in die Stadt gekommen sind. Er arbeitet bei Leuna, sie beim Rat der Stadt Merseburg.
Einander fremd, erzählen sie von ihrem Opa, dem Schwager seiner Großmutter, den er früher, als Jugendlicher, Anfang der fünfziger Jahre mit dem Fahrrad besucht hat, das Reihenhaus in der dreckigen Straße, in der dreckigen Luft, in der verdreckten Landschaft, zwanzig Kilometer von Halle entfernt. Sie erzählen, der Großvater habe bis weit über die Neunzig gelebt, in der Werkstatt gebastelt, sich nach dem Tod der Großmutter um die Kaninchen und den Garten gekümmert, und sie hätten danach in dem kleinen Häuschen bleiben können. Christel, mit Käthe-Kruse-Puppengesicht, rotfleckigen Wangen, rundlichem Körper, mollig, mit der Neigung zu ausufernder Fülle. Ihr Mann Karl-Heinz lang, dürr ausgemergelt, ein hageres Gesicht, scharfe Furchen, kräftige Nase, müde, resigniert.
„Karl-Heinz wird bald aufhören“, sagt sie.
Karl-Heinz sagt: „Aus gesundheitlichen Gründen. Leuna macht alle kaputt.“
Karl-Heinz hat’s mit der Lunge.
Müller sagt: „Das sind die Abgase.“
Sie steigen in den Wagen, nun entdeckt, erwartet, verfolgt, eine Rundfahrt durch die Stadt, hinter ihnen ein Wartburg, kurz darauf hinter dem Reileck beim Museum für Vorgeschichte Verstärkung, zwei Trabis, damit sie ihnen nicht entkommen und sie die Möglichkeit haben, die Personalien der Ostdeutschen mit Westkontakt aufzunehmen und sie auf dem Revier verhören können. Nachdem er die Giebichenstein-Brücke überquert hat, zum „Krug zum grünen Kranze“ abgebogen ist, wendet, zurückfährt, vorbei an der Müntzer-Schule, die er ihnen zeigen wollte, am Bergzoo, zur Schleiermacherstraße und dem Spielplatz seiner Kindheit, nimmt er die Herausforderung an und nutzt seine Ortskenntnisse. Er gibt Gas, fährt mit überhöhter Geschwindigkeit, ohne Rücksicht auf die Federn der schwarzen BMW-Limousine, über das Kopfsteinpflaster, hinter sich den olivgrünen Wartburg, rast durch Schiller-, Lessing-, und Ossietzky-Straße, begegnet den Trabis an Kreuzungen, deren Fahrer sich an ihm orientieren müssen, umrundet mehrfach die Pauluskirche, hängt seine Verfolger ab, jagt Richtung Bahnhof, über den Ernst-Thälmann-Platz, nimmt den Weg nach Ammendorf, überholt eine Straßenbahn, parkt an einer Haltestelle, Christel und Karl-Heinz springen aus dem BMW, steigen in die Tram – und fahren davon. Ihre Verfolger sind außer Sicht.
Die Siedlung am Rand von Merseburg, schmucklose Reihenhäuser wie im Ruhrgebiet aus den zwanziger Jahren. Schlaglöcherstraßen. Hier leben sie. Nur ein paar Kilometer entfernt die größte Giftküche der DDR. Karl-Heinz fährt mit dem Rad zur Arbeit, die ihn ernährt und krank macht. Die Hymne des Arbeiter-und-Bauernstaates: „Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt …“ Die Fassaden der Reihenhäuser schmutzig, die Wäsche auf der Leine und das Gemüse im Garten mit Dreck überzogen, der Himmel schweflig gelb. Leben unter der Dunstglocke.
Müller bringt seine üblichen Geschenke aus dem Diplomatenladen mit – Zigaretten, Whisky, Schokolade, Kaffee, Tee, stern, Spiegel, Für Sie, Bunte, Freundin, Kicker – begehrte, verbotene Druckerzeugnisse.
Christel, Karl-Heinz und ihr Sohn Gregor leben noch immer in den Zwanziger-Jahre-Möbeln. Er erinnert sich an die Welt des Alten unten im Keller, mit Werkzeug aller Art, Hobelbank und Ersatzteilkisten. Hier sägte und zimmerte er, reparierte Zäune und Fahrräder, während Tante Frieda im Garten pflanzte, jätete, wässerte, erntete. Er entdeckt auf der Kredenz im Wohnzimmer eine Uhr, die ihn, als er ein paar Mal übernachtete, mit ihrem Ticken und den Glockenschlägen alle Viertelstunde um den Schlaf gebracht hatte.
Müller erzählt ihnen von diesen schlaflosen Nächten. „Du kannst die Uhr haben“, sagt Karl-Heinz.