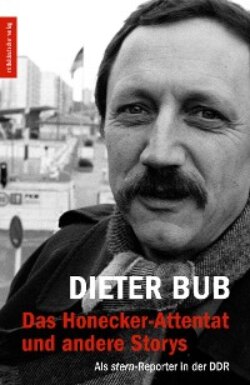Читать книгу Das Honecker-Attentat und andere Storys - Dieter Bub - Страница 9
Die neue Adresse im Osten
ОглавлениеDie Grauen an der Grenze können ihn nicht leiden, so wenig wie alle anderen, die hier nur nach Vorlage ihrer Dokumente, ohne Kontrolle ihrer Autos, ungehindert passieren dürfen, so oft sie wollen, auch mehrmals am Tag oder in der Nacht. Es sind die Männer und Frauen mit blauen Nummernschildern an ihren Dienstwagen aus dem Westen, teure Schlitten, die sich die Grauen in ihren Uniformen niemals würden kaufen können. Sie ahnen ebenso wenig wie er, dass sie diese hässlichen Verkleidungen in zehn Jahren ausziehen und wegwerfen werden, dass sie sich dann ungehindert auf die andere Seite begeben können – ohne von ihren Kameraden erschossen zu werden; dass sie dann jeden Wagen dieser Welt erwerben werden, wenn es ihnen gelingt, einen ordentlichen Job zu bekommen.
Was die Grauen auch nicht wissen: Er kommt gerne. Manchmal redet er mit ihnen, ohne sie anzusprechen. Sie spüren seine Gedanken, erspüren sie an seiner Freundlichkeit, seinem Lächeln, mit dem er ihnen begegnet, während sie die angeordnete Miene aufsetzen und anschließend Auffälligkeiten melden müssen.
Der Unbekannte vor ihm. Zurückhaltung, ein Gefühl von Beklemmung. Mitleid mit dem Kontrolleur, eingezwängt in einer Holzschachtel, zwei Quadratmeter Lebensfläche, acht Stunden am Tag, 160 Stunden im Monat, 1.760 Stunden im Jahr – vier Wochen Ferien bereits abgerechnet. Tage und Nächte auf zwei Quadratmetern zwischen dünnen Pressspanwänden. Vor ihm Gesichter, vertraut, Gesichter aus aller Welt, Spiegel von Normalisierung und internationaler Anerkennung, wie ein paar hundert Meter entfernt, Übergang Friedrichstraße, den die Amerikaner Checkpoint Charly nennen. Dort passieren sie alle: Japaner, Franzosen, Südafrikaner, Argentinier, Chinesen – die ganze Welt. Hier, Übergang Heinrich-Heine-Straße, erscheinen die Westdeutschen.
Die Wohnung ein Gefängnis im Gefängnis, in das er sich freiwillig begeben hat. Während Hunderte ihr Leben, ihre Freiheit riskierten, um herauszukommen, wollte er herein. Er sitzt im Betonkäfig, elfter Stock, vor dem Haus ein Uniformierter, hier oben Wände und Telefon verwanzt.
Ausblicke: vom Balkon nach drüben, in den Westen, zweihundert Meter entfernt die Mauer, der antifaschistische Schutzwall, hinter dem sich die imperialistischen Feinde des Springerkonzerns in ihrem Ullstein-Hochhaus Lügen über das sozialistische Vaterland ausdenken. Auf dem Dach das Emblem des Verlags als ständiges optisches Ärgernis. Nicht weit davon entfernt der Moritzplatz mit den Ateliers der neuen Wilden, die Kreuzberger Kneipen, eine Saufrepublik fröhlicher Zecher mit immer neuen Lebensformen, Experimenten, Diskussionen, Kreativität: Dichter, Maler, ein „König von Kreuzberg“, ein Gassenhauer: „Kreuzberger Nächte sind lang …“
Und hier, fünfhundert, tausend, zweitausend Meter entfernt, im Osten. Hier sitzt er fest. Die Abende sind trostlos. Fernsehen und Gin Tonic, zwei, drei, fünf. Bevor er ins Bett geht, um in diesem überheizten Zimmer, kopfschwer und unruhig, schlafen zu können, im Bewusstsein, sie sind bei dir, belauschen dich, kennen dich, erklärt er ihnen, sie müssten sich nicht weiter um ihn sorgen, er werde sich jetzt zur Ruhe begeben und wünsche ihnen eine angenehme, von Provokationen störungsfreie Nacht. Er gibt sich heiter, locker, aufgeräumt. Dabei fühlt er sich in Wahrheit miserabel. Er bedauert sich.
Eine auffällig stille Wohnung, in die trotz der dünnen Betonfertigteilwände selten Geräusche aus der Nachbarschaft dringen. Er hat andere Erfahrungen gemacht. Bei Leipziger Messen war er mehrmals in Neubausiedlungen einquartiert worden. Untergebracht im schmalen Zimmer der Kinder, die für diese Tage der Nebeneinkünfte bei Mutti und Vati schlafen mussten. Im Sanitärteil leere Waschmittel-Pappschachteln aus dem Westen aufgestellt, erreichten ihn von dort bereits früh um sechs die ersten akustischen Morgensignale der Körperhygiene, und nicht nur von dort, sondern aus vielen anderen Reinigungskabinen des Wohnblocks. Alles gleich nebenan. Erst danach kehrte Ruhe ein. Die Mieter verlassen ihre Dienstwohnungen, um den Abend drüben, auf der anderen Seite zu genießen, im Le Boubou, bei der Dicken Wirtin am Savignyplatz, bei Lutter und Wegener, in der Parisbar, im Florian oder bei irgendeinem Italiener, egal, jede Straße bietet mehr Abwechslung als hier die gesamte „Hauptstadt der DDR“.
Auf der anderen Seite der freie Blick auf den Gendarmenmarkt, noch immer Ruinen, trostlos, das Konzerthaus und der Französische Dom. Beginn erster Rekonstruktionen am Deutschen Dom, ein Vierteljahrhundert nach dem Krieg, vom endgültigen Abriss verschont. Allmähliche Besinnung auf Kultur und Tradition. Die sozialistischen Staatslenker im Arbeiter- und Bauernstaat erheben Anspruch auf deutsche Geschichte, erklären Martin Luther, gestern noch verhasst, zum progressiven Reformator und widmen ihm einen monumentalen Spielfilm. Erich Honecker gelüstet es nach alter Pracht. Ließ der Prolet und Stalinist Walter noch Kirchen sprengen, so ordnet sein Nachfolger den Wiederaufbau der Semperoper und des Konzerthauses an, schafft Luxusherbergen und einen „Palast der Republik“. Der gelernte Dachdecker aus Saarbrücken wünscht Glanz für seine Hauptstadt.
Allein im Betongeisterhaus, gemeinsam mit den Überwachungsleuten. Selbstgespräch. Trunkene Selbstbefragung: In der Isolation. Für monatlich 800 D-Mark Miete. Ausnahmesituation. Kein Leben draußen. Der Boulevard leer.