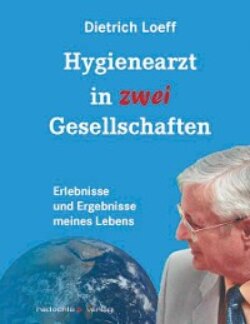Читать книгу Hygienearzt in zwei Gesellschaften - Dietrich Loeff - Страница 16
17. Juni 1953 in Berlin
ОглавлениеDas war kaum vorbei, überschlugen sich die Meldungen über Ereignisse in der DDR. Die Regierung hatte die Preise für mehrere Grundnahrungsmittel angehoben, Personen, die als privilegiert galten, zum Beispiel Hauseigentümern, die Lebensmittelkarten entzogen und sie auf das viel teurere Angebot der HO(4) verwiesen. Wir kannten eine solche Frau persönlich. Ihr lebenslang mühsam zusammengespartes, altes Haus mit einem Vordereingang und Seitenflügel warf wesentlich weniger ab, als zur Gebäudeerhaltung notwendig war. So musste die Besitzerin von ihrer geringen Rente zuschießen. Sie wurde nun plötzlich vom Staat geschröpft, wie eine Schwerreiche mit unredlich erworbenem Besitz und war der Verzweiflung nahe. So ging es vielen, doch war die Kritik noch gedämpft, neben der staatlichen Repression auch durch die Einsicht in die komplizierte wirtschaftliche Lage der DDR. Dann wurden die Arbeitsnormen allgemein und ohne Diskussion um zehn Prozent erhöht.
Am 9. und 11. Juni 1953 wurden die Preiserhöhungen bei zunehmendem Grummeln im Volke eilig zurückgenommen und die entzogenen Lebensmittelkarten wieder gewährt. Die Normerhöhungen aber blieben. Da lief das Fass über. So ließen die so oft glorifizierten Arbeiter nicht mit sich umgehen! Die Rücknahme von einigen Maßnahmen wurde auch als Schwäche gedeutet. Jetzt hieß es nachstoßen. Am 16. Juni 1953 streikten – so berichtet es die verbreitete Geschichtsschreibung(5) – die Bauarbeiter der bekanntesten Baustelle der DDR, der Stalinallee in Berlin (heute rückbenannt in Frankfurter Allee) und demonstrierten für ihre Forderungen. Die Rundfunksender Westberlins, speziell der RIAS(6) berichteten breit und intensiv. Auf den Straßen Ostberlins kochte, auch unter uns Jugendlichen, die Gerüchteküche bis in die Nacht.
Am 17. Juni 1953 früh kreuzten in Berlin-Johannisthal am Groß-Berliner Damm Kolonnen von Arbeitern mit Gesang meinen Schulweg. Irgendjemand versuchte anzustimmen: „Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wiederhaben“, was ich damals wie heute ziemlich unpassend fand und finde. Aber die meisten Menschenzüge auf den Straßen sangen nicht, sondern schritten still dahin. In der Schule war natürlich unter Schülern und Lehrern große Unruhe. Unsere Blicke gingen aus den Klassenfenstern zur S-Bahn: Fährt sie noch oder streikt sie auch? Noch bessere Sicht auf die Straße und S-Bahn hatten wir aus den Turnhallenfenstern, weil sie näher zur Hauptstraße lagen. Plötzlich ertönte durch unseren Sportlärm hindurch Kettengerassel: Ein einzelner Panzer rollte stadteinwärts. Ihn begleitete unser vielstimmiger, gellender Wutschrei!
Gegen Mittag endete unser Unterricht. Die S-Bahn fuhr nicht mehr, was wir freudig registrierten. Eine Reihe meiner Mitschüler griff sich ihre Fahrräder und strebte der Innenstadt zu, um sich ein eigenes Bild zu machen. Ich selbst blieb zu Hause, ich weiß nicht mehr, ob ich damals schon ein Rad besaß oder aus Vorsicht den gefährlichen Ereignissen fern blieb. Aber viele zeitgenössische und historische Beschreibungen der Ereignisse berichten über zahlreiche junge Radfahrer, die zwischen den Demonstrationszügen pendelten, Nachrichten zwischen ihnen übermittelten und das Geschehen beobachteten.
Die vereinzelte Behauptung, das seien westliche Agenten und Rädelsführer gewesen, kann ich insgesamt nicht beurteilen. Jedenfalls waren meine radelnden Klassenkameraden ganz bestimmt keine bewussten Täter, ganz gleich wofür, sondern einfach neugierig und auch jugendgemäß abenteuerlustig. Übrigens gibt es mindestens ein Bild der Novemberrevolution 1918 in Berlin, auf dem ebenfalls Jungen neben der Spitze eines Demonstrationszuges herlaufen (zum Beispiel unter www.preussen-chronik.de), allerdings damals noch ohne die seinerzeit teuren Fahrräder.
Im RIAS wurde berichtet, dass die Stahlwerker von Hennigsdorf, nordwestlich von Berlin, durch Westberlin hindurch nach Ostberlin gezogen kämen. Gleichzeitig ging aus den Meldungen hervor, dass DDR-Polizei auf Demonstranten schoss, dass der Blockpolitiker Otto Nuschke (DDR-CDU) mit seinem Auto kurzzeitig nach Westberlin abgedrängt wurde, dass unter den Demonstranten plötzlich an vielen Orten Personen auftauchten, die man als SED-gesteuert ansah, weil sie zum Abbruch der Kundgebungen aufforderten. Und die Präsenz von sowjetischen Panzern nahm zu. Es folgte die Verhängung des Ausnahmezustandes mit Versammlungsverbot und nächtlicher Ausgangssperre.
Gegen Abend strahlte der schon tagsüber hochaktive RIAS einen Kommentar aus, der den Demonstranten riet, die Aufmärsche abzubrechen. Dazu wurde gesagt, dass erst nach dem Ende der Demos die Sowjetmacht die DDR-Führung für politisches Versagen maßregeln würde und deshalb bald äußere Ruhe eintreten sollte. Ich weiß nicht, wer da sprach, aber nach eigenem Bekunden hat damals Egon Bahr(7) die Forderungen der Arbeiter der DDR prägnant zusammengefasst und intensiv verbreitet.
Er könnte auch gut und gern diese Argumente geliefert haben, einen Aufstand abzubrechen, der bei seiner weiteren Fortsetzung nur noch mehr sinnloses Blutvergießen kosten würde. Falls der RIAS wirklich, wie die DDR-Oberen behaupteten, mit dem US-Geheimdienst verquickt war, benutzte er jedenfalls eine psychologisch geschickte Argumentation, um den Demonstranten den unvermeidlichen Rückzug schmackhaft zu machen.
Die Nacht zum 18. Juni 1953 war für mich lange schlaflos. Auf der südöstlichen Ausfallstraße durch Grünau, Adlershof, Schöneweide (damals Adlergestell und Grünauer Straße, heute Michael-Brückner-Straße) rollten vom Abend bis in die tiefe Nacht ununterbrochen Panzer. Diese Straße lag von meiner Wohnung vielleicht 1 200 Meter Luftlinie entfernt. In der Stille der Nacht hörte man einen Panzer damaliger Bauart auf befestigter Straße etwa vier bis acht Kilometer weit. An einer bestimmten Stelle erreichten sie anscheinend anderen Straßenbelag oder wechselten die Fahrweise, hörbar durch den anderen, grelleren Klang ihrer Ketten. So konnte ich durch das dröhnende Grundgeräusch der Kolonnen hindurch mühelos die Kettenfahrzeuge mitzählen. Es waren viele Hundert, ehe ich endlich unruhig einschlief.
An den Folgetagen war die Lage in Berlin noch gespannt. Die Treskowbrücke über die Spree zwischen Nieder- und Oberschöneweide wurde von sowjetischen Soldaten in einer Maschinengewehrstellung bewacht. Panzer waren in den Außenbezirken, zu denen Schöneweide gehörte, aber selten, in der Innenstadt schon häufiger zu sehen. Die S-Bahn fuhr noch tagelang nicht. Das führte zu einem traurigen Nachspiel. Ein junger Lehrer, Herr Hachfeld, wohnte in Eichwalde, am Stadtrand von Berlin und kam sonst mit der S-Bahn zum Unterricht. Als sie ausfiel, benutzte er sein Fahrrad. Zwischen Grünau und Adlershof gab es damals eine Brücke über den Teltowkanal, die heute Stelling-Janitzky-Brücke heißt und inzwischen umfassend erneuert wurde. Sie hatte aber damals unter den jungen Radfahrern einen üblen Ruf: Steiler Anstieg von der Straße zum Brückenscheitel, dazu Übergang von Asphaltbelag auf Kopfsteinpflaster und fast oben wechselte der einseitige Radweg auf die andere Fahrbahnseite.
Unser junger Lehrer muss dieses Hindernis wohl schlecht gekannt haben und glaubte, den Seitenwechsel des Radweges noch rechtzeitig zu schaffen. Dabei geriet er unter einen LKW und wurde tödlich verletzt. Die ganze Schule trauerte, Lehrer wie Schüler. Ich werde seine Beisetzung nicht vergessen: Wir trauernden Schüler, meist in ungewohnten, dunklen Anzügen mit langen Hosen, standen bei glühender Hitze lange auf dem Friedhof. Mehrere kollabierten und mussten in die etwas kühlere Feierhalle gelegt und mit Wasser besprüht werden.