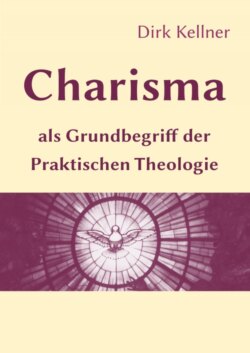Читать книгу Charisma als Grundbegriff der Praktischen Theologie - Dirk Kellner - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4.3.1 Integration von Institutionalität, Sozialität und Individualität
ОглавлениеZunächst knüpft Kunz an die grundlegende Unterscheidung und Verhältnisbestimmung von «Gesellschaft» und «Gemeinschaft» von Ferdinand Tönnies an, nach der die Moderne durch eine unumkehrbare Entwicklung der ursprünglichen und natürlichen menschlichen «Gemeinschaft» zur differenzierten «Gesellschaft» gekennzeichnet ist.[525] Das bei Tönnies marxistisch gefärbte romantische Gemeinschaftsideal überwindet Kunz durch Rekurs auf Ernst Troeltschs Typologie der drei religiösen Gemeinschaftsformen Kirche, Sekte und Mystik. Die «Kirche» ist «Heils- und Gnadenanstalt für die Massen», die «Sekte» eine «freie Vereinigung strenger und bewusster Christen».[526] Die «Mystik» schließlich ist geprägt durch «Verinnerlichung und Unmittelbarmachung der in Kult und Lehre verfestigten Ideenwelt zu einem rein persönlich-innerlichen Gemütsbesitz».[527] Da jede der drei Sozialgestalten durch Verabsolutierung zur aporetischen Reinform wird,[528] votiert Kunz im Anschluss an Troeltsch für eine «gegenseitige Durchdringung»[529] der antagonistischen Aspekte und für das «Ideal einer Synthese»[530], in der sich Institutionalität (Kirche), Sozialität (Sekte) und Individualität (Mystik) kritisch-komplementär zu ihren Idealformen verbinden.
Für den Gemeindeaufbau, der eine besondere Affinität zur Sozialität des Glaubens hat, bedeutet dies, dass er die Aspekte der Individualität und Institutionalität integrieren muss. Ansonsten verfällt er der Aporie der «Sekte», wird zur totalitären Gemeinschaftsideologie und führt zum Separatismus. Die Leitfrage für die Gemeindeaufbautheorie lautet daher: «Wie kann die Gemeinschaftsbildung aus dem lähmenden Antagonismus der explizit anti-institutionellen und anti-individuellen Reinform ‹Sekte› in die Realisierung der Koinonia überführt werden?»[531]