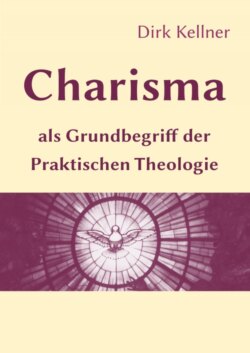Читать книгу Charisma als Grundbegriff der Praktischen Theologie - Dirk Kellner - Страница 49
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4.5 Zusammenfassung und kritische Würdigung
Оглавление1. Die «Theorie des Gemeindeaufbaus» von Ralph Kunz ist der erste und bislang einzige Versuch, den Weber’schen Charismabegriff konstruktiv in die oikodomische Grundlagenreflexion einzubringen.[571] Im Rekurs auf die moderne Weberinterpretation widerspricht er der einseitig anti-institutionellen Auslegung seines Ansatzes, der Teile der protestantischen Ekklesiologie in ihrer kritisch-ablehnenden Haltung gegenüber allem Institutionellen bestärkt hat. In Verbindung mit Troeltschs Typologisierung christlicher Gemeinschaftsformen kommt er zu einer kritisch-komplementären Vermittlung von Institution und Charisma, von Gemeindeaufbau und Kirche, die einen strikten Antagonismus ebenso hinter sich lässt wie eine apriorische Identifikation. Gemeindeaufbau ist nach Kunz als charismatische Revitalisierungsbewegung für die Lebendigerhaltung der Kirche notwendig. Die ängstliche Ablehnung jeder Koinonia-Realisierung lasse die Kirche zum leeren Gehäuse ohne Lebendigkeit erstarren, in der Charisma nur noch in der veralltäglichten und versachlichten Gestalt zu finden sei. Umgekehrt werde Gemeindeaufbau erst durch die konziliare Verbindung mit dem institutionellen Rahmen der Kirche vor der Gefahr bewahrt, eine charismatische Gemeinschaftsideologie totalitär als Norm zu proklamieren. Charisma und Institution seien daher nicht prinzipielle Gegensätze, sondern immer wieder neu zu vermittelnde Momente aller menschlichen Gemeinschaft. Erst die Vereinseitigung eines Moments führe zu aporetischen Konfliktkonstellationen. Der soziologische Charismabegriff verhilft Kunz zu einer «verschärften Wahrnehmung für die Krisenanfälligkeit der Erneuerung menschlicher und religiöser Vergemeinschaftung»[572].
2. Die konstruktive Aufnahme von Webers Charismakonzept ermöglicht Kunz auf der einen Seite eine soziologische Begründung der Notwendigkeit von Gemeindeaufbau, wenn sich die Gemeindepraxis nicht auf Verwaltung des institutionalisierten Charismas beschränken soll. Koinonia-Realisierung ist unabdingbar, denn nur in ihr kann die «heilende Partizipation am Leib Christi» Gestalt annehmen. Auf der anderen Seite ist allerdings zu fragen, ob der Gemeindeaufbau nicht relativiert und «domestiziert» wird, wenn normative Elemente prinzipiell unter Totalitarismusverdacht geraten. Jede materiale Gestaltung, die sich nicht dem Diktat des Frömmigkeitspluralismus beugt und sich dadurch selbst in ihrem Anspruch einschränkt, muss dann auf dem Weg in die Aporie «Sekte» gesehen werden. Gemeindeaufbau als (im soziologischen und theologischen Sinn) charismatische Revitalisierungsbewegung wäre dann zwar formal notwendig, in seiner jeweiligen Gestalt aber nur von relativer Bedeutung. Dass angesichts der Individualisierung und Pluralisierung religiöser Lebensformen keine Koinonia-Gestalt absolute Geltung beanspruchen kann und normative Kriterien nicht autoritär-gesetzlich eingebracht werden können, ist nicht generell zu bestreiten. Dennoch stellt sich die Frage, ob nicht in einer bestimmten Gestalt von Koinonia-Realisation grundlegende Einsichten in das Wesen der Gemeinde und in das Wirken des Geistes gestaltbildend gewirkt haben könnten, die dem Frömmigkeitspluralismus der Volkskirche mit ihrer – von Kunz selbst eingestandenen – zum Teil diffusen Religiosität kritisch begegnen und an die charismatische Dimension von Gemeinde erinnern müssten. Zur Diskussion steht letztlich die Normativität der paulinischen Charismenlehre für die praktisch-theologische Reflexion. Kann sie so gefasst werden, dass Charisma Geschenk der Charis bleibt und nicht zur Forderung eines unevangelischen Nomos wird?
3. In diesem Zusammenhang ist weiterhin zu fragen, ob durch den prinzipiellen Verzicht auf «normative Kriterien»[573] die Situation des modernen religiösen Individualismus und der differenzierten volkskirchlichen Mitgliedschaft unter der Hand von einem Faktum zu einer Norm zu werden drohen.[574] Dann würden die «Grundsätze der christlichen Überlieferung», die mit «Einsichten gegenwärtiger Erfahrung» zu «synthetischen Urteilen» zu verbinden sind, die wiederum «die Grundlage der Verantwortung für das gemeinsame Leben der Christen bilden»,[575] noch vor ihrer Vermittlung unter das Kriterium gestellt, inwiefern sie der Situation des neuzeitlichen Christentums entsprechen. Wird aber dem Faktischen implizit oder explizit Normativität zugesprochen, dann muss zwangsläufig das kritische und erneuernde Potential der neutestamentlichen Ekklesiologie und damit auch der paulinischen Charismenlehre soweit relativiert werden, dass es weder dem religiösen Individualismus noch der distanzierten Mitgliedschaft oder der Pfarrerzentrierung widersprechen kann. Die bittere Kritik von Michael Herbst würde dann zutreffen:
«Das Anormale (im Sinne ekklesiologischer Grundentscheidungen des Neuen Testaments) wird zum wohlgelittenen Normalfall stilisiert. Das Normale hingegen muß sich der Verdächtigung der Gesetzlichkeit ausgesetzt sehen. Das normale Christen- und Gemeindeleben wird zum Luxus erklärt, auf den der Getaufte eben auch verzichten kann, ohne daß dies zu großem Kummer in der Volkskirche führen würde.»[576]
4. Aufgrund der möglichen Konvergenz von theologischem und soziologischem Charismabegriff hält Kunz die Auseinandersetzung mit beiden Konzeptionen für «lohnend». Anhand der paulinischen Unterscheidung von χαρίσματα und πνευματικά findet er eine «kritische Anschlussmöglichkeit», die das Potential des soziologischen Charismabegriffs in der Wahrnehmung der konfliktreichen Beziehung von Charisma und Institution auszuschöpfen vermag und zur Ortsbestimmung des Gemeindeaufbaus zwischen «veralltäglichtem Charisma» und «Charisma-als-Lebensform» beiträgt.
Im Vergleich zum soziologischen wird der theologische Charismabegriff aber nur in sehr begrenztem Umfang und stets bezogen auf sein Verhältnis zum soziologischen Derivat interpretiert. Dabei kommt zwar seine strukturelle Außenseite, kaum aber seine pneumatologische Innenseite zur Geltung. Charismata im paulinischen Sinne sind für Kunz «Lebensäusserungen des geistbegabten Menschen», durch die eine «Situation existentieller Betroffenheit» entsteht, in der die «Routine des Alltags zerbricht […] und das Existentielle zum Durchbruch kommt».[577] Es muss gefragt werden, ob diese existentiale Interpretation der Intention der paulinischen Charismenlehre gerecht wird und ihre Relevanz für eine theologische Theorie des Gemeindeaufbaus ausreichend würdigen kann. Auffallend ist jedenfalls, dass im prinzipiellen und materialen Begründungszusammenhang der Koinonia-Realisierung der theologische Charismabegriff keine zentrale Funktion innehat, obwohl sich gerade aus dem von Kunz vertretenen Verständnis der «Koinonia» weiterführende Anschlussmöglichkeiten ergeben hätten. Einerseits entspricht die partizipative und demokratische Struktur der Koinonia dem von Paulus skizzierten Bild der charismatischen Gemeinde. Andererseits hätte durch einen theologischen Rekurs auf die paulinische Charismenlehre die Koinonia-Realisierung als «heilende Partizipation am Leib Christi» nicht nur christologisch-inkarnatorisch als «Beteiligung des Menschen an der Seinsmächtigkeit des lebendigen Christus»[578], sondern zugleich pneumatologisch als Indienstnahme durch das charismatische Wirken des Heiligen Geistes begründet werden können. Christen können sich – wie Kunz in Aufnahme einer Formulierung Bonhoeffers sagt – gegenseitig als «Bringer der Heilsbotschaft»[579] begegnen, weil sie vom Geist durch das Charisma in je individueller Verschiedenheit dazu befähigt und berufen werden.
5. Weiterhin ist zu fragen, ob über den Charismabegriff nicht auch eine Vermittlung von opus Dei und opus hominum oder zumindest eine pneumatologische Präzision der von Kunz als «fundamentale Verlegenheit» bezeichneten Spannung «zwischen Handeln und Glauben» möglich gewesen wäre.[580] Einen Anknüpfungspunkt bietet Kunz selbst, indem er menschliches und göttliches Handeln in den Zusammenhang von Geisteinheit und Geistvielheit stellt:
«Sofern Koinonia-Realisierung prinzipiell als ein opus dei begriffen wird, ist sie die Bewegung des Geistes Christi, von dem gilt, dass er Einheit ist (1Kor 12; Eph 4). Wird die Realisierung der Koinonia als ein opus hominum verstanden, muss die Vielfalt der Bewegungen Thema werden. Für die Theorie des Gemeindeaufbaus ist diese Würdigung der Pluralität der Gestalten unter Wahrung der Einheit ihres Grundes die zentrale Entscheidung, die die Grundlage bildet für die Reflexion der Gemeinschaftsbildung.»[581]
Hier könnte weiter gefragt werden, ob von 1Kor 12–14 her nicht nur die Einheit, sondern auch die Vielheit auf ein opus Dei zurückzuführen ist. Sie wäre dann nicht nur Folge der conditio humana, sondern als Ausdruck des charismatischen Geistwirkens zu qualifizieren. Die Vielfalt, an der jeder konziliaren Gemeindetheorie besonders gelegen ist, würde dadurch einerseits auf das Christusbekenntnis als dem Kriterium, Ziel und einenden Punkt der Geistmanifestationen beziehbar (1Kor 12,2), andererseits auf den gemeinsamen Gottesdienst als dem originären Ort, an dem sich der Geist in der Vielfalt der Charismen konkretisiert, Oikodome und Koinonia wirkt (vgl. 1Kor 14,23.26).[582]