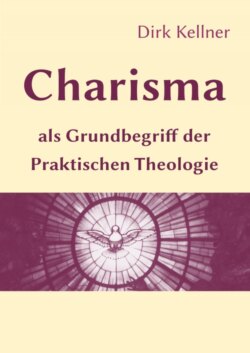Читать книгу Charisma als Grundbegriff der Praktischen Theologie - Dirk Kellner - Страница 60
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.5.4.1 Das funktionale Paradigma
ОглавлениеChristian A. Schwarz modifiziert die antithetische Polarität von «Kirche» und «Ekklesia» zu einer funktionalen Zuordnung von «Institution» und «Ereignis».[714] Damit steht die «Kirche» als institutioneller Rahmen nicht mehr der ihr wesensfremden personalen Gemeinschaft der «Ekklesia» gegenüber. Vielmehr sind beide Elemente, das dynamisch-personale («Ereignis») und das statisch-institutionelle («Institution»), konstitutiv für die «Kirche»[715]. Sie ist immer zugleich «Kirche als Ereignis» und «Kirche als Institution».[716] Die Gefahr einer «strikte[n] Trennung»[717] und eines sich gegenseitig neutralisierenden «schiedlich-friedlichen Nebeneinander[s]»[718] zweier Größen wird durch die Wechselbeziehung von zwei zu unterscheidenden, aber untrennbaren Polen überwunden. Theorie und Praxis des Gemeindeaufbaus zielt auf die «Integration von Ereignis und Institution»[719].
Das dynamische Element (Kirche als Ereignis) ist nach Schwarz durch «Glaube, Gemeinschaft und Dienst»[720] konstituiert. Diese «grundlegenden Lebensäußerungen von Gemeinde Jesu Christi»[721] können nicht institutionell garantiert werden. Sie seien unverfügbar und «nicht einfach vorauszusetzen, wo eine Kircheninstitution vorhanden ist, sondern müssen immer wieder neu geschehen»[722]. Kirche als Ereignis könne aber nie im institutionsfreien Raum Wirklichkeit werden. Die Schaffung rechtlich geordneter Institutionen in der Anfangszeit der Kirche sei geschehen, um dem Ereigniswerden von Glaube, Gemeinschaft und Dienst als «Schutz, Bewahrung und Förderung»[723] zu dienen. Die drei Elemente «Lehre», «Sakramente» und «Amt», die das statische Element (Kirche als Institution) kennzeichnen, seien dem dynamischen Element funktional zuzuordnen.[724] Sie können «das Ereignis- und Gestaltwerden von Gemeinde»[725] nicht sichern, aber ihm dienen und es fördern.
Die funktionale Unterscheidung und Zuordnung von Institution und Ereignis ist die Basis des theologischen Paradigmas des Gemeindeaufbaus, das von Schwarz «funktionales Paradigma» oder «Gemeindeaufbau-Paradigma» genannt wird.[726] Es stellt alle institutionellen Elemente in der theologischen Theorie und in der gemeindlichen Praxis unter das Kriterium der Nützlichkeit für das Werden von Glaube, Gemeinschaft und Dienst. «Funktionalität» wird zur entscheidenden nota ecclesiae: «Kriterium für jede Kirche sollte sein, wie nützlich sie für den Gemeindeaufbau ist. In dem Maße, wie sie diesem Maßstab gerecht wird, ist sie ‹wahre Kirche›.»[727]
Dieses «neue Paradigma» wird von Schwarz auf der einen Seite unterschieden von dem «mystischen Paradigma», das in einem schwärmerischen Subjektivismus den Ereignischarakter verabsolutiere und prinzipiell institutionsfeindlich sei. Auf der anderen Seite grenzt er sich von einem «magischen Paradigma» ab, das in einem institutionalistischen Objektivismus vom Vorhandensein der institutionellen Elemente auf das Vorhandensein von Glaube, Gemeinschaft und Dienst schließe.[728] Das «funktionale Paradigma» stehe zwischen «Mystik» und «Magie», insofern es an der Notwendigkeit von Institutionen festhalte, sie zugleich aber dem Ereigniswerden von Gemeinde funktional zuordne und dadurch relativiere.
Durch das funktionale Paradigma versucht Schwarz, zu einer Lösung der Frage nach der «Machbarkeit» des Gemeindeaufbaus zu kommen. Wenige Jahre zuvor hatte er in einem Artikel der Zeitschrift «Gemeindewachstum» den «ewigen Vorwurf der Machbarkeit» noch durch einen Verweis auf 1Kor 3,9 für «ein für alle Mal als gelöst» betrachtet:[729] «Gott baut – und wir bauen mit. Punkt.»[730] Durch die Unterscheidung von Institution und Ereignis kann Schwarz nun differenzieren: Während Gemeinde als Ereignis unverfügbar bleibe, seien die Institutionen «machbar» und «verfügbar».[731] Das Verfügbare sei im Gemeindeaufbau «derartig unter das Kriterium der Funktionalität zu stellen, daß das Unverfügbare geschehen kann»[732].
Schwarz wehrt sich dabei ausdrücklich gegen den Vorwurf eines «untheologischen Pragmatismus»[733]. Die Frage nach der Funktionalität sei eine «eminent theologische Frage»[734]. Auch wenn der Begriff nicht in der Schrift vorkomme, so sei doch die gemeinte Sache biblisch-theologisch legitim. So setze Paulus in 1Kor 10,23, dem «locus classicus für biblische Funktionalität»[735], das Kriterium der Nützlichkeit parallel zum Kriterium der Auferbauung der Gemeinde und interpretiere dadurch beide Begriffe wechselseitig: «Nützlich ist, was der Auferbauung (oikodome) dient.»[736] Zugleich grenzt sich Schwarz gegen eine «lineare Kausalitätslogik mit einem statischen Ursache-Wirkung-Schema» ab.[737] Die Funktionalität institutioneller Ordnungen, das heißt ihr Vermögen, Gemeinde Ereignis werden zu lassen, sei Wirkung und sichtbare Manifestation des Geistes: «Der Heilige Geist ist derjenige, der das, was wir mit ‹Funktionalität› meinen, bewirkt […] [so] dass man geradezu von pneumatischer Funktionalität sprechen könnte.»[738] Wo der «Kreislauf» von Institution und Ereignis intakt ist, werde «in der Kraft des Geistes Gemeinde gebaut».[739]