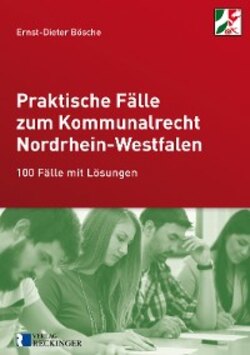Читать книгу Praktische Fälle zum Kommunalrecht Nordrhein-Westfalen - Ernst-Dieter Bösche - Страница 5
1. Fall: Selbstverwaltung, Eingriff durch Gesetz, Kommunalverfassungsbeschwerde
ОглавлениеSachverhalt
Der Landtag des Landes NRW plant, § 65 GO dahin gehend zu ändern, dass
1.die Amtszeit des Bürgermeisters fünf oder sieben Jahre beträgt und jede Gemeinde durch Hauptsatzungsregelung bestimmen kann, ob ihr Bürgermeister auf fünf oder sieben Jahre gewählt wird;
2.bei Beendigung des Beamtenverhältnisses des Bürgermeisters vor Ablauf seiner Amtszeit der Nachfolger für die Restwahlzeit durch die Bezirksregierung bestellt wird.
Aufgabe
Etliche Gemeinden fühlen sich durch diese beabsichtigten Regelungen bevormundet und in ihren Rechten beeinträchtigt.
Könnten sie nach Erlass des entsprechenden Gesetzes dagegen vorgehen und hätte ihr Vorgehen Aussicht auf Erfolg?
Lösung
Nach Art. 75 Nr. 4 LVerf, §§ 12 Nr. 8, 52 VGHG können Gemeinden grundsätzlich Verfassungsbeschwerde mit der Behauptung erheben, dass Landesrecht die Vorschriften der Landesverfassung über das Recht der Selbstverwaltung verletze.
Eine solche Verfassungsbeschwerde hätte Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet wäre.
A. Zulässigkeit
Die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde setzt
a)Beteiligtenfähigkeit (§ 52 Abs. 1 VGHG),
b)tauglichen Beschwerdegegenstand (§ 52 Abs. 1 VGHG),
c)Beschwerdebefugnis (§ 52 Abs. 1 VGHG),
d)schriftlich begründeten Antrag (§ 18 Abs. 1 VGHG) und
e)Fristwahrung (§ 52 Abs. 2 VGHG)
voraus.
a) Als Gemeinden sind die betroffenen Gemeinden beteiligungsfähig.
b) Die Gemeinden wenden sich gegen eine landesrechtliche Gesetzesvorschrift, die sie für unvereinbar mit Art. 78 Abs. 1 LVerf halten. Folglich wäre die Beschwerde auch statthaft.
c) Beschwerdebefugnis ist nur gegeben, wenn die Behauptung erhoben werden kann, dass das Landesrecht die Vorschriften der Art. 78, 79 LVerf über das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht verletzt, zumindest darf die Möglichkeit einer solchen Verletzung nicht von vornherein ausgeschlossen sein. Außerdem müssen die Gemeinden unmittelbar, selbst und gegenwärtig betroffen sein.
Die Gemeinden können geltend machen, durch die beabsichtigte Änderung der GO in ihrem Recht auf Selbstverwaltung nach Art. 78 Abs. 1 LVerf insofern verletzt zu sein, als eine Verletzung der von diesem Selbstverwaltungsrecht umfassten Organisationshoheit möglich erscheint.
Alle Gemeinden in NRW sind Adressaten der GO, die unmittelbar nach Inkrafttreten die Wirksamkeit der neuen Regelung entfaltet.
Die Gemeinden wären nach Erlass des Gesetzes durch die Änderung also selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen.
Beschwerdebefugnis wäre folglich gegeben.
d) und e) Die Verfassungsbeschwerde müsste in schriftlich begründeter Form innerhalb eines Jahres seit dem Inkrafttreten des Gesetzes erhoben werden.
Die Verfassungsbeschwerde wäre damit zulässig.
B. Begründetheit
Die Verfassungsbeschwerde wäre begründet, wenn die angegriffene Rechtsnorm des Landes (Änderung GO) die Vorschriften der Landesverfassung über das Selbstverwaltungsrecht (Art. 78, 79) verletzt.
Das nach Art. 78 Abs.1 LVerf gewährleistete Recht auf Selbstverwaltung ist das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich zu regeln. Dazu gehört auch die Organisationshoheit. Die Organisationshoheit beinhaltet u.a. das Recht, die eigenen Organe selbst zu wählen.
Die beabsichtigte Gesetzesänderung könnte in zweierlei Hinsicht die Organisationshoheit tangieren, und zwar
a)bezüglich der Dauer der Amtszeit und
b)hinsichtlich der Nachfolgebestimmung bei vorzeitigem Ausscheiden des Amtsinhabers.
a) Als Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht ist jede Beschneidung und Beschränkung des Rechts zu werten.
Durch die beabsichtigte GO-Änderung sollen die Gemeinden künftig selbst festlegen können, ob die Amtszeit ihres Bürgermeisters fünf oder sieben Jahre dauern soll. Nach der derzeitigen Regelung des § 65 GO beträgt die Amtszeit des Bürgermeisters für alle Gemeinden unabdingbar fünf Jahre. Die Möglichkeit künftig zwischen fünf und sieben Jahren wählen zu können, erweitert die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Gemeinden. Das Selbstverwaltungsrecht wird nicht beschränkt, sondern erweitert. Es liegt also gar kein Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht vor.
Insoweit wäre eine Verfassungsbeschwerde gegen die Änderungsregelung nicht begründet.
b) Nach derzeitiger Rechtslage (§ 65 Abs. 5 GO) wird bei vorzeitigem Ausscheiden des Bürgermeisters je nach Zeitpunkt des Ausscheidens ein Nachfolger von den Bürgern für den Rest der laufenden Wahlzeit des Rates oder bis zum Ende der nächsten Wahlzeit gewählt. Innerhalb der letzten neun Monate der verbleibenden Wahlzeit findet keine Nachfolgewahl mehr statt (§ 65 Abs. 6 GO).
Durch die beabsichtigte Änderung wird den Gemeinden für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens des Bürgermeisters die Möglichkeit, selbst (durch die Bürgerschaft) einen Nachfolger zu wählen, gänzlich genommen. Das Recht, als Ausfluss der selbstverwaltungsrechtlich geschützten Organisationshoheit das gemeindliche Organ Bürgermeister selbst zu wählen, wird für diese Fälle beseitigt.
Insoweit läge ein Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden vor.
Art. 78 Abs. 2 LVerf garantiert das Selbstverwaltungsrecht nur im Rahmen der Gesetze. Das Selbstverwaltungsrecht gilt also nicht uneingeschränkt. Der Gesetzgeber darf das Selbstverwaltungsrecht grundsätzlich einschränken. Der Regelungsbefugnis des Gesetzgebers sind allerdings Grenzen gesetzt („Schrankenschranken").
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist der „Kernbereich" der Selbstverwaltung unantastbar. Der Wesensgehalt der Selbstverwaltung darf nicht „ausgehöhlt" werden. Im „Randbereich" der Selbstverwaltung muss den Gemeinden (nach dem Eingriff) ausreichender Gestaltungsspielraum bleiben.
Bei der Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit eines gesetzlichen Eingriffs ist also zunächst zu prüfen, wie wesentlich der Eingriff ist. Ein Eingriff in den Kernbereich (Wesensgehalt) der Selbstverwaltung ist immer verfassungswidrig und damit unzulässig. Ein Eingriff in den Randbereich der Selbstverwaltung ist verfassungsgemäß und somit zulässig, wenn er verhältnismäßig ist.
Ein gesetzlicher Eingriff ist verhältnismäßig, wenn er
-einen legitimen Zweck verfolgt,
-geeignet ist,
-erforderlich und
-angemessen ist.
Ein legitimer Zweck wird verfolgt, wenn der Zweck dem Allgemeinwohl dient. Geeignet ist die Eingriffsmaßnahme, wenn der mit dem Eingriff verfolgte Zweck damit erreicht oder zumindest gefördert wird. Erforderlich ist der Eingriff, wenn es kein minder beeinträchtigendes Mittel gibt, um den Eingriffszweck zu erreichen. Angemessen ist die Maßnahme, wenn der angestrebte Zweck und der Nachteil, den die Gemeinden durch den Eingriff erleiden, in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen.
Es ist daher zu prüfen, wie wesentlich der Eingriff durch die beabsichtigte GO-Änderung wäre.
Die Gesetzesänderung würde in einem wesentlichen Teilbereich der Organisationshoheit, nämlich der Wahl der eigenen Organe, das Recht auf Selbstverwaltung nicht nur beschränken, sondern teilweise total beseitigen. Im Falle der Anwendung der beabsichtigten Gesetzesregelung gäbe es Gemeinden mit staatlich eingesetzten Organwaltern, die mehrere Jahre (je nach Zeitpunkt des vorzeitigen Ausscheidens des Amtsvorgängers) als Bürgermeister der betroffenen Gemeinden amtieren würden, ohne durch die Bürgerschaft legitimiert zu sein. Nach § 40 Abs. 2 Satz 1 GO wird die Bürgerschaft u.a. durch den Bürgermeister vertreten. Dieses elementare Recht der Bürger, ihre Vertretung (Art. 28 Abs. 2 Satz GG) zu wählen, wäre u. U. für einen durchaus nicht unerheblichen Zeitraum nicht mehr vorhanden.
Die beabsichtigte Änderung des § 65 GO würde insoweit einen Eingriff in den Kernbereich der Selbstverwaltung darstellen. Dieser Eingriff wäre verfassungswidrig und damit unzulässig.
Die Verfassungsbeschwerde wäre insoweit begründet.
Die Verfassungsbeschwerde hätte folglich bezüglich der Regelung über die Nachfolgebestimmung Aussicht auf Erfolg.
Anmerkung: Es empfiehlt sich im Zusammenhang mit der Nachbearbeitung des 1. Falles das Urteil des VerfGH NRW vom 15. Januar 2002 - VerfGH 40/00 - NWVBl. 2002, 1502 zu lesen.