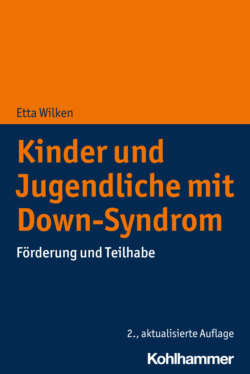Читать книгу Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom - Etta Wilken - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Ursache
ОглавлениеDie Ursache des Down-Syndroms war lange Zeit nicht bekannt. Zahlreiche Vermutungen und absurde Theorien wurden geäußert (z. B. Alkoholismus, Tuberkulose, Regression in der menschlichen Entwicklung), die zeitweise zu problematischen Einstellungen gegenüber Betroffenen und ihren Familien führten. Obwohl schon 1932 aufgrund der Vielzahl auftretender Veränderungen vermutet wurde, dass beim Down-Syndrom eine Chromosomenstörung vorliegen müsse (Waardenburg), gelang erst 1959 einer französischen Forschergruppe (Lejeune, Gautier, Turpin) der Nachweis, dass dem Auftreten des Down-Syndroms eine Trisomie zugrunde liegt.
Beim Down-Syndrom ist das Chromosom 21 nicht zweimal, sondern dreimal vorhanden. Dieses zusätzliche dritte Chromosom bewirkt erhebliche Störungen des normalen biochemischen Gefüges und führt zu deutlichen Abweichungen in der Entwicklung aufgrund eines direkten Effektes durch die 1,5 fache Gendosis und eines indirekten Effektes durch eine veränderte Regulation der verschiedensten Gene auf anderen Chromosomen.
Obwohl das Chromosom 21 zu den kleinsten gehört (nur 1,5 % der menschlichen Erbinformation liegen darauf), sind die auftretenden prä- und postnatalen Veränderungen sowie die Beeinträchtigungen in der gesamten Entwicklung vielfältig.
Das Entstehen der chromosomalen Fehlverteilung erfolgt fast immer zufällig. Allerdings nimmt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten mit höherem Lebensalter der Mutter zu. Selten spielen auch genetische Faktoren eine Rolle. Immer wieder werden aber Vermutungen geäußert, dass zudem auch eine Vielzahl unterschiedlicher exogener Risiken wie Strahlenschädigungen oder Umweltbelastungen eine auslösende Wirkung haben könnten. Bisher gibt es aber noch keine gesicherten Erkenntnisse über solche möglichen Ursachen. Auch für regionales oder zeitlich erheblich verstärktes Vorkommen (Halder 2009, 16) oder untypisches häufigeres Auftreten in manchen Ländern (z. B. im Oman mit einer Relation von 1:391 Geburten) sind wahrscheinlich bisher nicht bekannte »exogene Noxen« zu vermuten (Sperling 2007, 42 f.). Auch in Europa gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. So wurde bei 10.000 Geburten in Schweden 22,12-mal, in England jedoch nur 10,5-mal das Down-Syndrom (lebend und tot geborene plus Abbrüche) ermittelt (Gocchi et.al. 2011, 35).
Beim Down-Syndrom liegen verschiedene genetische Befunde vor, von denen zum Teil auch der Grad und die Ausprägung der Beeinträchtigung abhängen:
Freie Trisomie 21 (ca. 95 Prozent der Fälle)
Translokation (ca. 3 Prozent)
Mosaik (ca. 2 Prozent)
Partielle Trisomie (sehr selten).
Bei der häufigsten Form, der Freien Trisomie, ist das 21. Chromosom selbst unverändert, es kommt aber dreimal statt zweimal vor. Als Translokation wird die Verlagerung eines Chromosomenbruchstücks an ein anderes Chromosom bezeichnet. Ein Mosaik ist ein Chromosomenbefund, bei dem sowohl trisome (dreimal vorhandene) als auch normale (zweimal vorhandene) Chromosomen 21 in verschiedenen Zellen festzustellen sind. Die Ausprägung des Down-Syndroms ist in diesem Fall abhängig vom Verhältnis der normalen zu den trisomen Zellen und den davon betroffenen Bereichen. Deshalb ist es möglich, dass beim Vorliegen eines gering ausgeprägten Mosaiks sich in seltenen Fällen kein Down-Syndrom (als spezifischer Symptom- und Merkmalskomplex) entwickelt, wie der Bericht einer betroffenen Frau zeigt.
»Ich hatte drei Fehlgeburten, wobei in einem Fall eine freie Trisomie festgestellt wurde. Nach der Geburt meiner Tochter mit Down-Syndrom wurde bei mir eine Blutuntersuchung durchgeführt – ohne Befund. Nach der Geburt eines gesunden Sohnes hatte ich wieder eine Fehlgeburt – wieder lag eine Trisomie 21 vor. Dann wurde unser zweiter Sohn mit Down-Syndrom geboren. Eine erneute Untersuchung von mir (FISH) ergab in 60 % der untersuchten Hautzellen eine Trisomie.
Als ich klein war, sah ich ein wenig wie ein Down-Mädchen aus. Ich hatte auch die schräge Augenstellung. Meine Tochter sieht genauso aus wie ich früher. Ich bin froh, dass es damals nicht entdeckt wurde, ich wäre sonst nicht da, wo ich jetzt stehe. Ich habe meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht und bin Zahnarzthelferin geworden.« (Friedrichs 2009)
Die Verfasserin äußert hier die Vermutung, dass eine frühe Diagnose ihre normale Entwicklung wahrscheinlich wesentlich verändert hätte. Dass sie mit dieser Vermutung Recht hat, macht ein Bericht über eine andere Frau mit einer Mosaikform der Trisomie 21 deutlich, deren Eltern nach der Geburt die Information erhielten, ihre Tochter würde sich »ein bisschen besser entwickeln als ein Durchschnittskind mit Down-Syndrom«. Unter der Überschrift »So geht Inklusion« wird diese mittlerweile »junge Frau mit Down-Syndrom« vorgestellt. Sie »hat Mittlere Reife, arbeitet heute Vollzeit im Schreibdienst der Verkehrspolizei-Inspektion in Erlangen und gehört ganz selbstverständlich zur 80-köpfigen Dienststelle« (de Bruyn 2016, 15). Sollte man bei dieser jungen Frau wirklich vom Down-Syndrom sprechen oder doch eher von einer Mosaikform, die in diesem Fall eben nicht zur Ausprägung der entsprechenden Behinderung führte?
Die partielle Trisomie ist extem selten. Dabei ist nur ein Teil eines Chromosoms 21 verdoppelt und dieses zusätzliche Stück befindet sich innerhalb eines anderen Chromosoms. Aber die Erbinformationen dieses Abschnittes liegen dann ebenfalls dreifach vor und können sich abhängig vom jeweiligen Umfang entsprechend auswirken.